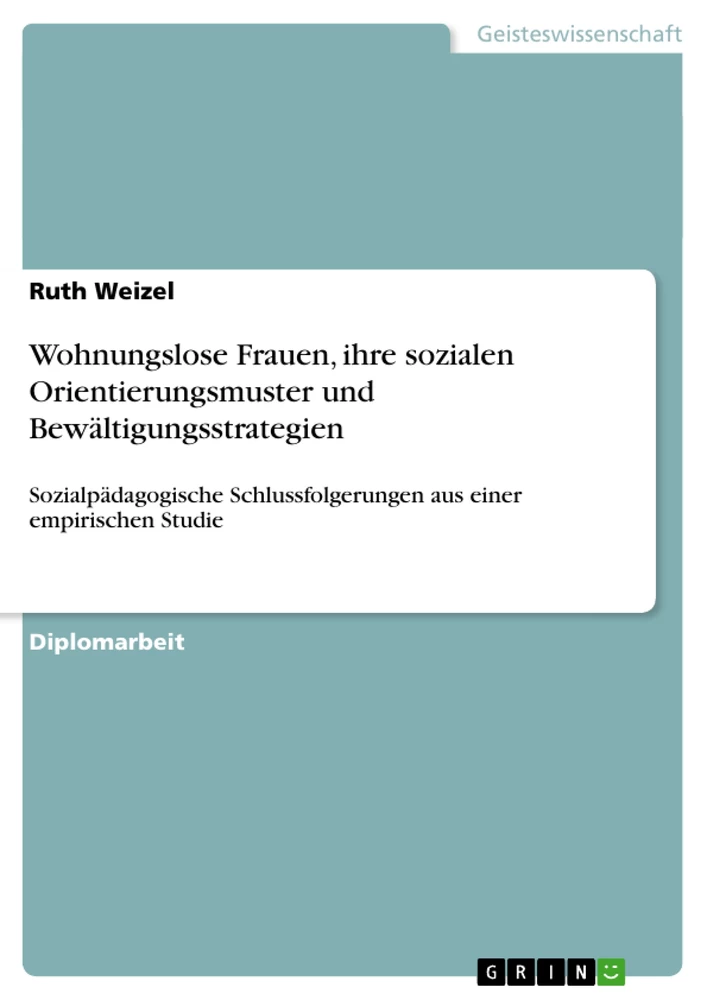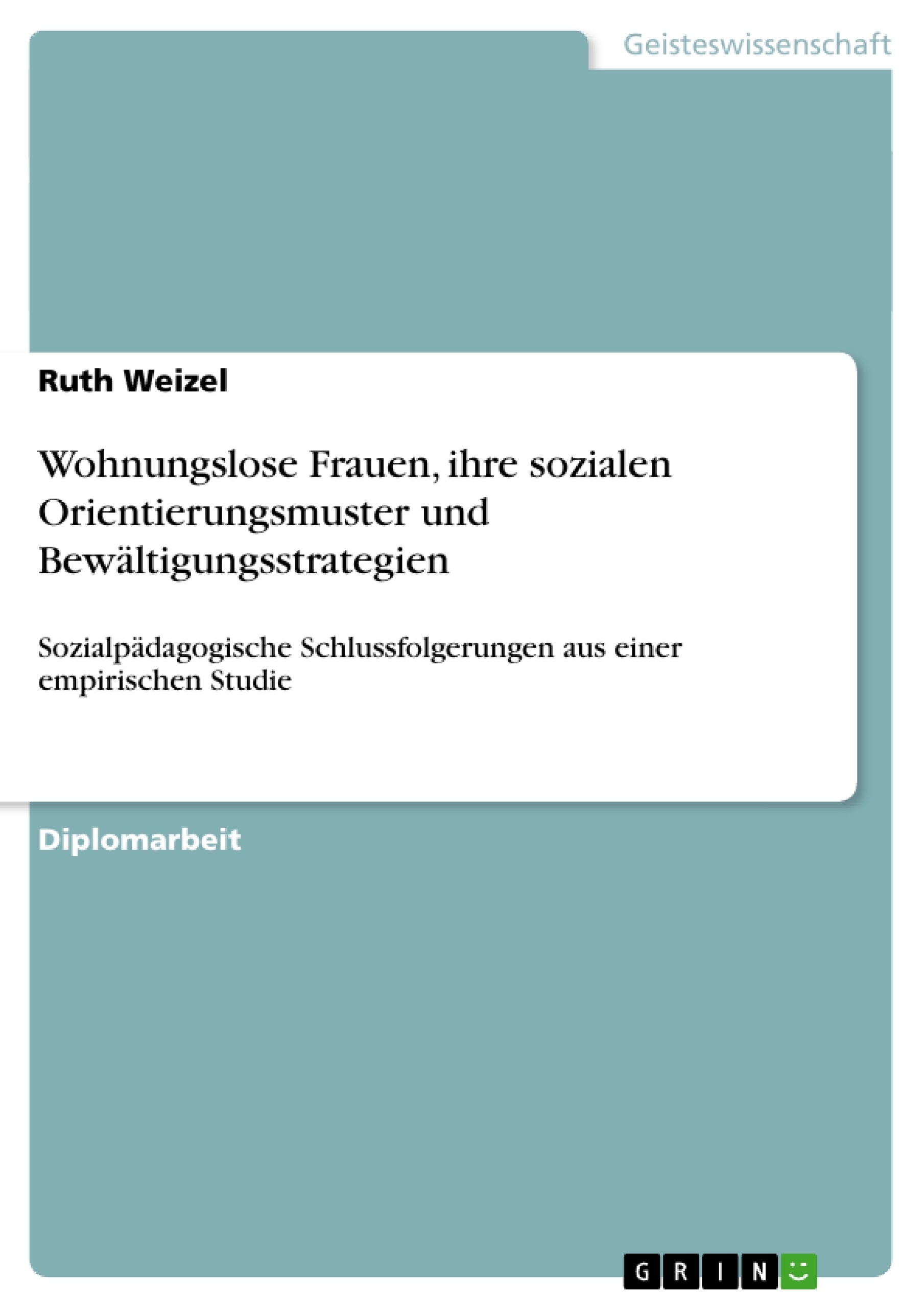Wohnungslosigkeit von Frauen ist erst seit wenigen Jahren ein Thema. Ihr Umfang wurde lange unterschätzt. Typischerweise leben Frauen Wohnungslosigkeit verdeckt. Aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Obdachlosigkeit versuchen Frauen, ihre Wohnungslosigkeit zu verbergen. Sie leben oft bereits lange in ungesicherten Verhältnissen, bevor sie Kontakt zum Hilfesystem aufnehmen. Alle wohnungslosen Frauen haben Armut und Gewalt erfahren.
Die in der empirischen Studie festgestellten sozialen Orientierungen wohnungsloser Frauen sind Ausdruck einer subjektiv praktizierten Normalität und weisen auf Handlungspotenziale hin. Wohnungslose Frauen finden in der Regel einen Weg, ihr Leben wieder zufriedenstellend zu gestalten. Dies gilt für ihr subjektives Empfinden und auch in Bezug auf objektive Kriterien (Ausbildung, Erwerbstätigkeit, gesicherte Wohnverhältnisse, finanzielle Absicherung, Zugang zur Gesundheitsversorgung). Die meisten Frauen sind der Meinung, dass sie sich selbst am besten zu helfen wissen und sehen sich als kompetent und handlungsfähig an. Sie wehren sich zumeist mit viel Energie gegen Defizitzuschreibungen des Hilfesystems. Frauen, die sich selbst als (teilweise) hilfebedürftig einschätzen, erleben das Hilfesystem als unterstützende Kraft. Andere Frauen bedürften einer professionellen Unterstützung, die sie jedoch nicht in der Form finden, die sie sich wünschen.
Aufgrund des Wohnungsnotstands in München finden die Frauen zumeist keine eigene Wohnung. In München ist es den Institutionen der Wohnungslosenhilfe zwar gelungen, eine Ausdifferenzierung des Hilfesystems zu erreichen. Jedoch ist damit dem Wunsch von wohnungslosen Frauen nach billigem Wohnraum nicht entsprochen.
Zur Veränderung dieser Situation ist es notwendig, die Prinzipien feministischer Sozialer Arbeit mit dem Empowerment-Konzept zu verknüpfen. Der Abbau der Defizitorientierung inklusive des Beratungszwangs in der Wohnungslosenhilfe ist dringend geboten, wozu auch die Mitsprache der Klientin über Umfang, Inhalt und Struktur der Hilfestellung gehört. Wohnungslose Frauen müssen an der Ausgestaltung der Hilfeinstitutionen und ihrer Konzepte partizipieren können.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Wohnungslosigkeit von Frauen
2.1 Definitionen von Wohnungslosigkeit
2.11 Gesetzliche Definition von Wohnungslosigkeit nach § 72 BSHG
2.12 Definition von Wohnungslosigkeit der Bundesarbeitsgemeinschaft und Implikationen über Umfang und Struktur der Wohnungslosen
2.2 Wohnungslose Frauen als eigenständige Zielgruppe der Wohnungslosenhilfe
2.3 Erscheinungsformen weiblicher Wohnungslosigkeit
2.31 Sichtbare Wohnungslosigkeit
2.32 Verdeckte Wohnungslosigkeit
2.33 Latente Wohnungslosigkeit
2.4 Typologie wohnungsloser Frauen
2.41 Normalitätsorientierte Typen
2.42 Institutionenorientierte Typen
2.43 Alternativorientierte Typen
2.5 Erklärungsversuche und Faktoren für die Wohnungslosigkeit von Frauen
2.51 Strukturelle und soziale Faktoren
2.52 Individuelle Faktoren
2.6 Anknüpfungspunkte für die empirische Untersuchung
3 Münchner Wohnungslosenpolitik
3.1 Frauenspezifische Wohnungslosenhilfe
3.2 Die Krisensituation im Jahr 2000/2001
3.3 Neue Konzepte in der Münchner Wohnungslosenpolitik
4 Soziale Orientierungsmuster und Bewältigungsstrategien wohnungsloser Frauen: Die empirische Untersuchung
4.1 Methode der Datenerhebung
4.11 Der Fragebogen
4.12 Zielgruppe und Zugangsschwierigkeiten
4.13 Die Interviewsituation
4.14 Ethische Überlegungen
4.2 Datenerfassung und Analyseverfahren
4.3 Stichprobenbeschreibung
4.4 Darstellung ausgewählter Ergebnisse
4.41 Subjektive Einschätzung der Situationsveränderung
4.42 Aktuelle Wohnungssituation
4.43 Strategien der Suche nach einer passenden Bleibe
4.44 Arbeitssituation
4.45 Finanzielle Situation
4.46 Gesundheitssituation
4.47 Soziales Netzwerk
4.48 Haltung zum Hilfesystem
4.5 Zusammenfassende Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
5 Der Empowerment-Ansatz in der Sozialen Arbeit mit wohnungslosen Frauen
5.1 Handlungstheoretische Grundlagen des Empowerment-Konzepts
5.11 Das Menschenbild im Empowerment
5.12 Rolle und Aufgaben der SozialpädagogInnen
5.2 Empowerment mit wohnungslosen Frauen
5.21 Handlungsstrategien wohnungsloser Frauen – ein Fall von Empowerment?
5.22 Mögliche Empowerment-Ansätze in der Wohnungslosenhilfe mit Frauen
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang 1: Fragebögen
Anhang 2: Tabellen
Anhang 3: Auszüge aus der neuen Verordnung zu § 72 BSHG
1 Einleitung
Wohnungslosigkeit gilt als ein Männerphänomen. Das ist die alltägliche Wahrnehmung, bestätigt sich statistisch und zeigt sich in der Infrastruktur des Hilfesystems. Wohnungslo- sigkeit von Frauen wurde lange kaum wahrgenommen und die Zahl wohnungsloser Frauen unterschätzt. In den letzten Jahren rückte allerdings weibliche Wohnungslosigkeit verstärkt in den Blick der Fachöffentlichkeit. Der Anteil der Frauen an den Wohnungslosen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Mit der Sensibilisierung für dieses soziale Problem begann auch der Ausbau des Hilfesystems für wohnungslose Frauen und die ers- ten frauenspezifischen Konzepte wurden erarbeitet.
Ursachen und Umgang mit der Wohnungslosigkeit äußern sich bei Frauen und Männern unterschiedlich. Eine Abgrenzung struktureller Benachteiligungen von individuellen Mo- menten bei weiblicher Wohnungslosigkeit ist extrem wichtig, um weibliche Problemlagen nicht zu individuellen Defiziten zu verkürzen. Die Wohnungslosenhilfe bezieht sich jedoch insgesamt in ihrer Orientierung überwiegend auf die Defizite und Probleme ihrer KlientIn- nen (Enders-Dragässer 1997, 250; Steinert 1997, 196, Back 2000, 133). Voraussetzung für sozialpädagogisches Handeln, wenn dies nicht an den Betroffenen vorbei gehen soll, ist jedoch die Kenntnis der Lebenssituation und der subjektiven Sinnsetzung, aus denen her- aus sich Orientierungsmuster und Handlungsstrategien von wohnungslosen Frauen entwi- ckeln. Zugleich werden mit diesem Blickwinkel auch die Ressourcen und Fähigkeiten der Frauen im Umgang mit ihrer Wohnungslosigkeit in den Mittelpunkt gerückt.
Diese Arbeit will mittels einer empirischen Studie die sozialen Orientierungsmuster und Bewältigungsstrategien von wohnungslosen Frauen herausarbeiten und sieht sich damit in der Tradition der Sozialarbeitsforschung, die „Definitions-, Erklärungs- und Bearbeitungs- prozesse von gesellschaftlich und professionell als relevant angesehenen Problemlagen“ (Steinert/Thiele 2000, 21) anbietet. Damit professionelle Reaktionsformen der Sozialen Arbeit in der Praxis auf ihre Angemessenheit hin überprüft werden können, sollen insbe- sondere auch die Handlungspotenziale wohnungsloser Frauen dargestellt werden. Die sich aus diesen Vorüberlegungen ergebenden Fragestellungen lauten: Wie leben wohnungslose Frauen in der durch Mangel gekennzeichneten Situation der Wohnungslosigkeit? Was sind ihre Ressourcen und Überlebensstrategien? Wie realisieren sie ihre Handlungspläne?
Um die Erscheinungsformen der sozialen Orientierungsmuster und Handlungspotenziale wohnungsloser Frauen zu analysieren, wird das empirische Verfahren der qualitativen In- terviewführung mit einem geschlechtsspezifischen Blickwinkel verbunden. Gestützt wer- den die Ergebnisse der Studie durch sekundärstatistische Auswertungen und die Analyse von Konzepten. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen jedoch die Aussagen wohnungsloser Frauen, d. h. ihre subjektiven Interpretationen über ein Leben ohne Wohnung und die Be- wältigungsstrategien, die sie im Umgang mit der Wohnungslosigkeit entwickeln (Kapi- tel 4). In einer theoriegestützten Analyse mittels des Empowerment-Ansatzes werden aus den Ergebnissen der Studie zu wohnungslosen Frauen Lösungsansätze für die Praxis der Sozialen Arbeit erarbeitet (Kapitel 5).
Zunächst werden jedoch die Erkenntnisse über Erscheinungsformen und Ausmaß von weiblicher Wohnungslosigkeit, ihrer Ursachen und Erklärungsansätze zusammengefasst (Kapitel 2). Die spezifische Situation in München hinsichtlich frauenspezifischer Ansätze in der Wohnungslosenhilfe und die Analyse des Wohnungsnotstands im Jahr 2000/01 wird in Kapitel 3 beschrieben.
Zu dieser Arbeit hat mich mein Jahrespraktikum motiviert, das ich in der Notunterkunft für wohnungslose Frauen ‚Frauenobdach Karla 51‘ leistete. Bereits während meines Prakti- kums hat mich interessiert, wie sich die Frauen mit der Situation der Wohnungslosigkeit arrangieren, welche Schritte sie unternehmen, wie ihre Entwicklung verläuft und inwiefern die einzelnen Frauen ihren Lösungsweg als gut oder schlecht bewerten.
Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei den Frauen, die mir in ihrer oft schwierigen Lebenssituation als Interviewpartnerinnen zur Verfügung standen und damit wesentlich zu dieser Arbeit beigetragen haben.
2 Wohnungslosigkeit von Frauen
Die tatsächliche Situation von wohnungslosen Frauen bleibt oft hinter vorurteilsbelasteten Deutungen, Phantasien und Projektionen verborgen: Sie wird moralisch verurteilt (gefal- len, sittlich verwahrlost), ist verrückt (geisteskrank und nicht-normal) oder – seltener – als ungebunden fantasiert (Flucht vor der Enge eines bürgerlichen Frauendaseins). Diese ge- sellschaftliche Wahrnehmung, so die Begründung in der Untersuchung von Golden (1992, 97 zitiert nach Enders-Dragässer 1997, 245ff), kommt dadurch zustande, dass die woh- nungslose Frau gesellschaftliche Normen der Weiblichkeit verletzt, weil sie ohne Häus- lichkeit, Mann und Familie ist. Die strukturellen Benachteiligungen von Frauen, die gesell- schaftlichen Rollenerwartungen und die objektiven Handlungsbegrenzungen rücken oft in den Hintergrund angesichts individueller Verhaltensweisen, die scheinbar erklären können, warum aus einer zuvor ‚normal‘ lebenden Frau eine ‚randständige‘ Wohnungslose wird,
z. B. nachdem die Beziehung gescheitert ist oder der Arbeitsplatz verloren wurde (Golden 1992 zitiert nach Enders-Dragässer 1997, 246f).
Entscheidende Veränderungen des Bildes der wohnungslosen Frau entwickelten sich aus den Arbeiten der Frauenbewegung und der Frauenforschung, indem die vorurteilsbelaste- ten Vorstellungen von der ‚sittlichen Gefährdung‘ und der ‚Verwahrlosung’ durch Erklä- rungsansätzen zu sozialstrukturellen Diskriminierungen in Bezug auf weibliche Armut und Wohnungslosigkeit abgelöst wurden (Enders-Dragässer 1997, 239; Enders-Dragässer et. al. 2000, 81f; Steinert 1997a, 31). Erst seit etwas mehr als einem Jahrzehnt werden wohnungslose Frauen als eine eigenständige Zielgruppe in der Wohnungslosenhilfe ange- sehen (vgl. Kapitel 2.2), womit auch eine verstärkte Sozialarbeitsforschung verbunden ist, die versucht, die tatsächliche soziostrukturelle Situat]ion von wohnungslosen Frauen aufzu- decken. Die für die Fragestellung dieser Arbeit relevanten Untersuchungsergebnisse über Erscheinungsweisen weiblicher Wohnungslosigkeit (Kapitel 2.3) und Typen von woh- nungslosen Frauen (Kapitel 2.4) sind im Folgenden dargelegt. Erklärungsversuche für die Wohnungslosigkeit von Frauen (Kapitel 2.5) folgen am Schluss dieses Kapitels. Unab- dingbar ist jedoch, zuvor eine Begriffsklärung von Wohnungslosigkeit vorzunehmen, die sich im anschließenden Abschnitt (2.1) findet.
2.1 Definition von Wohnungslosigkeit
Umgangssprachlich bzw. im Alltagsbewusstsein ist wohnungslos bzw. obdachlos ein kla- rer Begriff, denn damit werden jene Menschen assoziiert, die öffentlich auffallen, weil sie als ‚Penner‘ unter Brücken leben, mit Plastiktüten bepackt am Hauptbahnhof oder Stachus- Untergeschoss sitzen und betteln oder in stadtbekannten Obdachlosenunterkünften wie der
‚Pille‘[1] leben. Im Gegensatz dazu gibt es im wissenschaftlichen Kontext nach wie vor kei- ne allgemeingültige, von allen anerkannte Definition von Wohnungslosigkeit und auch die benutzen Begriffe ‚Wohnungslosigkeit‘, ‚Obdachlosigkeit‘ und ‚Nichtsesshaftigkeit‘ wer- den nicht trennscharf verwendet. In der Fachdiskussion hat sich mittlerweile weitgehend der Begriff ‚wohnungslos‘[2] durchgesetzt, parallel fand eine Umbenennung der Nichtsess- haftenhilfe bzw. Gefährdetenhilfe in Wohnungslosenhilfe[3] statt (vgl. Enders-Dragässer 1997, 239; Wolf 2001, 1292; Holtmannspötter 1993a, 385). Zu dieser Entwicklung hat die
Professionalisierung der Sozialen Arbeit beigetragen, die Kritik an den tradierten, indivi- dualistischen und stigmatisierenden Erklärungs- und Behandlungsformen für sogenannte Nichtsesshafte und Gefährdete[4] übte. Gleichzeitig fand auch eine Veränderung des Hilfe- systems von der tradierten Anstalts- und Heimhilfe der 1970er Jahre zu vermehrt ambulan- ten und gemeindeorientierten Einrichtungen statt (vgl. Wolf 2001, 1292; Holtmannspötter 1993b, 672). Im folgenden werde ich zwei[5] Definitionen von Wohnungslosigkeit mit ihren jeweiligen Implikationen vorstellen: die rechtliche Festlegung nach § 72 BSHG und die gesellschaftspolitisch orientierte Bestimmung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs- losenhilfe.
2.1.1 Gesetzliche Definition von Wohnungslosigkeit nach § 72 BSHG
Die Zugangsmöglichkeiten zum Hilfesystem sind eng verknüpft mit den Definitionen von Wohnungslosigkeit und den entsprechenden Hilfeangeboten nach den gesetzlichen Rege- lungen des § 72 BSHG sowie der dazugehörigen Verordnung (VO). Im Jahre 1974 wurde mit der Reform des § 72 BSHG die diskriminierenden Begriffe „Personen ohne ausrei- chende Unterkunft“ und „Nichtsesshafte“ abgeschafft. Seit 1996, im Zuge einer weiteren Reform des Sozialgesetzbuches, wird im § 72 BSHG von „Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind“, gesprochen. Jedoch blieb in der VO zu § 72 BSHG die alte begriffliche Trennung bestehen: „Personen ohne ausreichende Unterkunft“ werden als diejenigen definiert, „die in Obdachlosen- oder sons- tigen Behelfsunterkünften oder in vergleichbaren Unterkünften leben“ (§ 2 VO zu § 72 BSHG), und „Nichtsesshafte“ als Menschen beschrieben, „die ohne gesicherte wirt- schaftliche Lebensgrundlage umherziehen oder die sich ... in einer Einrichtung für Nicht- sesshafte aufhalten“ (§ 4 VO zu § 72 BSHG)[6]. Seit etwa 15 Jahren gibt es von Verbänden die Bestrebung diese in der VO zu § 72 BSHG bestehenden diskriminierenden Begrifflich- keiten und die künstliche Trennung der Personengruppen zu beseitigen, um eine einheitli- che Kostenträgerschaft herbeizuführen. Für sogenannte Nichtsesshafte ist zumeist der überörtliche Sozialhilfeträger zuständig, und die Unterbringungspflicht dieser Personen- gruppe ist nach dem Ordnungsrecht geregelt; „Personen ohne ausreichende Unterkunft“
wird sozialhilferechtlich in der Regel vom örtlichen Sozialhilfeträger, d. h. den Kommu- nen, Hilfe zuteil[7] (vgl. Holtmannspötter 2000, 30). Aufgrund der unklaren Personendefini- tionen („bis zu 50 % der Hilfesuchenden sind nach § 72 Bundessozialhilfegesetz nicht mehr zuzuordnen“ Bundesratsdrucksache 734/00, 32) kam es immer wieder zu Kostenträ- gerstreitigkeiten über ‚ortseigene‘ und ‘ortsfremde‘ Wohnungslose, denen durch die Zu- ordnung zu einer dieser im Gesetz definierten Gruppen Unterstützung verweigert wurde (Roscher 2001, 47; eigene Erfahrungen während des Jahrespraktikums).
Die versteckte Diskriminierung in der VO zu § 72 BSHG liegt für Frauen darin begrün- det, dass sie wesentlich seltener als Männer auf der Straße sind und wesentlich häufiger ihre Wohnungslosigkeit verdeckt leben (beispielsweise bei Bekannten unterkommen oder häufig wechselnde Wohnbehelfe haben, vgl. ausführlich Kapitel 2.3), d. h. gerade solche Lebensverhältnisse zu vermeiden versuchen, wie sie in § 72 BSHG und der VO beschrie- ben werden. Diese gesetzliche Erfassung von Wohnungslosigkeit nimmt die überwiegen- den Lebensverhältnisse von wohnungslosen Frauen nicht zur Kenntnis und trägt durch Unsichtbarmachung mit zur Diskriminierung bei. Gerade die Kategorie der ‚Nichtsesshaf- ten‘ verweist darauf, dass die Wahrnehmung und Beschreibung des Problems Wohnungs- losigkeit männer-zentriert ist (vgl. Enders-Dragässer et. al. 2000, 89f; Brähler-Boyan 1998, 65ff; Steinert 1997a, 33ff).
Mit der Neufassung der VO zu § 72 BSHG zum 01.08.2001 wurde die Diskriminierung im Allgemeinen und die von Frauen im Besonderen aufgehoben, da eine wesentliche Ände- rung der Wegfall der Aufzählung der erfassten Personengruppen war[8] (vgl. Roscher 2001, 46). Die Neuregelung definiert in § 1 VO zu § 72 BSHG den Personenkreis mit Hilfe der Begriffe „besondere soziale Schwierigkeiten“ in Verbindung mit „besonderen Lebensver- hältnissen“, wobei letztere u. a. „bei fehlender oder nicht ausreichender Wohnung“ und „gewaltgeprägten Lebensumständen“ bestehen. Der Wegfall jeglicher Typisierung der Per- sonen nimmt auch die Männerzentrierung aus der Gesetzesformulierung heraus und thema- tisiert mit der Gewaltfrage implizit weiblich geprägte Lebensumstände[9]. Die Länder sind nunmehr aufgefordert in ihren Ausführungsgesetzen eine Neuordnung vorzunehmen. Was jedoch bestehen bleibt, ist eine individuelle und defizitorientierte Zuschreibung der Woh- nungslosigkeit. Das drückt sich darin aus, dass die in § 72 Abs. 1 S. 1 BSHG als notwendi- ge Bedingung zu Gewährung von Hilfe definierte Unfähigkeit zur Überwindung aus eige- ner Kraft in den BSHG-Neukommentierungen vom Juli 2001 mit mangelnder Initiative, Charaktermängeln, Willensschwäche, Abartigkeit des Trieb- oder Gefühllebens etc. identi- fiziert wird, was auch auf Milieu-, Erziehung- und sozialisationsbedingte Schäden zurück- führbar sein könne (zitiert nach Brühl 2002, 47f). Jegliche strukturelle Gesichtspunkte, wie z. B. Wohnungsmarktlage, Arbeitslosigkeit, Armut oder eben auch männliche Gewalt, bleiben damit außen vor.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Zuge der Reformen des Sozialgesetzbuchs die mit dem ‚Wohnungslosenparagrafen‘ einhergehenden Diskriminierungen abgebaut wurden. Insbesondere die neue Reform der VO zu § 72 BSHG zum 01.08.2001 beendet die Typisierung der Personengruppen und thematisiert zum ersten Mal auch weibliche Le- bensverhältnisse. Eine defizitorientierte Problemzuschreibung auf die von Wohnungslosig- keit Betroffenen ist der rechtlichen Definition jedoch inhärent.
2.1.2 Definition von Wohnungslosigkeit der Bundesarbeitsgemeinschaft und Implikationen über Umfang und Struktur der Wohnungslosen
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG 1997) hat eine von vielen Au- torInnen übernommene (vgl. z. B. Enders-Dragässer et. al. 2000, 90; König 1998, 22ff; Bräher-Boyan 1998, 65) Definition von Wohnungslosigkeit vorgelegt, die sehr weitgehend ist, Wertungen vermeidet und eher gesellschaftliche Erklärungen anklingen lässt:
Wohnungslos ist, wer nicht über einen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum verfügt. (BAG 1997)
Als aktuell von Wohnungslosigkeit Betroffene zählen folgende Personengruppen:
- im ordnungsrechtlichen Sektor,
- die aufgrund ordnungsrechtlicher Maßnahmen ohne Mietvertrag, d. h. lediglich mit Nutzungsver- trägen in Wohnraum eingewiesen oder in Notunterkünften untergebracht werden;
- im sozialhilferechtlichen Sektor,
- die ohne Mietvertrag untergebracht sind, wobei die Kosten durch den Sozialhilfeträger nach §§ 11, 12 oder 72 BSHG übernommen werden;
- die sich in Heimen, Anstalten, Notübernachtungen, Asylen, Frauenhäusern aufhalten, weil keine Wohnung zur Verfügung steht;
- die als Selbstzahler in Billigpensionen leben,
- die bei Verwandten, Freunden und Bekannten vorübergehend unterkommen;
- die ohne jegliche Unterkunft sind, "Platte machen";
- im Zuwanderersektor
- Aussiedler, die noch keinen Mietwohnraum finden können und in Aussiedlerunterkünften unterge- bracht sind.
- Anerkannte Asylbewerber in Notunterkünften zählen im Sinne der Definition zwar zu den Woh- nungslosen, können aber bei den Wohnungslosenzahlen aufgrund fehlender Daten nicht berück- sichtigt werden. (BAG 1997)
Aus dieser Definition heraus schätzt als einzige Institution in Deutschland die BAG regel- mäßig die Zahl der Wohnungslosen (vgl. Tabelle 1 im Anhang 2) und verbindet damit politische Forderungen nach gesetzlichen Voraussetzungen für eine bundeseinheitliche Wohnungsnotfallstatistik. D. h. auf Grundlage von Wissen über den Umfang von Wohnungslosigkeit soll eine adäquate „Wohnungspolitik, ... eine bedarfsgerechte Sozialarbeit und eine wissenschaftliche Ursachenforschung“ (BAG 2000a) möglich[10]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
sen in Deutschland im Jahr 2000
(ohne AussiedlerInnen) ist die Gesamtzahl in den letzten Jahren rückläufig, was auf die Verhinderung von Wohnungsverlusten v. a. durch eine verbesserte ambulante Beratung, Mietschuldenübernahme der Kommunen und erleichtere Vermittlung von Wohnraum zu- rückgeführt wird (vgl. BAG 2000a, 2002). Obwohl es in einigen Regionen bzw. Teilen Deutschlands eine hohe Rate an fertiggestellten Wohnungen und damit oftmals eine große Zahl preisgünstiger Wohnungen gibt, spricht die BAG (2002) nicht von einer Entwarnung bei der Entwicklung der Wohnungslosigkeit. Denn der verfügbare Sozialwohnungsbestand, auf den überwiegend einkommensschwache Haushalte angewiesen sind, nimmt weiterhin ab. Aufgrund von steigender Langzeitarbeitslosigkeit und damit einhergehender Sozialhil- febedürftigkeit steigt seit 1997 nach Angaben der Kommunen die Zahl der von Woh- nungsverlust bedrohten Haushalte kontinuierlich an. Laut BAG nimmt die Zahl der akut Wohnungslosen seit Mitte 2001 insbesondere in einzelnen Großstädten wieder deutlich zu (vgl. BAG 1997, 2000a, 2002; Specht-Kittler 2000, 99).
Die Aufschlüsselung der soziodemografischer Angaben der Wohnungslosen nach Haus- haltsstruktur, Geschlecht, Alter und Nationalität ist nur schätzungsweise möglich:
- Für das Jahr 2000 ergibt sich für die ca. 170.000 Einpersonenhaushalte ein Anteil von ca. 71,5 % und für die ca. 68.000 Mehrpersonenhaushalte (Familien mit Kindern, Paa- re, Alleinerziehende etc.) ein Anteil von ca. 28,5 % an den wohnungslosen Haushalten, d. h. der Anteil der wohnungslosen Einpersonenhaushalte ist gegenüber den Vorjahren noch weiter angestiegen (BAG 2000a, 2002; eigene Berechnungen).
- Geschlecht und Alter lassen sich laut BAG (2002; Specht-Kittler 2002, 99) relativ zu- verlässig nur für Einpersonenhaushalte (al- leinstehende Wohnungslose) schätzen. Dabei wird von einem Frauenanteil von ca. 21 % ausgegangen (ca. 34.000 Frauen im Jahr 2000). Der Anteil der Frauen unter den Wohnungslosen insgesamt (ohne Aus- siedlerInnen) liegt bei geschätzten 23 %
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(ca. 90.000 Frauen) und der Männer bei 77 % (ca. 300.000 Personen). Rd. 22 % der Wohnungslosen sind Kinder und Jugendliche (ca. 85.000 Personen) (Zahlen jeweils vom Jahr 2000, vgl. auch Tabelle 1 im Anhang 2).
- Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger und Staatenloser, die Hilfeangebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nahmen, stieg (BAG 1999) bei Alleinstehenden im Jahr 1998 auf ca. 10,6 % (3 % EU-BürgerInnen)[11]. Der Anteil ausländischer wohnungs- loser Frauen von außerhalb der EU liegt doppelt so hoch wie der der Männer (vgl. Ta- belle 7 in Anhang 2).
Ungefähr 14 % der alleinstehenden Wohnungslosen (ca. 24.000 Menschen) lebten im Lau- fe des Jahres 2000 ohne jede Unterkunft auf der Straße, darunter ca. 2.000 bis 2.500 Frau- en (ca. 9 %) (vgl. BAG 2000a, 2000b, 2002, eigene Berechnungen). Diese Zahlen sind als eine Annäherung an Umfang und Struktur der von Wohnungslosigkeit Betroffenen zu ver- stehen, geben jedoch keine Auskunft über die Problematik von Wohnungslosigkeit in ein- zelnen Regionen bzw. Städten, die davon erheblich abweichen kann (vgl. Enders- Dragässer et. al. 2000, 93f).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Definition der BAG die Versorgung mit mietrecht- lich abgesichertem Wohnraums thematisiert und damit das Problem der Wohnungslosig- keit gesellschaftlich definiert. Die geschätzte Anzahl der Wohnungslosen war in den letz- ten Jahren rückläufig, wobei die Situation in den Großstädten sich aktuell verschärft hat. Der Frauenanteil liegt ca. bei einem Viertel aller Wohnungslosen.
2.2 Wohnungslose Frauen als eigenständige Zielgruppe der Wohnungslosenhilfe
Als soziales Problem wurde die Wohnungslosigkeit von Frauen erst Ende der 1980er Jahre zur Kenntnis genommen und erst seit ca. zehn Jahren gelten wohnungslose Frauen als eine eigenständige Zielgruppe für soziale Angebote der Wohnungslosenhilfe. Entscheidende Anstöße dazu kamen aus der Frauenforschung, die insbesondere durch die Thematisierung von Armutsrisiken für Frauen und männlicher Gewalt neue Erklärungsansätze zu gesell- schaftlich bedingten weiblichen Lebensverhältnisse boten. Gleichzeitig veränderten sich die Diskussionen innerhalb der Sozialen Arbeit durch eine zunehmende Kritik an den stigmatisierenden Begriffen des ‚Gefährdeten‘ und ‚Nichtsesshaften‘, also an den individu- alistischen Erklärungsansätzen, und führten zu einer Veränderung des Hilfesystems mit mehr ambulanten Beratungsangeboten in der Wohnungslosenhilfe. Insgesamt führten diese beiden Entwicklungen dazu, dass wohnungslose Frauen stärker ins Blickfeld rückten und zu Adressatinnen des Hilfesystems wurden (Enders-Dragässer et. al. 2000, 81f; Endert- Dragässer 1998, 9f; Steinert 1997a, 31f).
Für wohnungslose Frauen ist jedoch auch heute noch das Hilfeangebot unzureichend. Bundesweit gab es im Jahr 2000 für wohnungslose Frauen 24 ambulante Beratungsstellen, davon zehn mit angegliedertem Tagesaufenthalt und neun selbständige Tagesaufenthalte. Frauenpensionen oder Übernachtungsstellen ausschließlich für Frauen sind selten, nur ca. ein Drittel der Kommunen haben Frauennotunterkünfte (Enders-Dragässer et. al. 2000, 93; BAG 2000b). Eine flächendeckenden Versorgung mit frauenspezifischen Angeboten im Bereich der Wohnungslosenhilfe ist daher nicht gewährleistet. Zumeist werden Frauen in gemischtgeschlechtlichen Notunterkünften bzw. Pensionen untergebracht, in denen es nur in Ausnahmen getrennte Frauenaufenthaltsräume (ca. 13 %) gibt und auch oft die Sanitär- räume (ca. 35 %) und Badezimmer (rd. 50 %) nicht nach Geschlecht getrennt sind, womit diese Unterkünfte keinen ausreichenden Schutz vor Belästigung und Gewalt gewährleisten können (Rosenke 1999, 126ff)[12]. Eine Studie in Hessen ergab, dass „die kommunalen An- gebote sowohl zur Verhinderung als auch zur Versorgung von Frauen bei Wohnungslosig- keit mehrheitlich für nicht ausreichend gehalten wurden“ (Enders-Dragässer 1998, 1). Dass die Hilfeangebote für wohnungslose Frauen unzureichend bzw. unpassend sind, kann laut Enders-Dragässer (et. al. 2000, 187) auch aus dem Umstand geschlossen werden, dass Frauen im Hilfesystem insgesamt wenig präsent sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Trotz des unzureichenden frauenspezifischen Angebots in der Wohnungslosenhilfe[13] ist die Anzahl und der Anteil wohnungsloser Frauen laut DAW-System[14] in den letzten Jahren gestiegen (1999 15,1 %[15], 1991 6,4 % – vgl. Tabelle 2 im Anhang 2), eine Tendenz, die auch innerhalb der einzelnen EU-Länder dokumentiert ist (Avramov 1995, 95). Die Tatsache, dass wohnungslose Frauen seltener als Männer auf derStraße und im Hilfesystem anzutreffen sind, ist jedoch kein hinreichender Indikator dafür, dass Frauen we- sentlich geringfügiger von Wohnungslosigkeit betrof- fen sind (Sellach 1998, 61), da sich die Erscheinungs- weisen weiblicher Wohnungslosigkeit grundsätzlich von der der Männer unterscheiden.
2.3 Erscheinungsformen weiblicher Wohnungslosigkeit
In der Literatur besteht Einigkeit darüber, dass Wohnungslosigkeit bei Frauen in anderen Formen als bei Männern auftritt (Enders-Dragässer et. al. 2001, 94f). Dies zeigt sich ein- mal in Hinsicht auf soziodemografische Unterschiede, deren wichtigste sich anhand der zur Verfügung stehenden Daten aus dem o. g. DAW-System wie folgt skizzieren lassen:
- Danach sind knapp 20 % der weiblichen Wohnungslosen alleinstehend mit Kindern, ca. 7 % leben mit Partner und Kindern und ca. 13 % alleine mit Partner, d. h. 60 % der wohnungslosen Frauen im sozialhilferechtlichen Sektor sind alleinstehend (bei Män- nern 95 %) (Rosenke 1998, 17; BAG 1997). Laut den Schätzung der BAW über Woh- nungslose insgesamt leben 60 % der wohnungslosen Frauen in Mehrpersonenhaushal- ten, d. h. mit Kindern bzw. Partner (Basiszahlen in Tabelle 1 im Anhang 2).
- Wohnungslose Frauen sind deutlich jün- ger als Männer (vgl. Tabelle 3 im An- hang 2). Rd. 36 % der Frauen sind jünger als 30 Jahre (17 % bei Männern) und 67 % unter 40 Jahren (45 % bei Män- nern) (BAG 1997). Das wird auch aus anderen Untersuchungen bestätigt, bei denen der Anteil der jungen Frauen unter
30 Jahren mit bis zu 50 % angegeben wird (Schroll-Decker/Kraus 2000, 110). In der Gruppe der unter 20jährigen ste- hen 10 % Frauen 1 % Männer gegenüber (Bodenmüller 1995, 19)[16].
Alter alleinstehender Wohnungsloser
(Basisdaten in Tabelle 3 in Anhang 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eine weitere geschlechtsspezifische Differenzierung in den Erscheinungsweisen von Wohnungslosigkeit ist mittels den in der Fachöffentlichkeit unterschiedenen Arten – mani- fest und latent – der Wohnungslosigkeit feststellbar. Manifest wohnungslos sind Men- schen, die offensichtlich auf der Straße leben oder vom Hilfesystem wahr- bzw. aufge- nommen werden. Als latent wohnungslos gelten jene, die potenziell von akuter Wohnungs- losigkeit bedroht sind, beispielsweise aufgrund von prekären Wohnverhältnissen (miet- rechtlich ungeschützte Wohnverhältnisse bei Bekannten oder Arbeitgeberunterkünfte wie etwa bei Zimmermädchen) oder aufgrund von Entlassung aus Institutionen (Psychiatrie, Krankenhaus, JVA etc.) (vgl. Enders-Dragässer 1997, 240; Steinert 1997a, 36; Enders- Dragässer et. al. 2001, 94f). Diese Unterteilung der Wohnungslosigkeit angewandt auf den
16 Zahlen aus diesen Studien beziehen sich wie sonst auch fast immer auf eine bestimmte Region, da der lokale Bezug nach § 72 BSHG den Handlungsspielraum der Kommunen darstellt.
Wohnstatus unmittelbar vor Beginn der Hilfe (vgl. Tabelle 5 Anhang 2, BAG 1997) zeigt folgende geschlechtsspezifischen Unterschiede:
- Manifest wohnungslos sind knapp 30 % der Frauen, d. h. sie leben entweder auf der Straße (ca. 10 %) oder in einer Ein- richtung der Wohnungslosenhilfe (20 %), der Anteil der Männer liegt mit fast 60 % doppelt so hoch (davon 26 % ‚Platte‘).
- Als latent wohnungslos sind ca. 45 % der Frauen zu bezeichnen, insbesondere ge- hört dazu der mit 31 % hohe Anteil an Frauen, die bei Freunden/Bekannten un- terkommen. Nur ca. 30 % der Männern sind latent wohnungslos (davon leben 17 % bei Freunden/Bekannten).
Wohnstatus vor der Wohnungslosigkeit
(Basiszahlen in Tabelle 5 in Anhang 2)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Eine eigene Wohnung besaßen unmittelbar vor der Wohnungslosigkeit 26 % der Frau- en (Männer 10 %).
Enders-Dragässer kritisiert aufgrund ihrer Forschungsergebnisse die Unterteilung von ma- nifester und latenter Wohnungslosigkeit, da dies „den tatsächlichen Erscheinungsweisen weiblicher Wohnungslosigkeit nicht gerecht wird“ (Enders-Dragässer et. al. 2001, 95). Sie schlägt eine Dreiteilung von sichtbar, verdeckt und latent wohnungslosen Frauen vor und verändert damit den Blickwinkel hin zu den Lebensverhältnissen und Bewältigungsstrate- gien der von Wohnungslosigkeit betroffenen Frauen.
2.3.1 Sichtbare Wohnungslosigkeit
Im Gegensatz zu offensichtlich auf der Straße lebenden ‘Pennern’ sind obdachlose Frauen in der Öffentlichkeit kaum zu erkennen, nur selten ist eine umherziehende ‚Tütenfrau‘ deutlich erkennbar. Studien zu auf der Straße lebenden Obdachlosen konstatieren – unab- hängig vom Befragungsort – daher ‚nur’ einen Frauenanteil von rund 10 % (GFS 1995, 6; AG Freie Wohlfahrtspflege Hamburg 1996; Holm et. al. 1999, 7; GFS 1999a, 48; Behrens- Schröter 1999, 21; Duschinger 2000, 6). Diese sichtbar auf der Straße lebenden Frauen gelten als die typisch wohnungslosen Frauen, sind es aber nicht. Sie leben entweder als Teil einer Gruppe im Straßenmilieu oder ziehen als Einzelgängerinnen umher (Steinert 1997a, 37).
Da die offen wohnungslosen Frauen, die auf der Straße leben, gesellschaftliche Weiblich- keitsvorstellungen durchbrechen (kein Haus, Familie, Mann) sind sie gezwungen, sich mit gesellschaftlichen Abwertungen und Stigmatisierungen auseinanderzusetzen. Viele von
ihnen suchen sich neue Orientierungsmuster und können daher zumeist den alternativorien- tierten Typen wohnungsloser Frauen zugerechnet werden (vgl. Kapitel 2.43).
2.3.2 Verdeckte Wohnungslosigkeit
Als typisch wohnungslose Frauen müssen – da sie die zahlenmäßig größte Gruppe darstel- len – diejenigen gelten, die in verdeckter Wohnungslosigkeit leben, d. h. die in ihrer Woh- nungslosigkeit nicht sichtbar werden wollen. Frauen versuchen, möglichst lange ohne insti- tutionelle Hilfe auszukommen und suchen daher nach privaten Lösungen. Sie schlüpfen bei FreundInnen/Bekannten unter und gehen oft zweckorientierte Partnerschaften ein, was zwar ein Dach über dem Kopf garantiert jedoch keinerlei mietrechtliche oder ökonomische Absicherung. Ausnutzung, Gewalt, Gelegenheitsprostitution bedingen eine Lebenssituati- on, die von der verdeckten in die sichtbare Wohnungslosigkeit führen kann. Oder sie keh- ren mehrmals in die Partnerschaft bzw. zur Herkunftsfamilie zurück, die sie aufgrund eska- lierender Konflikte verlassen haben oder aus der sie wegen (sexueller) Gewalt geflohen sind (Enders-Dragässer et. al. 2001, 98ff; Enders-Dragässer 1998, 21ff).
Wesentlich für diese Frauen ist der Verlust von familiären und sozialen Beziehungen. Bei Müttern fällt die Trennung von ihren Kindern erschwerend ins Gewicht, die sie dem Selbstbild und der gesellschaftlichen Rollenzuschreibung entsprechend versorgen und er- ziehen müssten. Wohnungslose Frauen verfügen nicht mehr über diese zentralen Dimen- sionen ‚weiblicher Identität‘, was zu Schuld- und Schamgefühlen führt. Auch gibt es für sie keine öffentlichen Räume, wo sie sich frei von männlicher Überlegenheit und Gewalt bewegen können, d. h. Frauen verlieren nicht nur ihre Wohnung, sondern auch deren Schutzfunktion. Darüber hinaus erleben wohnungslose Frauen schnell soziale Abwertung bzw. haben negative gesellschaftliche Deutungsmuster verinnerlicht. Sie selbst verstehen sich daher in der Regel eher als wohnungssuchende und nicht als wohnungslose Frau (En- ders-Dagässer et. al. 2000, 96, 98f).
Die versteckte Erscheinungsweise weiblicher Wohnungslosigkeit muss auch als Bewälti- gungsstrategie für Frauen verstanden werden, d. h. in dem ihr möglichen Rahmen selbstbe- stimmt leben zu können und ihren eigenen Grundbedürfnissen (Essen, Duschen, Waschen) nachgehen zu können, wobei sie auf ihre Beziehungs- und Versorgungskompetenzen zurückgreifen (Enders-Dragässer 1998, 21ff).
An das Hilfesystem wenden sich wohnungslose Frauen in der Regel erst im äußersten Not- fall, d. h. wenn sie nicht mehr weiter wissen und es ihnen schon lange schlecht geht (BAG 2002b, Enders-Dagässer et. al. 2000, 100). Diese Frauen sind – auch wenn sie nicht im Hilfesystem in Erscheinung treten – nicht latent sondern faktisch wohnungslos.
2.3.3 Latente Wohnungslosigkeit
Latent wohnungslos sind Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, da sie in einer mietvertraglich ungesicherten Wohnsituation leben. Häufig läuft der Mietvertrag über den Ehemann, Partner, Vater etc., was bei Beziehungskonflikten oder Trennung zum Auszug aus der Wohnung führen kann. Insbesondere sind hierbei die Frauen zu nennen, die in ge- waltgeprägten Lebensverhältnissen leben und der Gewalt oft nur durch Auszug aus der Wohnung entgehen können[17]. Gerade auch der Anteil sehr junger Frauen, die von Woh- nungslosigkeit betroffen sind, zeigt die Auswirkungen mietrechtlich ungesicherter Ver-hältnisse.
Ungenügend abgesichert sind auch an die Beschäftigungsstelle gekoppelte Wohnmöglich- keiten. Oft kommt dies in frauentypischen Berufen vor, wie Hausangestellte oder häusliche Pflege, aber auch in der Gastronomie und bei bestimmten Ausbildungsberufen, beispiels- weise Krankenschwester. Dazu gerechnet werden müssen auch Frauen, die in Bordellen und Hostessenwohnungen untergebracht sind.
Latent wohnungslos sind weiterhin Frauen, die nach einem Aufenthalt im Krankenhaus, Psychiatrie, Suchtklinik oder Haftanstalten nicht mehr in die alte Wohnung bzw. zur Her- kunftsfamilie zurück können (Enders-Dragässer 2000, 100f).
2.4 Typologie wohnungsloser Frauen
Die Typologie wohnungsloser Frauen ist von Erika Steinert (1997) in einem zweijährigen Forschungsprojekt[18] mittels der Auswertung von 48 narrativen Interviews mit von Woh- nungslosigkeit betroffenen Frauen erstellt worden (Steinert 1997a, 70, 179). Das ein- schneidende Erlebnis des Wohnungsverlustes verlangt von den Frauen eine Reaktion, die entweder in der Wiederherstellung des Status Quo oder in einer Anpassung an veränderte Bedingungen bestehen kann und somit zentrale Deutungsmuster (Wert- und Verhaltens- muster) in Frage stellt. Deutungsmuster und soziale Orientierungen haben eine Bedeutung, die die individuellen Zielsetzungen beeinflusst – so die These von Steinert (1997, 119f). Deshalb konzentriert sich ihre Materialauswertung auf folgende zentrale Fragestellungen:
- Die subjektive Problemgenese der Wohnungslosigkeit, d. h. vor allem der Unterschied zwischen interner und externer Zuschreibung der Wohnungslosigkeit.
- Der Umgang mit der Wohnungslosigkeit, d. h. welche Ziele und welche soziale Orien- tierungen wählen die Frauen. Hierbei erfasst die Auswertung insbesondere die Unter- scheidung zwischen der Eigenzuschreibung als Akteurin bzw. Opfer der Verhältnisse, die alltagspraktische Relevanz einer Ausrichtung des Lebens am bürgerlichen Normali- tätsmodell und das Verhältnis zum Hilfesystem (Steinert 1997b, 120ff).
Nach Analyse des Materials anhand der sozialen Orientierung kristallisieren sich drei Grundkategorien wohnungsloser Frauen heraus: normalitätsorientierte, institutionenorien- tierte und alternativorientierte Typen, die im Folgenden kurz beschrieben werden. Die Deutungsmuster hinsichtlich der Problemgenese konnten keinem bestimmten Orientie- rungsmuster zugeordnet werden – gleiche Interpretationen der Problemgenese können zu entgegengesetzten Orientierungen führen und umgekehrt (Steinert 1997b, 182f). Die Typo- logie ist außerdem – wie es jede Typologie sein sollte – eine Idealisierung einiger bestimmter Eigenschaften und dient nicht der Zuschreibung von Charakteren realer Men- schen.
2.4.1 Normalitätsorientierte Typen
Alle normalitätsorientierten Typen wohnungsloser Frauen schätzen sich selbst als hand- lungsfähig ein. Sie streben normalisierte Wohn- und Arbeitsverhältnisse an (Orientierung am bürgerlichen Normalitätsmodell[19] ) und sehen ihre Wohnungslosigkeit als ein vorüber- gehendes Problem. Da sie sich selbst als kompetent und aktiv erleben, legen sie Wert dar- auf, dass das Hilfesystem sie nicht entmündigt, da sie ihren Hilfebedarf nicht auf einer per- sönlichen Ebene sondern nur aufgrund problematischer Umstände sehen (Problemgenese i. d. R. extern attribuiert) (Steinert 1997b, 124f, 179ff). Die vier Untertypen unterscheiden sich v. a. in ihrem Umgang mit dem Hilfesystem.
- Die Dissidentin
Äußere Umstände lassen sie wohnungslos werden (z. B. materielle Notlage, Trennung, Wohnungsmarktlage). Diese Frauen zeigen eine hohe Motivation und viel Eigenaktivität, um diese Situation so schnell wie möglich zu beenden, und haben eine eigene Vorstellung über Formen der Bewältigung (z. B. Arbeits-, Wohnungssuche). Professionelle Hilfe wird als Entmündigung und Kontrolle verstanden, denn sie definieren sich nicht als persönlich hilfebedürftig oder gar defizitär: Gewünschte Hilfe erhalten sie nicht (Vermittlung einer Wohnung) und unerwünschte wird geboten (z. B. Beratungsgespräche). Diese Frauen setz-ten sich gegenüber der empfundenen Entmündigung und mangelndem Respekt zur Wehr, indem sie eine klare Abgrenzung gegenüber dem Hilfesystem und anderen BewohnerInnen vornehmen und sich im Dissens mit den SozialarbeiterInnen befinden (keine Übernahme der Problemdefinition). Zumeist ist ihr Kontakt zum Hilfesystem einmalig und kurz (Stei- nert 1997b, 125ff).
- Die Pragmatikerin
Auch diese Frauen schreiben die Problemgenese oft externen Faktoren zu und sehen das Hilfesystem nur als unvermeidbare Übergangslösung bis zur Wiederherstellung des Status Quo ante. Sie geht das Problem des Wohnungsverlustes mit Eigenaktivität und Planung an, versteht sich als nicht-betreuungsbedürftig und empfindet sich aufgrund der Zwänge im Hilfesystem entmündigt. Diese Frauen schlagen eine Strategie des flexiblen Widerstands im Hilfesystem ein, d. h. Anpassung in Bereichen wo es leicht zu bewerkstelligen ist (z. B. Hausversammlungen), Sicht-entziehen, wo die ‚Kosten‘ hoch wären (persönliche Bera- tungsgespräche). Der Kontakt zu anderen BewohnerInnen ist von marginaler Bedeutung. Auch diese Frauen sind oft zum ersten mal wohnungslos (Steinert 1997b, 133ff).
- Die Hilfebedürftige
Die sogenannten hilfebedürftigen Frauen sehen häufig ein persönliches Problem als die Wohnungslosigkeit mitverursachend (z. B. nicht mit Geld umgehen können, Probleme mit dem alleine leben haben, Zurechtfinden in der Großstadt). Sie definieren sich selbst als partiell hilfebedürftig, weshalb das Hilfesystem für sie eine Unterstützung bedeutet. Auch stimmt ihre Problemdefinition zumeist mit der der SozialarbeiterInnen überein und sie wünscht sich eine persönliche Betreuung. Diese Frauen streben aktiv eine Veränderung bzw. Erweiterung ihrer Lebensperspektive an, die normalorientiert ist (Ausbildung suchen, Wohnung finden etc.). Daher verstehen sie den Kontakt zum Hilfesystem zeitlich befristet. Zumeist gibt es einen ausgeprägten Kontakt zu anderen BewohnerInnen der Einrichtung (Steinert 1997b, 139ff).
- Die Orientierungssuchende
Die zumeist jungen Frauen (oft Familienflucht) leben eine explorative Phase der Suche nach einem eigenen Lebenskonzept, in der sie Verschiedenes ausprobieren und auch ver- schiedene Wohnformen leben. Eine Orientierung am normalitätsorientiertes Lebenskon- zept (Wohnung, Umschulung, mit Freund zusammenleben, Kinder) taucht erst wieder am Ende der Orientierungsphase auf. Dann ist sie zielorientiert und stellt auch Kontakt zum Hilfesystem her, beansprucht jedoch nur Unterstützung wegen ihrer problematischen Situa- tion und nicht wegen persönlicher Hilfebedürftigkeit (Steinert 1997b, 142ff).
2.4.2 Institutionenorientierte Typen
Bei den drei institutionenorientierten Typen wohnungsloser Frauen wird das Hilfesystem als relevante materielle, soziale, pädagogisch-therapeutische und emotionale Ressource wahrgenommen. Diese Frauen haben sich an ein Leben ohne Wohnung angepasst und ori- entieren sich an den Anforderungen des Hilfesystems. Auch hier wird zumeist eine externe Problemgenese vorgenommen (problematische Familienverhältnisse, soziale Benachteili- gungen, Krankheit etc.), wobei jedoch die Probleme, die die Wohnungslosigkeit verursacht haben, sich subjektiv schwerwiegender darstellen. Eine Normalitätsorientierung ist von marginaler Bedeutung, d. h. sie scheint alltagspraktisch wenig realisierbar und eine Verän- derung der Situation nicht möglich (Steinert 1997b, 148ff, 162f).
- Die Heimatsuchende
Diese Frauen nehmen oft eine externe Problemgenese vor (körperliche bzw. psychische Erkrankung, Trennung, fehlende Unterstützung von Ämtern, keine Arbeit), wobei die ein- zelnen Faktoren jedoch als unbeeinflussbar gelten. Oft sind es Frauen in der mittleren Le- bensphase, die bereits mehrere Fehlschläge bzw. Enttäuschungen, zumeist eine lange Kar- riere als Wohnungslose und einen ebenso langen Aufenthalt im Hilfesystem hinter sich haben, weshalb eine Orientierung am Normalitätsmodell obsolet geworden ist. In dieser Situation passen sie sich den veränderten Lebensbedingungen durch Assimilierung an ei- nen institutionellen Schutz an, von denen ihr Überleben abhängt, denn sie sehen sich selbst als nicht handlungsfähig und haben keine Hoffnung auf Veränderung (Steinert 1997b, 149ff).
- Die Pendlerin
Charakteristisch für diese Frauen ist zwar eine externe Problemgenese (Opfer problemati- scher Verhältnisse), jedoch sehen sie sich trotzdem als Akteurin, in dem sie institutionelle Hilfsangebote funktionalisieren und oft jahrelang zwischen Einrichtungen pendeln, manchmal unterbrochen von kurzen Phasen der Entfernung vom Hilfesystem. Bürgerliche Werte sind ohne Bedeutung, ihre alltagspraktische Ausrichtung orientiert sich am Hilfesys- tem. Sie agieren gegenwartsorientiert, haben keine langfristige Planung bzw. kein Durch- haltevermögen und zeigen eine hedonistische Haltung (Steinert 1997b, 152ff).
- Die Schutzbedürftige
Diese Frauen nehmen zumeist eine externe Problemgenese vor, in dem sie ihren Eltern die Schuld an ihrer problematischen Biografie geben, die sie in einen Abstiegssog gerissen hat (z. T. Suchtproblematik). Sie pendeln zwischen den angeboten des Hilfesystems, das sie als eine relevante soziale bzw. therapeutische Ressource wahrnehmen, und Phasen ohne dessen Beanspruchung, die sich jedoch nicht als dauerhaft tragfähig erweisen. Eine Normalitätsorientierung scheint im Alltag nicht realisierbar, gilt jedoch als erstrebenswerte Fern-Perspektive (Steinert 1997b, 158ff).
2.4.3 Alternativorientierte Typen
Für sogenannte alternativorientierte Typen wohnungsloser Frauen sind bürgerliche Werte von untergeordneter Bedeutung, stattdessen hat eine alltagspraktische Orientierung an sub- kulturellen Werten und Normen bei gleichzeitiger Unabhängigkeit vom Hilfesystem statt- gefunden. Diese Frauen haben sich an ein Leben im Straßenmilieu angepasst (Steinert 1997b, 164ff, 178f).
- Die Szeneorientierte
Externe attribuierte Faktoren lassen diese Frauen eine Lebenskrise und die damit einherge- hende bzw. folgende Wohnungslosigkeit erleben. Bei ihnen findet ein biografischer Bruch und eine soziale Umorientierung statt, d. h. die Internalisierung von Werten und Normen der männlichen geprägten Straßenszene und die Entwertung der früheren, normalitätsorien- tierten Lebenswelt. Sie leben als Teil einer Gruppe auf der Straße, worüber sie auch ihre Identität herstellen, wobei Frauen als schutzbedürftig gelten und über ‚ihren‘ Mann defi- niert werden. Das Hilfesystem wird nur als materielle Ressource genutzt und keine Verän- derung der Lebensumstände angestrebt (eventueller Wunsch nach bürgerlicher Idylle ohne Realorientierung). Sie leben einen Gegenwartshedonismus – die Zukunft kann nur Schlimmeres bringen (Krankheit, Knast, Psychiatrie, Tod) (Steinert 1997b, 164ff).
- Die Grenzgängerin
Äußere Umstände lassen diese Frauen wohnungslos werden, woraufhin sie sich zeitweise am Straßenmilieu orientieren und zeitweise auch wieder Kontakt mit dem Hilfesystem aufnehmen. Es findet eine partielle Umorientierung statt, d. h. sowohl eine alternative Aus- richtung des Verhaltens (nichts tun, in den Tag hinein leben) als auch eine Normalitätsori- entierung (Arbeit suchen). Dieses widersprüchliche Verhalten kann zum Problem werden (Steinert 1997b, 168ff).
- Die Individualistin
Diese Frauen sehen sich selbst als unkonventionell und ungebunden. Ein fester Wohnsitz erscheint nicht wichtig. Sie haben sich von einem Normalitätsmodell entfernt, aber nie dem Straßenmillieu angeschlossen. Zumeist sind dies ältere ‚schrullig‘ wirkende Frauen, die alleine umherziehen. Der Kontakt zu SozialpädagogInnen ist von ihrer Seite aus i. d. R. unproblematisch (Steinert 1997b, 176ff).
Insgesamt ist es wichtig festzuhalten, dass die Typologie wohnungsloser Frauen einer der wenigen Versuche ist, die Bewältigungsstrategien und Orientierungen der Frauen zu analy- sieren und ihre tatsächliche Lebensrealität beschreiben zu wollen. Der Blick des Hilfesys- tems ist häufig auf die Probleme Wohnungsloser zentriert und zumeist von einem ‚Norma- lisierungsdruck‘ begleitet (Back 2000, 133). Viele andere Analysen und Beschreibungen konzentrieren sich darauf, Ursachen oder Problemdimensionen von Wohnungslosigkeit
herauszuarbeiten (vgl. folgendes Kapitel), so dass dadurch häufig ein defizitäres Bild von wohnungslosen Menschen entsteht. Die Thematisierung des Selbstbildes wohnungsloser Frauen vertieft das Verständnis ihrer Lebenslage und kann dem Defizitblickwinkel eine Ressourcenorientierung entgegenstellen.
2.5 Erklärungsversuche und Faktoren für die Wohnungslosigkeit von Frauen
In den vorhergegangen Kapiteln ist bereits implizit deutlich geworden, dass Wohnungslo- sigkeit in aller Regel ein Folgeproblem ist. Es gehen andere Schwierigkeiten voraus, und oft genug entwickeln sich aus der Wohnungslosigkeit schließlich weitere Probleme. In der Fachdiskussion wird daher von einem multidimensionalen Problemszenario bei wohnungs- losen Frauen (und Männern) gesprochen: am Rande des Arbeits- und Wohnungsmarktes, mit geringen Bildungs- und Qualifikationsstandards und einer diskontinuierlichen Er- werbsbiografie, oft vom Mann ökonomisch abhängig, häufig desolate Kindheit und Jugend und frühere Heim- bzw. Pflegefamilienaufenthalte, massive Beziehungsprobleme und ‚de- struktive Bewältigungsstrategien‘ wie Depression oder süchtiges Verhalten, oft kombiniert mit weitern Problemen wie körperlichen und/oder psychischen Erkrankungen, Verschul- dung etc. (Steinert 1997a, 52f). Diese Summe von Problemlagen prägen nicht nur häufig das Bild der wohnungslosen Frau sondern sind auch schwer in einem Erklärungsmodell zusammenfassbar. Denn was hierbei als auslösender Grund, als Ursache oder als Risiko- faktor für die Entstehungsbedingungen von Wohnungslosigkeit und was als direkte oder indirekte Folge zu rechnen ist, lässt sich oft schwer ausmachen, da es sich um wechselsei- tig sich beeinflussende und überlagernde Faktoren handelt (Steinert 1997a, 62, Enders- Dragässer 1997, 241).
Die zwei häufig zitierten und kritisierten eindimensionalen Erklärungsansätze, der ökono- misch orientierte Ansatz, der sich auf die Feminisierung von Armut bezieht, und der sozi- alpsychologisch orientierte Ansatz, der weibliche Sozialisationsbedingungen mit inadäqua- ten Bewältigungsstrategien verbindet, zeigen zwar wichtige Bestandteile auf, können je- doch aufgrund ihrer Monokausalität weibliche Wohnungslosigkeit nicht vollständig erklä- ren (vgl. Steinert 1997a, 52ff, Enders-Dragässer 1997, 241ff, Enders-Dragässer et. al. 2001, 101ff; Brender 1999, 27ff; Riege 1994, 12ff). Deshalb erscheint es sinnvoll, diese beiden Ansätze in ein multifaktorielles Bedingungsgefüge zur Erklärung von Wohnungslo- sigkeit aufzunehmen, was von Steinert (1997, 62ff) vorgeschlagen, jedoch nicht ausformu- liert wurde. Die Modellvorstellung dahinter, wie sie auch in der Sozialepidemiologie pos- tuliert wird, ist, dass strukturelle, soziale und individuelle Faktoren in Wechselbeziehung untereinander verbunden sind und eine ambivalente Bedeutung haben, d. h. je nach Situa- tion sowohl als Ressource wie als Belastung wirken können: Beispielsweise sind enge so- ziale Beziehungen eine soziale Ressource, um Wohnungslosigkeit auffangen zu können (vgl. verdeckte Wohnungslosigkeit), sie können sie aber ebenso hervorbringen, wie bei Familienausreißerinnen, die der sozialen Kontrolle entgehen wollen (Steinert 1997a, 62).
Im Folgenden werde ich die wichtigsten Erklärungsansätze von Wohnungslosigkeit in Be- zug auf strukturelle, soziale und individuelle Faktoren darlegen.
2.5.1 Strukturelle und soziale Faktoren
Einig sind sich alle AutorInnen, dass Armut ein Faktor ist, der weibliche Wohnungslosig- keit mit hervorrufen kann (vgl. Steinert 1997a, 52ff, Enders-Dragässer 1997, 241ff, En- ders-Dragässer et. al. 2001, 101ff; Brender 1999, 27ff; Riege 1994, 12ff; Geiger 1992, 7ff; Sellach 1995). Unzureichende materielle Absicherung und damit ein erhöhtes Armutsrisiko aufgrund eines geschlechtsspezifisch segmentierten Arbeitsmarkts (unbezahlte Reproduk- tionsarbeit wird den Frauen zugewiesen) und sozialrechtliche Abhängigkeit vom Ehemann (das Subsidiaritätsprinzip geht vom ‚Normalfall‘ der Versorgerehe aus) nehmen dabei eine zentrale Stellung ein. Das System der sozialen Sicherung diskriminiert Frauen durch Be- nachteiligungen, die aufgrund ihrer Erwerbsbiografie (diskontinuierliche Berufslaufbahn, Lohndiskriminierungen) entstehen (Steinert 1997a, 53ff; Enders-Dragässer et. al. 2001, 102ff, 107ff). Hinzuzufügen ist, dass die typischen Frauenberufe schlechter entlohnt wer- den. Unbestritten ist, dass Armut strukturell bedingt überwiegend weiblich ist, trotzdem ist Wohnungslosigkeit vor allem (77 %) ein männliches Phänomen (vgl. Kapitel 2.12, Tabel- le 1 in Anhang 2). Die These dazu lautet, dass Frauen mit Armut und drohender Woh- nungslosigkeit besser umgehen können als Männer, d. h. aufgrund ihrer weiblichen Sozia- lisation Kompetenzen im Reproduktionsbereich dazu nutzen, Häuslichkeit als ein zentrales Merkmal von gesellschaftlich zugeschriebener Weiblichkeit zu erhalten (vgl. verdeckte Wohnungslosigkeit) (Geiger 1992, 9; Steinert 1997a, 57; Enders-Dragässer et. al. 2001, 118f).
Unbestritten ist in der Literatur weiterhin, dass Veränderungen in sozialen (Familien-) Be- ziehungen ein wichtiger Grund für Wohnungslosigkeit sein können (Enders-Dragässer et. al. 2001, 119ff; Steinert 1997a, 60f; Rosenke 1997, 15f; Sellach 2001, 7f).
- Die Veränderung der Familienverhältnisse (Trennung bzw. Scheidung vom Partner 37,4 %, Flucht aus einer Gewaltpartnerschaft 10 % und Auszug von den Eltern 21,5 %) ist bei Frauen mit knapp 70 % der häufigste Auslöser für Wohnungsverlust (gegenüber ca. 50 % bei Männern, wobei Gewalt hier keine Rolle spielt) (BAG 1997, Tabelle 4 in Anhang 2).
Häusliche Gewalt gilt ebenfalls als eine geschlechtsspezifische Ursache von Wohnungslo- sigkeit und ist eindeutig ein Ausdruck der patriarchalen Gesellschaft. Die Folgen von Ge-
walt gegen Frauen sind häufig Trennung, Scheidung[20] sowie körperliche und psychische Beeinträchtigungen der Gesundheit und oft auch Alkoholkonsum, Drogen- bzw. Medika- mentenabhängigkeit, was wiederum das Risiko von Verarmung und Wohnungslosigkeit mit sich bringen kann (Enders-Dragässer et al 2001, 122, 219). Gewalterfahrung kann so- mit die persönlichen Ressourcen entscheidend mindern, wobei hier deutlich die wechsel- seitige Beeinflussung der strukturellen und persönlichen Faktoren zu Tage tritt. Da ca. 90 % der wohnungslosen Frauen männliche Gewalt während der Zeit der Wohnungslosig- keit erlebt haben (Enders-Dragässer et al 2001, 122), ist die Relevanz des Gewaltfaktors sehr hoch einzuschätzen.
Die Jugend- bzw. junge Erwachsenenphase scheint für Frauen ein besonderer Risikofak- tor in Bezug auf Wohnungslosigkeit zu sein (vgl. Kapitel 2.3 und Tabelle 3 und 4 in An- hang 2). Zur grundsätzlichen Verunsicherung während der Adoleszenz kommt für Mäd- chen der Wandel der Frauenrolle hinzu. Eine weibliche Sozialisation mit den bestehenden Einschränkungen und Unterdrückungen birgt ein mädchenspezifisches Konfliktpotenzial in sich, das u. U. mit Auszug von den Eltern bzw. Familienflucht beantwortet wird und bei ungenügender materieller Absicherung zu Wohnungslosigkeit führen kann (Bodenmüller 1995, 34). Dies gilt in besonderer Weise für Mädchen mit einer bikulturellen Sozialisation, in der sich der Konflikt mit der tradierten weiblichen Rollenerwartung oft schärfer stellt (Bodenmüller 1995, 35). Dies findet seinen Niederschlag in der Zunahme junger ausländi- scher Frauen als Klientinnen der Wohnungslosenhilfe (Philipp 2002, 59).
Dass die ökonomische Abhängigkeit von Frauen nach der Trennung zu materieller Unter- versorgung und damit auch zu Wohnungslosigkeit führen kann, wird von einigen AutorIn- nen besonders hervorgehoben (Geiger 1992, 9; Enders-Dragässer et. al. 2001, 120f) und erscheint aufgrund der Analyse weiblicher Armut auch logisch. Andere sehen in den weib- lichen Sozialisationsbedingungen und daraus folgenden Rollenerwartungen (Haus-, Ehe- frau, Mutter) psychosoziale Defizite in der Persönlichkeit wohnungsloser Frauen (Bren- ner/Romaus 1990, 3ff; Brender 1999, 31f), die sie nicht genügend auf die Zwänge einer autonomen und selbstentworfenen Biografie vorbereiten[21]. Von anderen (Steinert 1997a, Im Sinne des multifaktoriellen Modells zur Erklärung von Wohnungslosigkeit sind die strukturellen Faktoren (weibliche Armut, Gewalt, Stigmatisierung der ‚wohnungslosen Frau‘) negative Faktoren, die jedoch im Einzelfall (soziale Absicherung, Bildungs- und Erwerbschancen) teilweise aufgefangen werden können. Die typisch weibliche Sozialisati- on wird bei der Erklärung von Wohnungslosigkeit als ambivalent beurteilt: Einerseits hilft die Bindungsorientierung den Frauen durch ihr soziales Netzwerk Wohnungslosigkeit auf- zufangen, ebenso wie ihre Orientierung an Häuslichkeit hilft, die sie vermehrt motiviert, Wohnraum zu erhalten bzw. wiederzuerlangen. Andererseits ist gerade auch die weibliche Sozialisation dafür verantwortlich, dass Frauen Beziehungen eingehen, die sie in materiel- ler und emotionaler Abhängigkeit halten und damit bei Trennung auch Auslöser für Wohn- raumverlust sein können. Bei jungen Frauen können weibliche Sozialisationsbedingungen und traditionelle Rollenvorstellungen zur Familienflucht und Wohnungslosigkeit führen.
Verbindet sich ein Mangel an strukturellen Ressourcen (Armut, Gewalt) mit fehlendem sozialen Netzwerk und eingeschränkten persönlichen Ressourcen (Bewältigungsstrategien, Gesundheit, Belastbarkeit etc.), besteht „ein hohes Risiko für sozialen Abstieg und den Verlust der Wohnung“ (Steinert 1997a, 65).
2.5.2 Individuelle Faktoren
In diesem Kapitel möchte ich auf einige hier als individuelle Faktoren benannte Gründe bzw. Folgen von Wohnungslosigkeit bei Frauen zu sprechen kommen, obwohl mir bewusst ist, dass körperliche Krankheit, psychische Auffälligkeiten und Suchtverhalten in Wech- selwirkung mit strukturellen und sozialisationsbedingten Faktoren stehen. Ich nehme die- sen Aspekt hier mit auf, da in der Praxis Erkrankungen und psychische Auffälligkeiten bei wohnungslosen Frauen (und Männern) immer häufiger thematisiert werden und auf Ver- sorgungsprobleme bzw. Lücken im Hilfesystem hingewiesen wird (Enders-Dragässer et. al. 2001, 218ff; Schild 1999; Wessel 1996; BAG 2000c; Keil 2000; Rosenke 2001). Problematisch ist allerdings, dass die medizinische Datenlage zur Situation wohnungsloser Frauen sehr dünn ist, die Studien sind (fast) ausschließlich geschlechtsindifferent bzw. beziehen sich auf Männer oder es sind Erfahrungsberichte (Enders-Dragässer et. al. 2001, 218).
Die Lebensumstände wohnungsloser Frauen (und Männer) werden als krankheitsauslö- sende bzw. krankheitsfördernde Faktoren beschrieben: materielle Notlage, seelische Anspannung und Stress, mangelhaft Hygiene und Ernährung, Witterungseinflüsse sowie die situationsbedingte Blockierung der Wahrnehmung von Unwohlsein, Schmerzen und Erkrankung. Der generell schlechtere Gesundheitszustand Wohnungsloser im Verhältnis zur Allgemeinbevölkerung lässt sich belegen und äußert sich v. a. in Infektionskrankheiten, Erkrankungen der Atemwege, der Haut und chronischen Erkrankungen (Tuberkulose, Rheuma, Diabetes, AIDS) (Enders-Dragässer et. al. 2001, 218; BMFSFJ 2001, 509). In der einzigen (!) medizinische Untersuchung zur Situation wohnungsloser Frauen (Greifenha- gen/Fichter 1999) – eine psychiatrisch-epidemiologische Studie zu psychischen Erkran- kungen sichtbar wohnungsloser Frauen in München[22] – äußerten 97 % körperliche Be- schwerden. Eine Folge des schlechten Gesundheitszustandes und geringer medizinischer Versorgung ist die hohe Mortalität bei Wohnungslosen und das frühe Sterbealter, das je nach Untersuchung mit zwischen 47,6 und 63,3 Jahren angegeben wird (Trabert 2000, 65).
In der Studie von Greifenhagen/Fichter (1998) wird die Sechs-Monats-Prävalenz für psy- chische Krankheiten (inklusive Störungen des Substanzgebrauchs) mit über 90 % bei Frauen angegeben (Lebenszeitprävalenz 100 %), wobei bei ca. einem Drittel sogenannten Doppeldiagnosen, d. h. psychische Erkrankung und Substanzabhängigkeit, diagnostiziert wurde. In den letzten sechs Monaten wiesen 34 % schizophrene Störungen, 47 % affektive Störungen (v. a. Depression), 28 % Angststörungen (v. a. Panikstörungen) und 66 % Sub- stanzmissbrauch (davon 85 % Alkohol) auf. Auch wenn diese Befunde nicht generalisier- bar sind, so zeigen sich dennoch – die auch generell geltenden – geschlechtsspezifische Unterschiede zu wohnungslosen Männern, bei denen häufiger eine Störung des Alkohol- und Drogengebrauchs diagnostiziert wurde und seltener affektive Störungen sowie – unty- pischerweise – auch Schizophrenie (Kellinghaus et. al. 2000, 43).
Der Beginn der Suchterkrankung liegt zu 90 %, der affektiven Störungen zu 72 %, der Schizophrenie zu 50 % und der Angststörungen zu 38 % vor der Verlust der Wohnung, woraus gefolgert wird, dass Wohnungslosigkeit zumeist nicht der Auslöser der psychi- schen Erkrankung ist (Greifenhagen/Fichter 1998, 92ff). Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich Frauen in verdeckter Wohnungslosigkeit in der Regel nicht als wohnungslos sondern als wohnungssuchend verstehen (vgl. Kapitel 2.32), d. h. auf die Frage zum Beginn ihrer Wohnungslosigkeit ‚falsch‘ antworten. Damit beantwortet die Studie meiner Meinung nach nicht, ob für die untersuchte Teilgruppe der überwiegend obdachlosen Frauen tatsächlich gilt, dass sie zumeist bereits vor der Wohnungslosigkeit eine psychische Erkrankung vor- weisen. Es wird jedoch vermutet (Wessel 1996, 81), dass 30 % der Menschen in den Ein- richtungen der Wohnungslosenhilfe psychisch erkrankt sind.
Problematisch ist hierbei, dass hierbei schnell das Etikett ‚psychisch krank‘ den Frauen angeheftet wird und damit ‚die‘ Erklärung für Wohnungslosigkeit gefunden scheint, ähn- lich wie es früher durch die pathologisierende Bezeichnung ‚Nichtsesshaft‘ oder ‚sittlich verwahrlost‘ geschehen ist. Gewinnbringender sind hier feministische Ansätze, die ‚selt- same Verhaltensweisen‘ als Versuche verstehen, mit der Lebenssituation fertig zu werden und anhand der Möglichkeiten von wohnungslosen Frauen Vorschläge zu entwickeln ver- suchen, wie Sozialpädagoginnen mit diesen Klientinnen umgehen können (Sommer 2001; Ballhausen/Weismann 2001).
Unbestreitbar ist, dass es große Schnittstellenprobleme zwischen dem Hilfesystem der Wohnungslosigkeit, der Psychiatrie, der Suchthilfe, den Krankenhäusern und Frauenhäu- sern gibt, in denen wohnungslose Frauen (und Männer) oft genug ‚durchfallen‘ bzw. niedrigschwellige Angebote der Wohnungslosenhilfe als Auffangstruktur für schwer in das Hilfesystem integrierbare Menschen dienen (vgl. Wessel 1996; Schild 1999; BAG 2000; BMFSFJ 2001, Rosenke 2001).
2.6 Anknüpfungspunkte für die empirische Untersuchung
Als soziales Problem wurde die Wohnungslosigkeit von Frauen erst Ende der 1980er Jahre zur Kenntnis genommen. Das Angebot des Hilfesystems für wohnungslose Frauen ist seit- dem ausgebaut worden. Dennoch ist das frauenspezifische Wohnungslosenhilfesystem immer noch unzureichenden.
Im Zuge der Reformen des Sozialgesetzbuchs und insbesondere die neue Reform der VO zu § 72 BSHG beendeten die diskriminierende Typisierung der Personengruppen der Wohnungslosen und thematisiert zum ersten Mal auch weibliche Lebensverhältnisse. Eine defizitorientierte Problemzuschreibung auf die von Wohnungslosigkeit Betroffenen ist der rechtlichen Definition jedoch inhärent. Die Versorgung mit mietrechtlich abgesicherten Wohnraum (BAG 1997) definiert das Problem der Wohnungslosigkeit als ein gesellschaft- liches.
Die geschätzte Anzahl der Wohnungslosen war in den letzten Jahren rückläufig, wobei die Situation in den Großstädten sich aktuell verschärft hat. Der Frauenanteil liegt ca. bei ei- nem Viertel aller Wohnungslosen und ist in den letzten Jahren gestiegen. Wohnungslose Frauen sind durchschnittlich wesentlich jünger als Männer, ein hoher Anteil (ca. ein Drit- tel) ist unter 30 Jahren. Zumeist sind sie nicht alleinstehend, sondern leben mit Partnern und/oder Kindern zusammen.
Vor allem die verdeckt gelebte Wohnungslosigkeit ist für Frauen typisch. Aufgrund der weiblichen Sozialisation der Häuslichkeit und Reproduktionsarbeit sowie gesellschaftli- cher Stigmatisierung versuchen Frauen ihre Wohnungslosigkeit möglichst lange zu verber- gen, weshalb sie oft eine lange Karriere in mietrechtlich ungesicherten Verhältnissen hinter sich haben, bis sie Kontakt zum Hilfesystem aufnehmen. Kennzeichen quasi aller woh- nungsloser Frauen sind Armut und Gewalterfahrung. Ein Leben in Wohnungslosigkeit bedeutet darüber hinaus häufig Krankheit, Suchtverhalten oder psychische Beschwerden bzw. Krankheiten.
Viele Analysen und Beschreibungen konzentrieren sich darauf, Ursachen oder Problemdi- mensionen von Wohnungslosigkeit herauszuarbeiten, so dass dadurch häufig ein defizitä- res Bild von wohnungslosen Menschen entsteht. Die Erforschung von Gründen und Ursa- chen für die Wohnungslosigkeit zeigt dennoch kein klares Bild – strukturelle, soziale und individuelle Faktoren stehen in Wechselwirkung untereinander und können fördernde oder hindernde Wirkung haben. Eine genauere Ausformulierung steht hier noch aus.
Die Thematisierung des Selbstbildes wohnungsloser Frauen vertieft das Verständnis ihrer Lebenslage und kann den Defizitblickwinkel aufweichen. In der Typologie wohnungsloser Frauen wird deutlich, dass soziale Orientierungen Ausdruck einer subjektiv praktizierten Normalität sind. Sie weisen auf Handlungspotenziale hin, die den wohnungslosen Frauen zur Verfügung stehen. Von einer ‚Normalbiografie‘ abweichende Orientierungen sind un- ter diesem Blickwinkel Ausdruck einer sozialen Identität, die sich aus den sozialstrukturel- len, sozialen und persönlichen Ressourcen der wohnungslosen Frauen speist (Gei- ger/Steinert 1997, 18, 195ff). In diesem Sinne sind all diese Orientierungen kein individu- elles Defizit, das die Soziale Arbeit beheben soll. Frauen, die sich einer ‚Normalisierung‘ bzw. Pädagogisierung, die vom Hilfesystem in vielen Fällen verlangt wird, sperren, er- scheinen jedoch schnell defizitär.
3 Münchner Wohnungslosenpolitik
Die Situation wohnungsloser Frauen ist stark davon abhängig, welche Möglichkeiten der lokale Raum in Bezug auf das Wohnungslosenhilfesystem und auch in Bezug auf den Wohnungsmarkt bietet. Begrenzungen und Handlungsspielräume wohnungsloser Frauen sind insbesondere von diesen beiden lokalen Faktoren abhängig. Inhalt dieses Kapitels ist daher einerseits eine kurze Analyse der problematischen Unterbringungssituation für Wohnungslose in München sowie eine kurze Beschreibung der sich verschärfenden Situa- tion auf dem Wohnungsmarkt (Kapitel 3.2). Eine Bewertung der daraus entstandenen neu- en Konzepte in der Münchner Wohnungslosenpolitik findet sich in Kapitel 3.3. Zuvor wird jedoch auf den Beginn der frauenspezifischen Wohnungslosenhilfe in München eingegan- gen und das Konzept kurz vorgestellt (Kapitel 3.1).
3.1 Frauenspezifische Wohnungslosenhilfe
Am 23. Februar 1995 beschloss der Sozialhilfeausschuss der Landeshauptstadt München im „Konzept zur Hilfe für alleinstehende wohnungslose Frauen“ einstimmig, eine zentrale Notunterkunft für Frauen einzurichten (Sozialreferat der LHM 1995). Vorangegangen war eine Debatte in der Fachöffentlichkeit über die Situation von alleinstehenden wohnungslo- sen Frauen und Männern und das Hilfesystem in München, die durch verschiedene Unter- suchungen ausgelöst wurde (Brenner/Romaus 1990; GFS 1995). Die Analysen zeigten das Ausmaß der Wohnungslosigkeit, vor allem auch der verdeckten Wohnungslosigkeit, von Frauen in München. Außerdem wurde ein Ansteigen der weiblichen Wohnungslosigkeit in München festgestellt. Die Anzahl der Besucherinnen der ambulanten Anlaufstelle für wohnungslose Frauen (Einrichtung ‚Frauenteestube‘) war in den vorhergehenden Jahren stark angestiegen und es waren mehr Frauen in Pensionen und kommerziellen Wohnhei- men untergebracht (Karla 51 1997, 3; Brenner/Romaus 1990). Am 2. Dezember 1996 wur- de schließlich die erste frauenspezifische Notunterkunft, die Einrichtung Frauenobdach Karla 51, eröffnet. Das Haus, zentral gelegen in der Innenstadt in der Nähe des Haupt- bahnhofs, verfügt über 38 Einzelzimmer mit Nasszelle und zwei Doppelzimmer, die der Notaufnahme dienen.
Das Frauenobdach Karla 51 ist die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für woh- nungslose Frauen mit ihren Kindern in München. Zielsetzung ist, eine Verbesserung der Lebens- und Wohnverhältnisse für die Frauen zu erreichen. Jede Frau, die sich in einer existenziellen und/oder psychosozialen Notlage befindet, kann aufgenommen werden. Ne- ben der Sofortaufnahme, die rund um die Uhr möglich ist, bietet die Einrichtung die Si- cherstellung materieller Grundbedürfnisse (Kleidung, Nahrung, Körperpflege), einen offe- nen Cafébetrieb, ärztliche Beratung und Erstversorgung sowie persönliche Beratung und Unterstützung im Umgang mit Behörden, Arbeitgebern, Vermietern etc. Als Clearingstelle hat die Karla 51 außerdem die wesentliche Aufgabe, die Frauen und Kinder an andere Be- ratungsstellen, Einrichtungen und in Wohnungen zu vermitteln. Innerhalb eines Monats werden durchschnittlich 30 Frauen aufgenommen. Das Café als Plattform für Kommunika- tion und Interaktion wird von bis zu 50 Frauen täglich besucht. Wohnungslosigkeit, Armut, Gewalterfahrung, Suchtprobleme und psychische Erkrankungen sind extreme Belastungen, denen die Frauen, die in Karla 51 Schutz suchen, ausgesetzt sind (Karla 51 1997, 1998). Die Einrichtung Karla 51 bietet den notwendigen Schutz vor Übergriffen. Außerdem kön- nen auch Frauen in latenter oder verdeckter Wohnungslosigkeit aufgenommen werden.
Die Analyse der Wohnform vor Aufnahme in die Karla 51 (Abbildung 1 in Anhang 2) veranschaulicht eindrücklich, dass Gewalt durch den Partner ein hohes Risiko für Frauen darstellt, wohnungslos zu werden: 21 % der aufgenommenen Frauen verlassen die Ehe- wohnung, weil die Bedrohung, die Gewalt und der psychische Terror nicht länger zu ertra- gen sind. Dass 29 % der Frauen zuletzt bei Bekannten waren, belegt die hohe Zahl ver- deckt wohnungsloser Frauen, die jederzeit den Notbehelf verlieren können und dann von einem Tag auf den anderen auf der Straße stehen. 10 % der Frauen waren zuletzt in Pensi- onen untergebracht. Dass diese Frauen in der Karla 51 um Aufnahme nachfragen, hat in der Regel mit den unzumutbaren Bedingungen in den von der Stadt München zur Verfü- gung gestellten Notunterkünften zu tun: Mehrbettzimmer, fehlende abschließbare Schrän- ke, fehlende Kochgelegenheiten und Gemeinschaftsduschen und -toiletten stellen für viele Frauen eine nicht zu ertragende Belastung dar. Diese Unterkünfte nehmen sowohl Frauen als auch Männer auf, viele Frauen fühlen sich dadurch bedroht. Manche in der Karla 51 aufgenommenen Frauen berichten, dass sie durch Männer des Wachdienstes in den Unter- künften belästigt worden seien. Bei den 8 %, die zuletzt bei ihrer Herkunftsfamilie gelebt haben, handelt es sich um junge Frauen, die aufgrund erheblicher Konflikte oder auch kör- perlicher und/oder psychischer Gewalt nicht länger dort leben wollten. Immerhin 8 % der Frauen haben tatsächlich zuvor auf der Straße gelebt. Diese Beschreibung der Klientinnen der Karla 51 deckt sich mit den Ergebnissen anderer Studien zu wohnungslosen Frauen (vgl. Kapitel 2).
Die Niederschwelligkeit ist eine tragende Säule des Konzeptes der Karla 51, bei dem jede Frau aufgenommen wird, ohne eine Bedingung erfüllen oder eine Vorleistung erbringen zu müssen. Es gibt keine Aufnahmebedingungen oder Ausschlusskriterien außer akuter Selbst- oder Fremdgefährdung. Damit sind beispielsweise Alkohol- und Drogenabhängig- keit oder psychische Erkrankung keine Ausschlusskriterien. Auch mit diesem Prinzip wird die Einrichtung ihrem Charakter als Notunterkunft gerecht. Die Arbeitsweise in der Kar- la 51 umfasst Krisenintervention und Einzelfallberatung und basiert auf Freiwilligkeit, wobei es sich ausdrücklich um ein Angebot, nicht um eine Verpflichtung handelt. In der Karla 51 verbinden sich die sozialarbeiterischen Elemente der klassischen Fürsorge mit beratender Tätigkeit, wobei mit weiblich parteilicher Einzelfallberatung gearbeitet wird. Neben dem Hauptaspekt der Wohnungslosigkeit versuchen die Beraterinnen in einem ganzheitlichen Ansatz andere oft ebenso drängende Problembereiche mit einzubeziehen, beispielsweise gesundheitliche Aspekte (offene Beine, Hörgerät u. a.), Sicherung von Ein- kommen (Sozialhilfe, Unterhaltszahlungen etc.) sowie die finanzielle Situation (Schulden, ‚Mietunfähigkeit’), psychosoziale Probleme (Trennung/Scheidung, Therapie, Sucht u. a.). Wesentlich ist dabei die Förderung der Selbsthilfekräfte der Frauen und ihre Motivation zu einer selbstbestimmten Lebensweise (Karla 51 1997, 3ff). Da Frauen ausgeprägte Bezie- hungs- und Selbstversorgungsbedürfnisse haben, knüpft das Konzept durch die Selbstver- sorgung an den Ressourcen der Frauen an und erlaubt durch die Einzelzimmer Intimität und Rückzugsmöglichkeiten ebenso wie Kontaktaufnahme und Austausch in den Stock- werksküchen und im Café. Karla 51 ist ein Frauenraum, in dem Frauen es lernen können, sich neu aufeinander zu beziehen.
Das Hilfesystem, das sich an wohnungslose Frauen richtet, soll die folgenden wesentlichen Anforderungen erfüllen (Enders-Dragässer et. al. 2000, 187ff; Sellach 1998, 59ff), die sich aus den spezifischen weiblichen Lebensumständen und Formen der Wohnungslosigkeit von Frauen ableiten. Die Beratungsstellen müssen niedrigschwellig arbeiten, damit Frauen nicht erst ein Hilfeangebot wahrnehmen, wenn die Wohnung bereits verloren wurde, son- dern bereits dann, wenn es noch Möglichkeiten gibt, den Wohnungsverlust abzuwenden. Das Hilfesystem muss den Schutz vor Gewalt und Übergriffen von Männern und die Wah- rung der Intimsphäre (Einzelzimmer) gewährleisten. Da wohnungslose Frauen oft Kinder haben, muss eine gemeinsame Unterbringung mit ihren Kindern möglich sein. Das Hilfe- system soll an die Selbstversorgungskompetenzen wohnungsloser Frauen anknüpfen (Koch-, Waschgelegenheiten etc.). Die Beratungsstellen müssen über qualifizierte Mitar- beiterinnen verfügen, die mit den spezifischen Gründen für die Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot von Frauen vertraut sind. Diesen Anforderungen wird die Frauennotunter- kunft Karla 51 durch ihr Konzept gerecht.
3.2 Die Krisensituation im Jahr 2000/2001
Die schon länger problematische Situation auf dem Münchner Wohnungsmarkt spitzte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2000 nochmals zu. Die Zahl wohnungsloser Menschen stieg stark an. Zeitungen titelten mit „Wohnungslose: Die Situation wird immer dramati- scher“ (SZ 11.10.00) oder „Hier ist Katastrophengebiet“ (SZ 12.10.00) und bezogen sich damit auf die Überfüllung von Notunterkünften für Wohnungslose. Es mussten Container- anlagen – i. d. R. ehemalige Flüchtlingsunterkünfte[23] – für eine Notunterbringung Woh- nungsloser bereitgestellt werden, da die Kapazitäten von Übernachtungsheimen und Pensi- onszimmern erschöpft waren.
Für die plötzliche Zunahme wohnungsloser Menschen werden mehrere Faktoren ver- antwortlich gemacht, die sich gegenseitig verstärken. Der Bestand an preiswertem Wohn- raum[24] ist in diesem Zeitraum stark zurückgegangen. Die Neubauraten im öffentlich geför- derten Mietwohnungsbau sind gesunken. Der Bestand an Sozialwohnungen[25] ist in den letzten Jahren stark geschrumpft. Außerdem waren 1999 erstmals Wanderungsgewinne seit Anfang der 1990er Jahre zu verzeichnen. Als Folge dieser drastischen Verknappung von günstigem Wohnraum hat die Zahl der Menschen in akuter Wohnungslosigkeit um ca.
10 % im Jahr 2000 zugenommen. Gleichzeitig reduzierte die Stadt München die Kapazität der Pensionsunterbringung durch Schließung von unzumutbaren Häusern (Sozialreferat der LHM 2001a, 3f). Auf den dadurch entstehenden Engpass bei der Unterbringung von woh- nungslosen Menschen reagierte die Landeshauptstadt München mit der Eröffnung von Containeranlagen als Notunterkünften.
Aufgrund des Anstiegs der Wohnungslosigkeit waren laut amtlicher Statistik Ende des Jahres 2001 in München rd. 8.000 Menschen wohnungslos, von denen ca. die Hälfte zu den akut Wohnungslosen zählen. Das sind diejenigen, die in einer vorübergehenden Unter- kunft untergebracht sind: Sie leben entweder in Pensionen, Clearinghäusern oder den neu errichteten Notunterkünften (2.500), auf der Straße (ca. 600)[26] oder im Hilfesystem (800). Die anderen rd. 4.000 Wohnungslosen haben längerfristige bzw. dauerhafte Unterbrin- gungsmöglichkeiten im Hilfesystem oder in städtischen Unterkünften gefunden (Sozialre- ferat der LHM 2002b, 31).
Die Verknappung von günstigem Wohnraum hat auch Auswirkungen auf Menschen mit geringeren Einkünften. Das Wohnungsamt der Landeshauptstadt München hatte in den Jahren von 1995 bis inklusive 2000 eine relativ konstante Anzahl von Vormerkungen für eine Sozialwohnung von ca. 10.000 Haushalten, wobei ca. die Hälfte die Dringlichkeitsstu- fe 1 hatte, was i. d. R. auf wohnungslose Menschen zutrifft[27]. Im Jahr 2001 stieg aufgrund der Verschärfung am Wohnungsmarkt die Anzahl der Vormerkungen um 25 % auf über 12.000 Haushalte. Im selben Zeitraum nahm jedoch die Zahl der Wohnungsvergaben über das Wohnungsamt um 22,5 % ab und betrug im Jahr 2001 nur noch 3.849 Wohnungen (Sozialreferat der LHM 2002b, Anlage 4, 5). Das bedeutet, dass 40 % der Menschen mit einer Dringlichkeitsstufe 1 keine absehbare Chance auf eine Sozialwohnung haben. Die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit FAST im Wohnungsamt kommt zu dem Schluss, „dass sich dieser Rückgang [der Vermittlung von Wohnungen] auf derzeit unbestimmte Zeit festsetzt, weil die Konkurrenz auf dem freien Markt die Chancen des Klientel der Fachstelle zunehmend verschlechtert“ (Sozialreferat der LHM 2001a, 5), d. h., für Wohnungslose hat sich die Möglichkeit, eine Sozialwohnung zu bekommen, drastisch verschlechtert, und auf dem freien Wohnungsmarkt haben sie fast keine Chance.
Diese sich kontinuierlich verschärfende Krisensituation hatte deutliche Folgen die Arbeit in der Karla 51 und für den Charakter der Notunterkunft. Mit Beginn der Krise auf dem Wohnungsmarkt wurde es zunehmend schwieriger, Wohn- bzw. Unterbringungsplätze innerhalb der formal vorgeschriebenen Frist von vier Wochen zu finden (Karla 51 1997, 8). Konnten im Jahr 1999 noch 121 Frauen in eine eigene Wohnung vermittelt werden, so waren es im Jahr 2000 nur noch 43 und ein Jahr später sogar nur noch 28 Frauen (Karla 51 1999, 2000, 2001 Anhang). Das ist ein Rückgang von über 75 % innerhalb von nur zwei Jahren. Die Wartezeiten für eine Sozialwohnung machen eine schnelle Weitervermittlung beinah unmöglich. Im Jahr 2000 konnte es passieren, dass eine Bewohnerin bis zu drei Monate warten musste, bis sie überhaupt in die notwendige Dringlichkeitsstufe für eine Sozialwohnung eingestuft wurde, und es dauerte oft länger als ein halbes Jahr, bis sie eine erste Benennung[28] erhielt. Damit war die Perspektive eines baldigen Umzugs in eine eige- ne Wohnung nicht mehr vorhanden. Darüber hinaus war die Fluktuation bei betreuten, län- gerfristigen Einrichtungen[29] so gering, dass oft mehrmonatige Wartezeiten entstanden. Aufgrund dessen blieben bereits in der Zeit der Anbahnung der Krise während des Jahres i. d. R. Anrecht auf eine Sozialwohnung. Notwendig ist jedoch, dass die/der Wohnungslose seit mindestens fünf Jahren in München gemeldet ist, um einen Sozialwohnungsantrag stellen zu können (in seltenen Fällen sind Ausnahmen möglich). Problematisch ist dies vor allem bei Menschen, die wieder nach München zu- rückziehen möchten. Ist einE WohnungsloseR weniger als fünf Jahre in München gemeldet, muss sie/er sich eine Wohnung auf dem freien Markt suchen, bekommt aber vom Wohnungsamt eine Übernahme der Kauti- ons- und Provisionskosten bis zu einer festgesetzten Höhe.
2000 viele Bewohnerinnen mehrere Monate, ein halbes Jahr oder sogar noch länger im Frauenobdach Karla 51.
Der Wohnungsnotstand und der ‚Rückstau‘ bei betreuten Einrichtungen führten dazu, dass sich die Aufenthaltsdauer in der Karla 51 stetig verlängerte (Karla 51 2000, 14), sich die Notaufnahmestelle also zunehmend in ein Wohnheim verwandelte[30] und – in einer Zeit steigender Anfragen – immer häufiger wohnungslose Frauen nicht nur einige Tage, son- dern oft länger auf eine Platz in der Notunterkunft Karla 51 warten mussten. Als Konse- quenz beschloss das Team der Karla 51 im Sommer 2000, sich möglichst ausnahmslos an die Vier-Wochen-Aufenthaltsfrist zu halten, um den Status als Notunterkunft zu erhalten (Karla 51 2000, 14). Dieser Beschluss bedeutete allerdings auch, dass darauf verzichtet wurde, für alle Frauen einen adäquaten Weg aus der Wohnungslosigkeit zu finden, da da- durch mehr Frauen in eine Pension oder andere Notunterkünfte vermittelt wurden (vgl. auch Abbildung 2 in Anhang 2), was eigentlich eine Ausnahme darstellen sollte. In dieser Situation führte ich meine erste Befragung mit Bewohnerinnen der Karla 51 durch (vgl. ausführlich Kapitel 4).
Dies ist ein deutliches Beispiel dafür, dass sinnvolle Konzepte und notwendige Aufgaben einer sozialen Einrichtung aufgrund von gesellschaftlichen Gegebenheiten nicht einlösbar sind. Kurzfristig bleibt für die Soziale Arbeit dann nur die Wahl zwischen zwei Übeln, was die konkrete Arbeit unbefriedigend macht. Denn schließlich kann auf diese Weise keine Lösung für ein Problem geboten werden, das auf einer vollkommen anderen – nämlich politischen – Ebene behandelt werden müsste.
[...]
[1] Größtes städtisches Übernachtungsheim in der Pilgersheimer Straße.
[2] Im Gegenzug dazu bezeichnet ‚obdachlos‘ in der Fachsprache nur diejenigen wohnungslosen Personen, die auf der Straße nächtigen, ‚Platte machen‘ (vgl. Specht-Killer 2000, 93).
[3] Beispielsweise hat sich 1993 die Fachzeitschrift „Gefährdetenhilfe“ in „wohnungslos“ umbenannt.
[4] Sogenannte Gefährdete wurden bis zur Reform des BSHG im Jahr 1974 als Personen definiert, die „aus Mangel an innerer Festigkeit ein geordnetes Leben in der Gemeinschaft nicht führen können“ (BSHG 1974
§72 Abs.1). Solches Gedankengut ist auf die im Nationalsozialismus geschaffene Orientierung rückführbar, wo eine „umfassende reichsrechtliche Regelung des gesamten Wanderwesens“ erreicht werden sollte. Die Vermischung sozialer Aburteilung und psychiatrischer Diagnosen von Obdachlosen („unstete Psychopa- then“, „angeborene Abnormität der Persönlichkeit“, „wandernde Bazillenherde“) hat im Nationalsozialismus mit zur Verfolgung wohnungsloser Menschen beigetragen (Greifenhaben, Fichter 1998, 89f; Roscher 2001, 45).
[5] Die dritte im Kontext von Wohnungslosigkeit häufig zitierte Definition, der 1987 vom Deutschen Städte- tags etablierte Begriff ‚Wohnungsnotfälle‘, spielt im Kontext dieser Arbeit keine Rolle, da er sich stark an ordnungs-, förderungs- und bauaufsichtsrechtlichen Kriterien orientiert und daher eher im Zusammenhang mit einer gesellschaftspolitischen Diskussion über Wohnen allgemein geeignet erscheint (vgl. Riege1994, 11ff; König 1998, 17ff). Beispielsweise gehören in die Gruppe der Wohnungsnotfälle Menschen, die in un- zumutbaren Wohnverhältnissen aufgrund von schweren baulichen und hygienischen Mängeln leben, in Woh- nungen, die überbelegt sind oder die mehr als 40 % des Einkommens für Wohnkosten aufbringen müssen. Nach Schätzungen sind dies ca. 5 % der Gesamtbevölkerung (Rosenke 1996, 77), die überwiegende Anzahl davon ist weiblich (Rosenke 1995, 63).
[6] Zum weiteren Personenkreis gehören v. a. noch § 5 VO aus „Freiheitsentziehung Entlassene“ und § 6 VO zu § 72 BSHG „verhaltensgestörte junge Menschen“, was immer wieder zu Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen BSHG und KJHG geführt hat (vgl. Roscher 2001, 48).
[7] Davon kann es jedoch Abweichungen geben, denn je nach Bundesland sind die Zuständigkeiten zwischen dem örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger unterschiedliche geregelt (Brähler-Boyan 1998, 67).
[8] Zu den weiteren Veränderungen vgl. Roscher 2001, Holtmannspötter 2000, Brühl 2002.
[9] Brühl sieht in seiner Rechtsexpertise zur VO § 72 BSHG „durchaus positive Anstöße für die Arbeit mit Frauen“ (2002, 45), die sich u. a. auch dadurch ableiten, dass laut Gesetz „bei der Hilfe ... geschlechts- und altersbedingte Besonderheiten ... zu berücksichtigen“ sind.
[10] Genauere Ausführungen über die Methodik der Schätzung der BAG bei Specht-Kittler (2000), Kritik an dem Verfahren der BAG bei König (1998, 54ff).
[11] Die Zahl der Menschen nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, die trotz besonderer sozialer Schwierigkeiten das Hilfesystem nicht aufsuchen, dürfte ein Mehrfaches betragen, da besondere ausländerrechtliche und auch kulturelle Probleme im Zugang zum Hilfesystem bestehen (BAG 1999). Zu diesem Thema gibt es bislang kaum Untersuchungen und auch nur wenige Praxisberichte, weshalb die Situation nicht deutscher wohnungs- loser Frauen in der vorliegenden Arbeit nicht gesondert thematisiert werden kann.
[12] In vielen Fällen zeigen sich gerade in Notunterkünften und Pensionen Praktiken, die zu einem würdelosen Alltagsleben von Obdachlosen beitragen, z. B. indem in einem Drittel die BewohnerInnen tagsüber das Haus verlassen müssen, die Aufenthaltsdauer rechtswidrig auf einige Tage begrenzt wird oder indem die Ausstat- tungsstandards die Grundbedürfnisse nach Hygiene, selbstbestimmter Ernährung (23 % keine Kochmöglich- keit) und Privatheit (nur ca. 30 % Einzelzimmer) nicht gewährleisten (Rosenke 1999, 127f).
[13] ‚Frauenspezifisches Angebot‘ meint in diesem Zusammenhang insbesondere die Gewährung von Frauen- räumen und weibliche Beraterinnen. Inwieweit die weiteren Kriterien feministischer Sozialer Arbeit (vgl. Freytag 1992, Tatschmurat 1996), die sich auch in den Qualitätsstandards der Wohnungslosenhilfe für Frau- en wiederfinden (Sellach 1998), in den einzelnen Einrichtungen umgesetzt sind, kann ich nicht beurteilen.
[14] Das DAW-System ist das Dokumentationssystem zur Wohnungslosigkeit der BAG Wohnungslosenhilfe für die Gruppe der wohnungslosen Einpersonenhaushalte im sozialhilferechtlichen Sektor, d. h. dokumentiert werden hier wohnungslose Menschen, die in eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe nach § 72 BSHG aufgenommen wurden und die am Dokumentationssystem teilnimmt. Dokumentiert wird also ein bestimmter Ausschnitt der Wohnungslosen. Aufgrund von fehlender Finanzierung hat die BAG ihr Dokumentationssys- tem 1999 eingestellt.
[15] Aufgrund der weiblichen Erscheinungsweise von Wohnungsnot (vgl. Kapitel 2.32) ist von einer hohen Dunkelziffer wohnungsloser Frauen auszugehen (Rosenke 1995, 63).
[17] Das neue Gewaltschutzgesetz eröffnet hierbei neue Möglichkeiten für Frauen bei Gewalt in der Ehe.
[18] Bei dem Projekt handelt es sich um einen Forschungsauftrag für das Bundesministerium für Jugend, Fami- lie, Frauen und Gesundheit. Ziel war es eine Quantifizierung des Problems der weiblichen Wohnungsnot vorzunehmen sowie den Umgang der Betroffenen mit ihrer Wohnungslosigkeit und dem Hilfesystem zu beschreiben (Geiger/Steinert 1997, 9ff; Steinert 2000, 185).
[19] An dieser Stelle möchte ich gesondert darauf hinweisen, dass ‚Normalitätsorientierung‘ in dieser Arbeit eine Ausrichtung an zentralen bürgerlichen Lebensweisen bedeutet und nicht eine bewertende Kategorie darstellt. Da ‚normal‘ immer auch sein Gegenstück ‚nicht-normal‘ impliziert, das gesellschaftlich negativ bewertet und oft ausgrenzend und abwertend gebraucht wird, bin ich mit der Begriffsvergabe von Steinert nicht zufrieden. Eine Umbenennung wie beispielsweise in ‚Bürgerlichkeitsorientierung‘ ist jedoch nicht so prägnant und leicht verständlich, so dass ich auf eine Begriffsneuschöpfung verzichtet habe.
[20] In diesem Sinne könnten auch Frauenhäuser zum Hilfesystem der Wohnungslosigkeit gezählt werden, was jedoch u. a. aufgrund anderer Konzepte und Finanzierung (i. d. R. nicht über § 72 BSHG) nicht geschieht. Frauenhäuser nehmen zumeist auch keine Frauen auf, für die andere Probleme als Gewalt im Vordergrund stehen „wie Wohnungslosigkeit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch oder eine psychische Erkrankung“ (Ro- senke 2001, 8). In der Praxis des Wohnungslosenhilfesystems bedeutet dies, dass Frauen trotz massiver Ge- walterfahrung oft nicht in ein Frauenhaus weitervermittelt werden können. Die Frauen, die Zuflucht in einem Frauenhaus finden, sind jedoch faktisch wohnungslos und werden auch in der Definition der Wohnungslo- sigkeit der BAG dazu gezählt (vgl. Kapitel 2.12). Das Verhältnis ist jedoch ambivalent und erst neuere Be- strebungen versuchen eine stärkere Verknüpfung des Hilfesystems der Wohnungslosigkeit und der Frauen- hausbewegung (vgl. Rosenke 2001).
[21] Problematisch an dieser Interpretation erscheint mir, dass, wenn sich Frauen ihrer weiblichen Rolle gemäß verhalten, also abhängig, selbstlos, passiv, schwach, unsicher, beziehungsorientiert etc. sind, diese Eigen- schaften als psychologisch ungesund für einen normalen Erwachsenen gelten (Vargo 1992, S. 33f), d. h. dieser Defizitblick unreflektiert in diese Erklärung von Wohnungslosigkeit bei Frauen eingeht. 64f) wird gerade die stärkere Bindungsorientierung von Frauen (vgl. Chodorow 1986) als eine soziale Ressource gesehen, die sie im Fall drohender Wohnungslosigkeit in Form von sozialen Netzwerken nutzen können (vgl. verdeckte Wohnungslosigkeit).
[22] Es wurden 32 Frauen mittels eines standardisierten Interviews von einer eigens geschulten Mitarbeiterin befragt, von denen 14 in Pensionen bzw. Obdachlosenunterkünften und 18 auf der Straße lebten. Die Ergeb- nisse dieser Studie können aufgrund der Stichprobe jedoch nicht auf alle wohnungslosen Frauen (vgl. Kapitel 2.3 zu den Erscheinungsweisen weiblicher Wohnungslosigkeit) übertragen werden.
[23] Die Unterbringung von Flüchtlingen in diesen Wohnanlagen fand im übrigen längst nicht so viel Aufmerk- samkeit in der Presse.
[24] Das Münchner Mietpreisniveau liegt im deutschen Städtevergleich an der Spitze, wobei der durchschnittli- che Mietpreis zwischen April 2000 und April 2001 um ca. 12 % pro Quadratmeter stieg, wodurch sich der Abstand zu anderen Städten weiter vergrößerte. Im April 2001 lag er um 70 % über dem Bundesdurchschnitt (Sozialreferat der LHM 2001b, 3, 7; eigene Berechnungen), ein halbes Jahr später (Oktober 2001) war der durchschnittliche Mietpreis nochmals um ca. 6 % gestiegen. Der Preis für Erstvermietungen mit mittlerem Wohnwert lag im Herbst 2001 bei durchschnittlich 11,25 € (22,00 DM) pro Quadratmeter Kaltmiete ohne Nebenkosten (Sozialreferat der LHM 2002b, 7, Anlage 1; eigene Berechnungen).
[25] Zwischen 1993 und dem Jahr 2000 ging der Bestand an Sozialwohnungen trotz Neubau um ca. ein Drittel zurück (Sozialreferat der LHM 2002b, Anlage 4, 6).
[26] Die tatsächliche Zahl dürfte deutlich höher liegen, denn sie beruht auf der letzten Zählung im September 1995 (Sozialreferat der LHM 2002b, Anlage 4, 2).
[27] Da wohnungslose Menschen zumeist nicht über Einkünfte über dem Sozialhilfeniveau verfügen (genaue Einkommensgrenzen für eine Sozialwohnung sind in § 25 Abs. 2 Wohnungsbaugesetz geregelt) haben sie
[28] Das Wohnungsamt ‚benennt‘ mehrere Personen als potentielle MieterInnen für eine Sozialwohnung, die entsprechende Wohnungsbaugesellschaft wählt aus ihnen eineN aus.
[29] Problematisch ist auch immer wieder, dass Konzepte von anderen Einrichtungen die oft von Mehrfach- problematik betroffenen Bewohnerinnen der Karla 51 ausschließen. So gab es z. B. für substituierte Frauen keine spezielle betreute Wohneinrichtung, Frauenhäuser nehmen keine Frauen mit einer Suchtproblematik auf und Altenwohnanlagen betreuen keine Frauen mit psychischen Erkrankungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der Wohnungslosigkeit von Frauen, insbesondere in Bezug auf München, Deutschland. Es untersucht Definitionen, Erscheinungsformen, Ursachen, soziale Orientierungsmuster und Bewältigungsstrategien wohnungsloser Frauen. Darüber hinaus werden die Münchner Wohnungslosenpolitik und der Empowerment-Ansatz in der Sozialen Arbeit mit wohnungslosen Frauen thematisiert.
Wie definiert das Dokument Wohnungslosigkeit?
Es werden zwei Hauptdefinitionen vorgestellt: die gesetzliche Definition nach § 72 BSHG (Bundessozialhilfegesetz) und die Definition der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W). Die BAG-Definition ist weiter gefasst und betrachtet Wohnungslosigkeit als das Fehlen eines mietvertraglich abgesicherten Wohnraums.
Welche Erscheinungsformen weiblicher Wohnungslosigkeit werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen sichtbarer, verdeckter und latenter Wohnungslosigkeit. Sichtbare Wohnungslosigkeit bezieht sich auf Frauen, die auf der Straße leben. Verdeckte Wohnungslosigkeit beschreibt Frauen, die bei FreundInnen/Bekannten unterkommen oder zweckorientierte Partnerschaften eingehen. Latente Wohnungslosigkeit betrifft Frauen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, z. B. aufgrund von prekären Wohnverhältnissen oder Gewalterfahrungen.
Welche Typen wohnungsloser Frauen werden beschrieben?
Es werden drei Grundkategorien vorgestellt: normalitätsorientierte, institutionenorientierte und alternativorientierte Typen. Normalitätsorientierte Typen streben normalisierte Wohn- und Arbeitsverhältnisse an. Institutionenorientierte Typen nehmen das Hilfesystem als relevante Ressource wahr. Alternativorientierte Typen orientieren sich an subkulturellen Werten und Normen und sind unabhängig vom Hilfesystem.
Welche Faktoren tragen zur Wohnungslosigkeit von Frauen bei?
Es werden strukturelle, soziale und individuelle Faktoren genannt. Strukturelle Faktoren umfassen Armut und einen geschlechtsspezifisch segmentierten Arbeitsmarkt. Soziale Faktoren beinhalten Veränderungen in Familienbeziehungen und Gewalterfahrungen. Individuelle Faktoren können körperliche Krankheit, psychische Auffälligkeiten und Suchtverhalten sein.
Wie sieht die Situation in München aus?
Das Dokument beschreibt die frauenspezifische Wohnungslosenhilfe in München, insbesondere die Notunterkunft Karla 51. Es wird auch die Krisensituation im Jahr 2000/2001 aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes thematisiert, die zu einer Zunahme wohnungsloser Menschen führte.
Was ist das Frauenobdach Karla 51?
Das Frauenobdach Karla 51 ist eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für wohnungslose Frauen mit ihren Kindern in München. Es bietet Sofortaufnahme, materielle Grundversorgung, Beratung und Unterstützung.
Welche Herausforderungen gibt es in der Münchner Wohnungslosenpolitik?
Eine große Herausforderung ist der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, was die Vermittlung von Wohnungslosen in geeignete Unterkünfte erschwert. Dies führt zu längeren Aufenthaltszeiten in Notunterkünften und einer Verschärfung der Wohnungslosigkeitsproblematik.
Welche Auswirkungen hat die Wohnungslosigkeit auf die Gesundheit von Frauen?
Die Lebensumstände wohnungsloser Frauen sind krankheitsauslösende bzw. krankheitsfördernde Faktoren. Sie leiden häufig unter Infektionskrankheiten, Erkrankungen der Atemwege, der Haut und chronischen Erkrankungen. Zudem sind psychische Erkrankungen und Suchtverhalten verbreitet.
Welche Rolle spielt der Empowerment-Ansatz in der Sozialen Arbeit mit wohnungslosen Frauen?
Der Empowerment-Ansatz wird als mögliche Grundlage für die Soziale Arbeit mit wohnungslosen Frauen diskutiert. Er zielt darauf ab, die Selbsthilfekräfte der Frauen zu fördern und sie zu einer selbstbestimmten Lebensweise zu motivieren.
- Citar trabajo
- Ruth Weizel (Autor), 2002, Wohnungslose Frauen, ihre sozialen Orientierungsmuster und Bewältigungsstrategien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110953