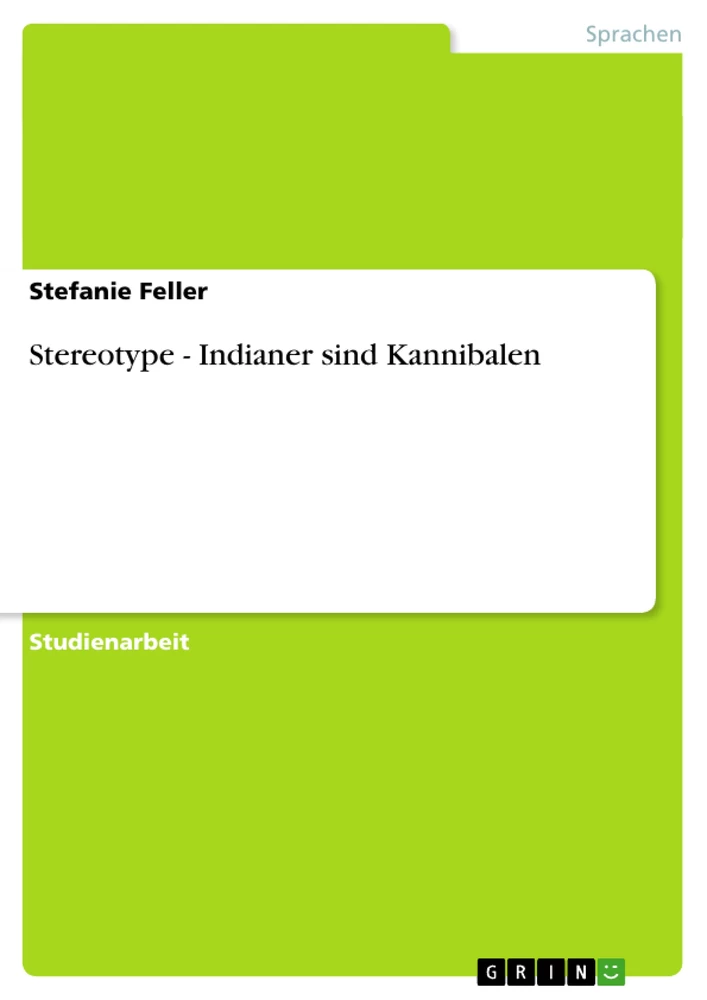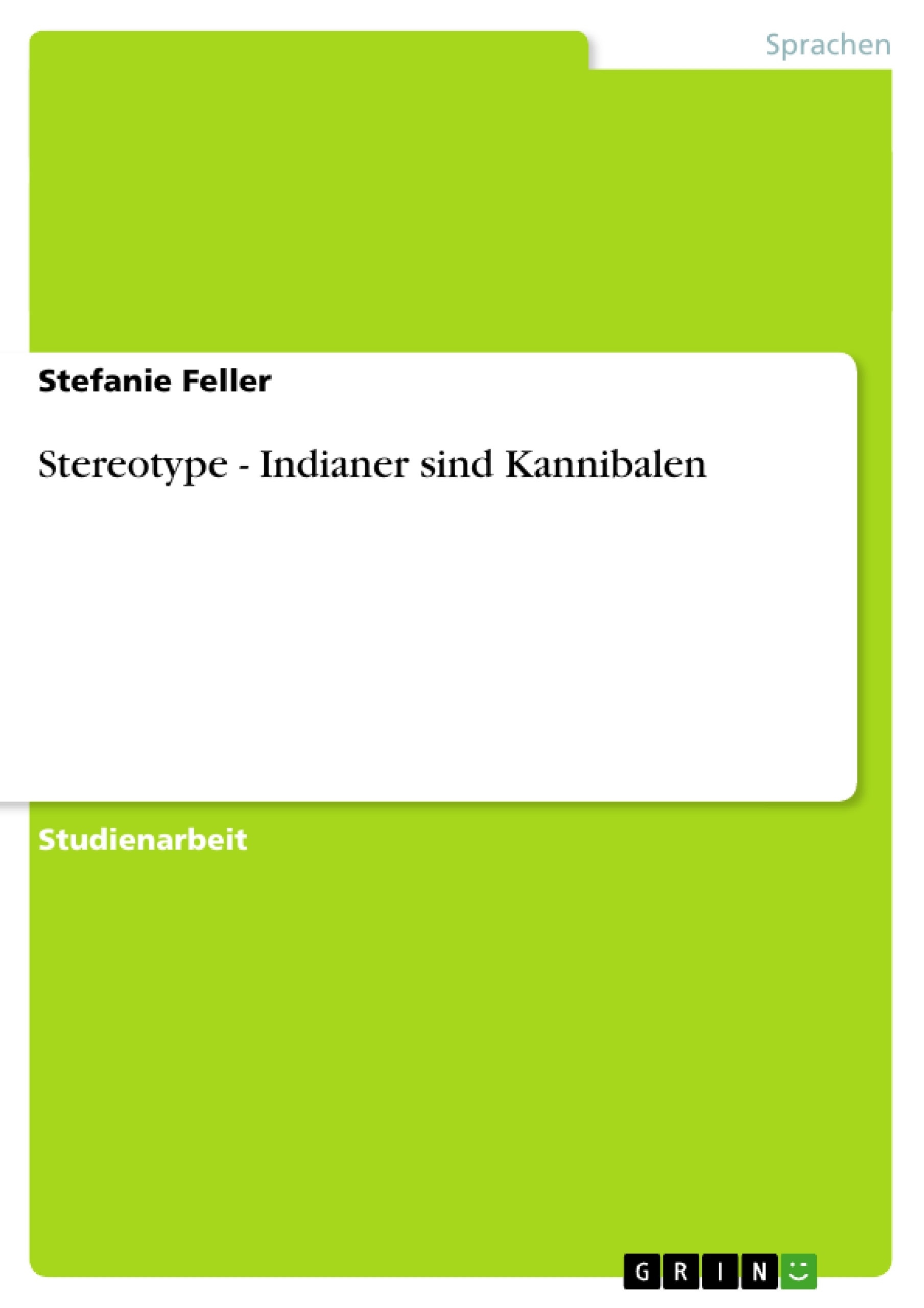Jeder von uns hat ein bestimmtes, zum Teil vorbestimmtes Bild der Welt. Teilweise sind diese Vorstellung durch eigene Erfahrungen geprägt worden, meistens jedoch werden sie, aus einem Mangel an selbst erlebtem, durch Stereotype ersetzt. Wobei diese Bilder immer in Abgrenzung zu uns selbst stehen, das heißt vor allen die Andersartigkeit des Unbekannten, in Bezug auf zu uns, in den Vordergrund stellen. Durch den Mangel an konkreten Wissen müssen diese Stereotype mit einem sehr begrenzten Umfang an Fakten auskommen, dies führt zu einer Idealisierung, im positiven wie im negativen Sinne.
Der Begriff Stereotyp (von griechisch σ τ ε ρ ε ό ς , stereós „fest, hart, haltbar, räumlich“ und τ ύ π ο ς , týpos „-artig“) tritt in verschiedenen Zusammenhängen mit unterschiedlicher Bedeutung auf. Allen Bedeutungen ist gemeinsam, dass ein bestimmtes gleich bleibendes oder häufig vorkommendes Muster bezeichnet werden soll, ähnlich der umgangssprachlichen Wendung „Schema F“. Ein Stereotyp kann als eine griffige Zusammenfassung von Eigenschaften oder Verhaltensweisen aufgefasst werden, die häufig einen hohen Wiedererkennungswert hat, dabei aber in aller Regel für sich genommen den gemeinten Sachverhalt sehr vereinfacht. Somit steht es in engem Bedeutungszusammenhang zum Klischee oder Vorurteil.[1]
Zu solchen Stereotypen gehört auch das Bild, welches wir von Indianern, Rothäuten oder, wie es treffender heißen sollte, der indigenen Bevölkerung (Latein-)Amerikas haben. Ich bin überzeugt, dass der Großteil der (deutschen) Bevölkerung noch nie einen Indianer gesehen, geschweige denn vielleicht sogar mit einem gesprochen hat. Aber dennoch meinen wir, uns ein zutreffendes Bild über ihn machen zu können. Er hat eine rote Haut, bemalt sich gerne mit Farbe (Kriegsbemalung), hat eine Vorliebe für federnen Kopfschmuck und (fr)isst auch schon mal Andere auf (Kannibalen).
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der erste Eindruck
1. Beschreibung durch Christoph Kolumbus
3. Sie sind alle Kannibalen!
1. Das Kannibalen-Bild des Amerigo Vespucci
2. Wie sahen deutsche Abenteurer die Kannibalen?
3. Nach den Vorstellungen, nun zur Realität des Kannibalismus
4. Die Rechtfertigung der Versklavung mit Hilfe des Kannibalismus-Topos'
1. Die theologisch-völkerrechtliche Debatte
5. Schlussbetrachtung
6. Quellen
Internet
Lexikas
1. Einleitung
Jeder von uns hat ein bestimmtes, zum Teil vorbestimmtes Bild der Welt. Teilweise sind diese Vorstellung durch eigene Erfahrungen geprägt worden, meistens jedoch werden sie, aus einem Mangel an selbst erlebtem, durch Stereotype ersetzt. Wobei diese Bilder immer in Abgrenzung zu uns selbst stehen, das heißt vor allen die Andersartigkeit des Unbekannten, in Bezug auf zu uns, in den Vordergrund stellen. Durch den Mangel an konkreten Wissen müssen diese Stereotype mit einem sehr begrenzten Umfang an Fakten auskommen, dies führt zu einer Idealisierung, im positiven wie im negativen Sinne.
Der Begriff Stereotyp (von griechisch στερεός, stereós „fest, hart, haltbar, räumlich“ und τύπος, týpos „-artig“) tritt in verschiedenen Zusammenhängen mit unterschiedlicher Bedeutung auf. Allen Bedeutungen ist gemeinsam, dass ein bestimmtes gleich bleibendes oder häufig vorkommendes Muster bezeichnet werden soll, ähnlich der umgangssprachlichen Wendung „Schema F“. Ein Stereotyp kann als eine griffige Zusammenfassung von Eigenschaften oder Verhaltensweisen aufgefasst werden, die häufig einen hohen Wiedererkennungswert hat, dabei aber in aller Regel für sich genommen den gemeinten Sachverhalt sehr vereinfacht. Somit steht es in engem Bedeutungszusammenhang zum Klischee oder Vorurteil.[1]
Zu solchen Stereotypen gehört auch das Bild, welches wir von Indianern, Rothäuten oder, wie es treffender heißen sollte, der indigenen Bevölkerung (Latein-)Amerikas haben. Ich bin überzeugt, dass der Großteil der (deutschen) Bevölkerung noch nie einen Indianer gesehen, geschweige denn viellei cht sogar mit einem gesprochen hat. Aber dennoch meinen wir, uns ein zutreffendes Bild über ihn machen zu können. Er hat eine rote Haut, bemalt sich gerne mit Farbe (Kriegsbemalung), hat eine Vorliebe für federnen Kopfschmuck und (fr)isst auch schon mal Andere auf (Kannibalen).
Diese Beschreibung würde, zumindest innerhalb Deutschlands, dazu führen, dass man wüsste das es sich hier um Indianer handeln soll, vielleicht hätte man sogar das Bild von Karl Mays Winnetou vor sich, dem Indianer per se. In (Latein-)Amerika herrschen aber noch ganz andere Bilder über Indigenen vor:
„Herr Subpräfekt, dieser Indio ist ein Dieb!“, „Dieser Tankayllu ist ein schmutziger Indio,...“[2] „... y un jíbaro, como los que se reunían en el muelle de El Idilio esperando por un resto de alcohol.“[3] Und obwohl uns sehr wohl bewusst ist, dass nicht jeder Indigene die hier beschrieben Eigenschaften hat und diese sich auch nicht ausschließlich auf Indigene beschränken, halten sie sich doch hartnäckig.
Von Kolumbus an, war ein Indianer zum Beispiel auch immer ein Kannibale. Wie dieser gängige Stereotyp entstand und sich, wider besseren Wissens, halten konnte, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
2. Der erste Eindruck
Die Herausbildung der, noch heute gängigsten, Stereotype begann bereits kurz nach der Landung Christoph Kolumbus' 1492 in der Karibik. Das Weltbild, des ausgehenden 15. Jahrhunderts, war geprägt von den Vorstellungen antiker Philosophen, wie Aristoteles und Ptolemäus, die besagten, die Erde sei das Zentrum um das sich alles dreht, sowie von den Lehren der Bibel. Hinzu kamen noch einzelne Reiseberichte, wie die Marco Polos oder die Reiseromane John Mandevilles, wobei die letztgenannten rein fiktiv waren. Das zu Erwartende, das Fremde in der Neuen Welt konnte also kaum mit dem damaligen Wissen begriffen oder auch nur erklärt werden.[4]
1. Beschreibung durch Christoph Kolumbus
Im August 1492 trat Kolumbus seine Reise nach Indien an. Dabei führte er, wie auch dann auf seinen weiteren Erkundungen, ein Bordbuch in dem er seine Eindrücke der Neuen Welt festhielt.
Nach gut zwei Monaten Fahrt stieß Kolumbus am 12.10.1492 auf Land, genauer gesagt auf die Insel Guanahaní, die heute zur Inselgruppe der heutigen Bahamas gehört. Auf der Weiterfahrt „entdeckte“ er auch Kuba und Hispaniola. Seine ersten Eindrücke von dem „neuen“ Land hält er durchaus positiv in seinen Bordbuch fest, vor allen seine Beschreibung der Menschen fällt dabei auf.[5] Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide más de una farto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de treinta años: muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y muy buenas caras;... [6]
Aus dem Zitat ist, meiner Meinung nach, ersichtlich wie fasziniert Kolumbus von seinen ersten Zusammentreffen mit den Indigenen war. Aber nicht nur von den Menschen berichtete er euphorisch, sondern auch von der exotischen Natur.
... que si las otras ya vista son muy fermosas y verdes y fértiles, ésta es muchos más y de grandes arboledos y muy verdes. Aquí unas grandes lagunas, y sobre ellas y a la rueda es el arboledo en maravilla, y aquí en toda la isla son todos verdes y la hierbas como en abril en el Andalucía; y el cantar de los pajaritos que parece que el hombre nunca se querría partir de aquí,... [7] Insgesamt scheint es, dass Kolumbus die (neu-)entdeckte Welt als einen locus amoenus[8] betrachtet. Im Laufe seiner vier Fahrten, ist er sich zunehmend sicherer das irdische Paradies entdeckt zu haben, wobei er sich auf seine religiösen Überzeugungen berufen konnte.[9]
Obwohl Kolumbus meinte das irdische Paradies gefunden zu haben, hinderte ihn das nicht daran, gemäß seinen christlichen Glauben, die Indios missionieren zu wollen.
... porque concocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza,... [10] Dabei erwähnte er auch den besonderen Gehorsam und die Tüchtigkeit, die einen guten Untertan für die spanische Krone auszeichneten.[11]
Zu seinen, zumindest auf seiner ersten Fahrt, positiven Bild, gesellte sich allerdings auch der Mythos der „menschenfressenden“ Kariben, woraus sich später der Stereotyp des Kannibalen entwickelte. Insgesamt lässt sich festhalten, das sein euphorisches Indio-Bild im Verlauf seiner Fahrten einen negative Gegenpol erhielt.
Aus der zunächst, zumindest vorurteilsfrei gedeuteten Nacktheit und Zurückhaltung, wird Schutzlosigkeit und Feigheit.[12] Dies dürfte daran liegen, dass sich im Verlaufe der Reisen herausstellte, dass es den vermuteten große Goldfund nicht geben würde und sich Columbus deshalb nach neuer „Ware“ umschauen musste, um seine Auftraggeber, die Reyes Católicos, nicht vollends zu enttäuschen. Diese neue „Ware“ stellten die Indigenen dar, die nun einen wirtschaftlichen Ertrag für die spanische Krone erbringen sollten und zwar nicht als freie Untertanen, sondern als Sklaven. Um eine mögliche Versklavung zu rechtfertigen, beschrieb Kolumbus zunehmend das Bildes des bösen, kannibalischen Indianers, der es nicht anders „verdient“ hatte, als versklavt zu werden.[13]
Dice más el Almirante; que en las islas pasadas estaban con gran temor de Carib, y en algunas le llamaban Caniba, pero en la Española Carib; y que debe de ser gente arriscada, pues andan por todas estas islas y comen la gente que pueden haber. [14]
So prägte Columbus, zwei der gängigsten Stereotype, zum einen, dass des im Naturzustand lebenden, guten und auf der anderen Seite, dass des schlechten Indios.
[...]
[1] aus Wikipedia, Stereotype
[2] aus Arguedas, S. 21 u. 45
[3] aus Sepulveda, 17
[4] vgl. Peters, 23
[5] vgl. ibid, 24
[6] aus „Diario de a bordo“; zit. nach Peters, 25
[7] aus „Diario de a bordo“; zit. nach Peters, 25
[8] locus amoenus = dt.: lieblicher Ort / paradiesische Gegend / Lustort / anmutige Gegend
[9] vgl. Peters, 25f.
[10] aus „Diario de a bordo“; zit. nach Peters, 27
[11] vgl. Peters, 27
[12] „... más son desnudos y sin armas y muy cobardes fue]ra de remedio.“; aus „Diario de a bordo“; zit. nach Peters, 27
[13] vgl. Peters, 27ff.
Häufig gestellte Fragen zum Text
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung thematisiert die Stereotypen, die Menschen von der Welt haben, insbesondere von der indigenen Bevölkerung (Latein-)Amerikas. Es wird erläutert, dass diese Stereotypen oft durch mangelndes Wissen und eigene Erfahrungen entstehen und durch Abgrenzung zum Eigenen geprägt sind. Das gängige Bild des Indianers, der eine rote Haut hat, sich bemalt, Federschmuck trägt und Kannibale ist, wird als Beispiel genannt. Die Arbeit untersucht, wie dieses Bild, besonders der Stereotyp des Kannibalen, entstanden ist und sich halten konnte.
Was beschreibt Kapitel 2: "Der erste Eindruck"?
Kapitel 2 behandelt die ersten Eindrücke Christoph Kolumbus' nach seiner Ankunft in der Karibik im Jahr 1492. Das Weltbild des 15. Jahrhunderts, geprägt von antiken Philosophen und biblischen Lehren, erschwerte das Verständnis der "Neuen Welt".
Wie beschreibt Kolumbus die indigene Bevölkerung in seinem Bordbuch?
Kolumbus' erste Eindrücke von den Indigenen sind überwiegend positiv. Er beschreibt sie als arm, aber gutaussehend, jung und mit schönen Körpern. Er ist fasziniert von der exotischen Natur und sieht die "neue" Welt als irdisches Paradies (locus amoenus).
Wie veränderte sich Kolumbus' Bild von den Indigenen im Laufe der Zeit?
Obwohl Kolumbus zunächst ein positives Bild von den Indigenen hatte, entwickelte sich im Laufe seiner Reisen ein negativer Gegenpol. Aus anfänglicher Nacktheit und Zurückhaltung wurde Schutzlosigkeit und Feigheit. Dies hing damit zusammen, dass Kolumbus, nachdem er keinen großen Goldfund erwartete, nach neuer "Ware" suchte, um seine Auftraggeber nicht zu enttäuschen. Die Indigenen wurden als Sklaven betrachtet, und um ihre Versklavung zu rechtfertigen, beschrieb Kolumbus zunehmend das Bild des bösen, kannibalischen Indianers.
Welche Stereotypen prägte Kolumbus laut dem Text?
Columbus prägte zwei gängige Stereotypen: zum einen das des im Naturzustand lebenden, guten Indios und zum anderen das des schlechten, kannibalischen Indios.
Was bedeuten die Begriffe locus amoenus, Indio, und Stereotyp?
Locus amoenus bedeutet lieblicher Ort, paradiesische Gegend, Lustort oder anmutige Gegend. "Indio" ist eine Bezeichnung für indigene Personen in Lateinamerika, die aber oft abwertend verwendet wird. Stereotyp ist eine griffige Zusammenfassung von Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die vereinfacht und verallgemeinert einen Sachverhalt darstellt und in engem Zusammenhang mit Klischees und Vorurteilen steht.
- Quote paper
- Stefanie Feller (Author), 2007, Stereotype - Indianer sind Kannibalen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110949