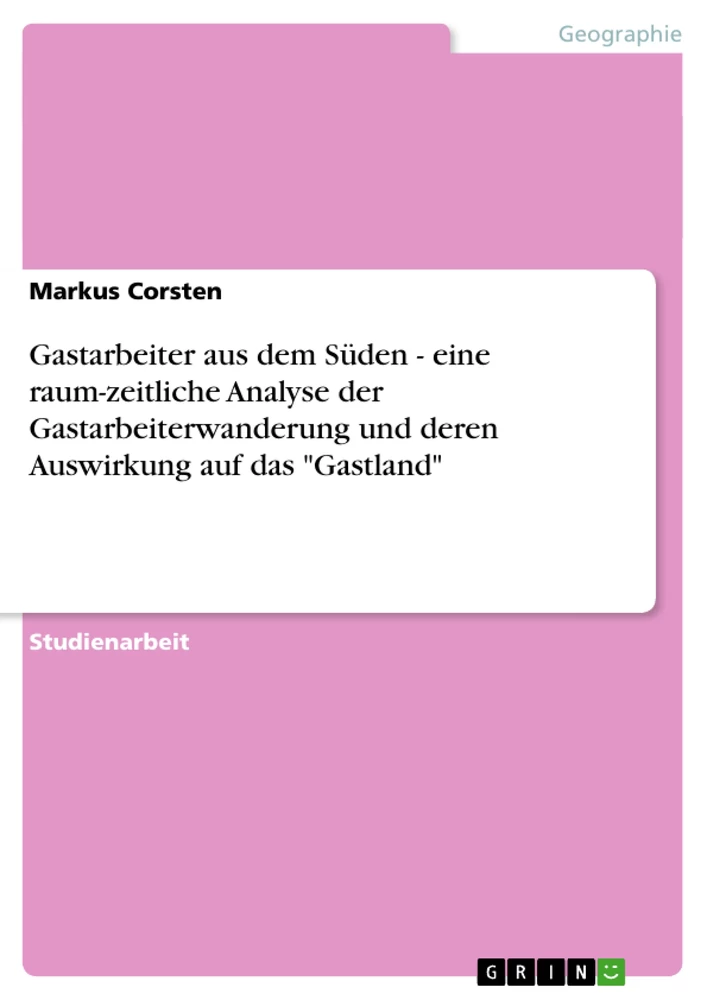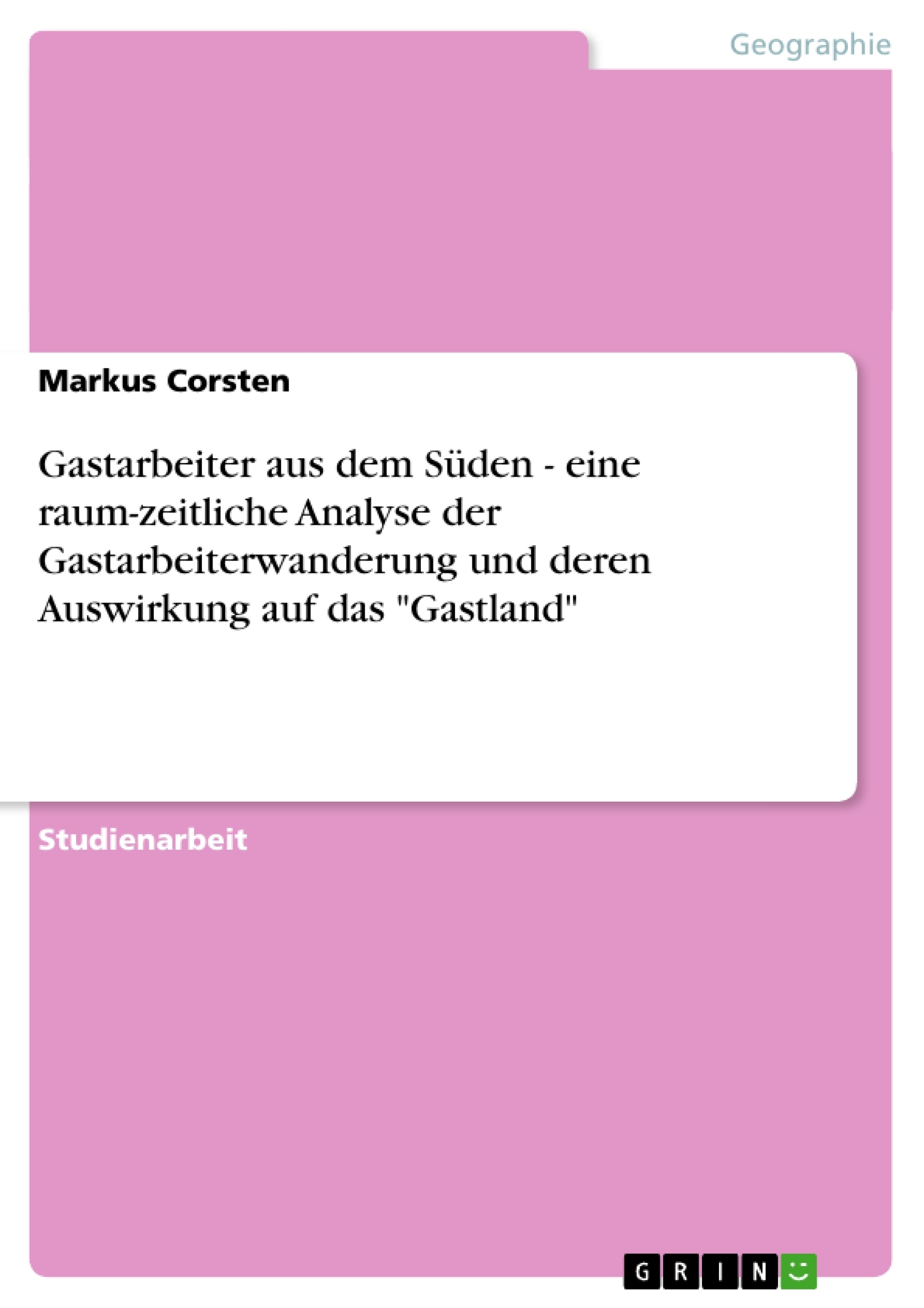Die deutsche Nachkriegsgeschichte ist untrennbar mit dem Phänomen der "Gastarbeiter" verbunden – doch was verbirgt sich wirklich hinter diesem Begriff, der eine ganze Generation von Migranten prägte und die deutsche Gesellschaft nachhaltig veränderte? Diese aufschlussreiche Analyse beleuchtet die komplexe Geschichte der Gastarbeitereinwanderung in der BRD und der DDR, von den ersten Anwerbeabkommen in den 1950er Jahren bis zum Anwerbestopp 1973 und den darauffolgenden Ausnahmeregelungen. Im Fokus stehen die Motive und Mechanismen der Anwerbung, die soziale und räumliche Integration der Gastarbeiter, sowie die Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Dabei werden nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte, sondern auch die gesellschaftlichen und politischen Debatten rund um Migration und Integration kritisch untersucht. War die Gastarbeit tatsächlich nur ein temporäres Phänomen, oder legte sie den Grundstein für eine dauerhafte Einwanderungsgesellschaft? Welche Rolle spielten die unterschiedlichen politischen Systeme in Ost und West bei der Integration der ausländischen Arbeitskräfte? Und welche Lehren können wir aus der Vergangenheit für die Gestaltung einer zukunftsorientierten Migrationspolitik ziehen? Erfahren Sie mehr über die Hintergründe, Herausforderungen und Chancen der Gastarbeitereinwanderung und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die vielschichtigen Prozesse, die Deutschland zu dem gemacht haben, was es heute ist: ein Land geprägt von Vielfalt und Migration. Die Analyse der Gastarbeiterbewegung bietet wertvolle Einblicke in die Dynamik von Arbeitsmigration, Integration und gesellschaftlichem Wandel, und ist somit ein unverzichtbarer Beitrag zur aktuellen Debatte um Migration und Integration in Deutschland und Europa. Es werden die ökonomischen Rahmenbedingungen, die Beweggründe der Migranten und die politischen Entscheidungen beleuchtet, die diese Entwicklung prägten. Ein Muss für alle, die sich für die deutsche Geschichte, Migrationsforschung und die Zukunft unserer Gesellschaft interessieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. zeitlicher Verlauf der Gastarbeitereinwanderung
2.1 Entwicklung in der BRD
2.2 Entwicklung in der DDR
3. Räumliche Verteilung
4. Auswirkungen auf das Gastland
4.1 Integration in der BRD
4.2 Integration in der DDR
4.3 Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
5. zukünftige Entwicklung
6. Fazit
7. Literatur
1. Einleitung
Der Begriff „Gastarbeiter“ entspringt einer öffentlichen Diskussion die den Begriff des Fremdarbeiters ablöste. Der Begriff des Gastarbeiters entsprang aus dem Gedanken des arbeiten „Gastes“. Der „Gast“ sollte eine zeitlich begrenzte Arbeit im Gastland verrichten und nach dem vorübergehendem Aufenthalt wieder in sein Heimatland zurück reisen. In einem Bericht der Bundesanstalt für Arbeit tauchte 1969 erstmals der Begriff der „Ausländischen Arbeitnehmer“ auf. Diese Bezeichnung ersetzte bei offiziellen Stellen und bei Gewerkschaften den damals zunehmenden Begriff „Gastarbeiter“. Heute werden ausländische Arbeitskräfte in Deutschland vorrangig als Arbeitsmigranten bezeichnet (WIKIPEDIA 2006).
In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Nachkriegszeit gab es einen dringenden Bedarf an ausländischen Arbeitskräften und den Mangel zu kompensieren. Große Anwerbeverfahren wurden gestartet. So bekam der einmillionste Gastarbeiter aus Portugal bei seiner Ankunft im Jahr 1964 sogar ein Moped geschenkt.
Heute findet eine starte öffentliche und politische Debatte um die Zukunft von Arbeitsmirgration nach Deutschland statt. Auf der einen Seite greift die Angst der Verdrängungsprozesse deutscher Arbeitskräfte in wirtschaftlich schwierigen Zeiten um sich. Auf der anderen Seite der Debatte steht der Gedanke der verstärkten Migration nach Deutschland auf Grund des demographischen Wandels in Deutschland, der bei andauernder schwachen Geburtenziffern ein starkes Schrumpfen der Bevölkerung nach sich ziehen wird. Des Weiteren gibt es weiterhin einen großen Bedarf an hoch qualifizierten Arbeitskräften in der Deutschen Wirtschaft, der momentan nicht durch deutsche Akademiker gedeckt werden kann.
2. zeitlicher Verlauf der Gastarbeitereinwanderung
2.1 Entwicklung in der BRD
In Deutschland markierte das Ende unmittelbare Nachkriegszeit den Beginn Arbeitskräftezuwanderung. Durch die hohe Wachstumsrate der deutschen Nachkriegswirtschaft und dem kriegsbedingten Ausfall eines großen Teils der männlichen Arbeitskräfte, wurden konnten unmittelbar nach dem Kriegsende Flüchtlinge und Vertriebene der Jahre 1945 – 1948, einfach in das Beschäftigungssystem integriert werden. Zunächst bestand, durch die hohe Zahl von Übersiedlern aus der ehemaligen DDR, wenig Bedarf an zusätzlichen, ausländischen Arbeitskräften, weswegen vom ersten Westdeutschen Anwerbevertrag mit Italien, aus dem Jahr 1955, nur spärlich Gebrauch gemacht wurde. Erst nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 kam, es zu einer nennenswerten Ausweitung der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte (FASSMAN, MÜNZ, SEIFERT 2000: 58-69). Im Folgenden wurden mit Spanien und Griechenland (1960), Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) weitere Anwerbeverträge abgeschlossen. Die ausländischen Arbeitskräfte sollten dabei relativ junge Männer sein und sollten maximal einen Realschulabschluss haben. Sie wurden als Unterstützung nach Deutschland geholt, um Stellen zu besetzen, für die keine deutschen Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Ihre Anstellung richtete sich nach dem deutschen Tarifrecht um ein Lohndumping in Deutschland zu verhindern. Die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte sollte einem Rotationsprinzip folgen. Nach Ablauf der, auf ein Jahr befristeten Aufenthaltserlaubnis, sollten sie in ihr Heimatland zurückkehren und durch die nächste „Generation“ von Gastarbeitern ersetzt werden.
In den ersten fünf Jahren nach der ersten Anwerbevereinbarung kam es nur zu einem spärlichen Zuzug von ausländischen Arbeitskräften auf Grund der Übersiedlung aus der ehemaligen DDR. In der Zeit kam es zu einem Zuzug von knapp 273.000 Arbeitskräften. Nach dem Bau der Berliner Mauer kam es zu einem sprunghaften Anstieg der Zuzüge nach Deutschland. 1965 wurde die Marke von einer Million überschritten und zwei Jahre später wurde der zwei Millionste registriert. 1973 waren dann schließlich 2,6 Millionen Gastarbeiter in Deutschland tätig (PFLUGBEIL 2005: 65).
Zu einer drastischen Reduzierung der Gastarbeiter kam es mit Beginn der ersten Öl-Krise, die zu einer schlagartigen Verfierfachung des Rohölpreises führte, worauf sich die allgemeine wirtschaftliche Situation verschlechterte. Einem weiteren Zuzug ausländischer Arbeitskräfte sollte ein Riegel vorgeschoben werden. Im November 1973 wurde deshalb ein Anwerberstopp verhängt, der bis heute die Zuwanderung von Nicht-EU- Staatsangehörigen grundsätzlich nicht gestattet (PFLUGBEIL 2005: 65).
Die Abb. zeigt die Anzahl ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland. Ab dem Jahr 1973 ist eine deutliche Trendwende der ausländischen Arbeitskräfte zu erkennen, die den Zeitpunkt des Anwerberstopps markiert.
Ausländische Arbeitskräfte in Deutschland (bis 1990 nur Westdeutschland)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Statistisches Bundesamt. – aus: (FASSMAN, MÜNZ, SEIFERT 2000: 59)
Da es in einigen Bereichen weiterhin eine Arbeitskräftemangel in Deutschland vorherrschte, wurden seit 1973 ca 30 Ausnahmeregelungen eingeführt, die mittlerweile in der Anwerberstoppausnahmeverordnung und der Arbeitsaufenthaltsverordnung geregelt sind. Teilweise wurden auch aus außenpolitischen Gründen im Rahmen des politischen Umbruchs mit den Regierungen einiger mittel- und osteuropäischer Länder seit Anfang der 90er Jahre geschlossen. Demnach können einige wenige, genau definierte, Berufs- und Personengruppen eine Arbeitserlaubnis als Saison-, Werkvertrags- und Gastarbeitnehmer in Deutschland erhalten. Dabei werden die Aufenthaltsdauer und die ausgeführte Tätigkeit genau kontrolliert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Kontext des Begriffs "Gastarbeiter"?
Der Begriff "Gastarbeiter" entstand aus einer öffentlichen Diskussion, die den Begriff "Fremdarbeiter" ablöste. Die Idee war, dass der "Gast" eine zeitlich begrenzte Arbeit im Gastland verrichtet und danach in sein Heimatland zurückkehrt.
Wann tauchte der Begriff "Ausländische Arbeitnehmer" auf?
Der Begriff "Ausländische Arbeitnehmer" tauchte 1969 in einem Bericht der Bundesanstalt für Arbeit auf und ersetzte bei offiziellen Stellen und Gewerkschaften den Begriff "Gastarbeiter". Heute werden ausländische Arbeitskräfte in Deutschland vorrangig als Arbeitsmigranten bezeichnet.
Warum wurden in der Nachkriegszeit Gastarbeiter angeworben?
In der Nachkriegszeit gab es aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs einen dringenden Bedarf an ausländischen Arbeitskräften, um den Mangel zu kompensieren.
Wie hat sich die Anwerbung von Gastarbeitern in der BRD entwickelt?
Die Anwerbung von Gastarbeitern begann in der BRD nach dem Krieg. Verträge wurden mit Italien (1955) und später mit anderen Ländern wie Spanien, Griechenland, der Türkei, Marokko, Portugal und Jugoslawien geschlossen. Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 nahm die Anwerbung deutlich zu.
Was war das Rotationsprinzip bei der Anwerbung von Gastarbeitern?
Das Rotationsprinzip sah vor, dass Gastarbeiter nach Ablauf ihrer befristeten Aufenthaltserlaubnis (meist ein Jahr) in ihr Heimatland zurückkehren und durch neue Gastarbeiter ersetzt werden sollten.
Welche Auswirkungen hatte die Ölkrise auf die Gastarbeiter in Deutschland?
Die Ölkrise 1973 führte zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und einem Anwerbestopp im November 1973, der bis heute die Zuwanderung von Nicht-EU-Staatsangehörigen grundsätzlich nicht gestattet.
Welche Ausnahmeregelungen gibt es trotz des Anwerbestopps?
Trotz des Anwerbestopps gibt es ca. 30 Ausnahmeregelungen, die in der Anwerberstoppausnahmeverordnung und der Arbeitsaufenthaltsverordnung geregelt sind. Diese ermöglichen es bestimmten Berufs- und Personengruppen, eine Arbeitserlaubnis als Saison-, Werkvertrags- und Gastarbeitnehmer in Deutschland zu erhalten.
Wer sind Saisonarbeiter und welche Rolle spielen sie?
Saisonarbeiter sind die größte Gruppe ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland. Sie können maximal drei Monate arbeiten, hauptsächlich in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe.
- Quote paper
- Markus Corsten (Author), 2006, Gastarbeiter aus dem Süden - eine raum-zeitliche Analyse der Gastarbeiterwanderung und deren Auswirkung auf das "Gastland", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110911