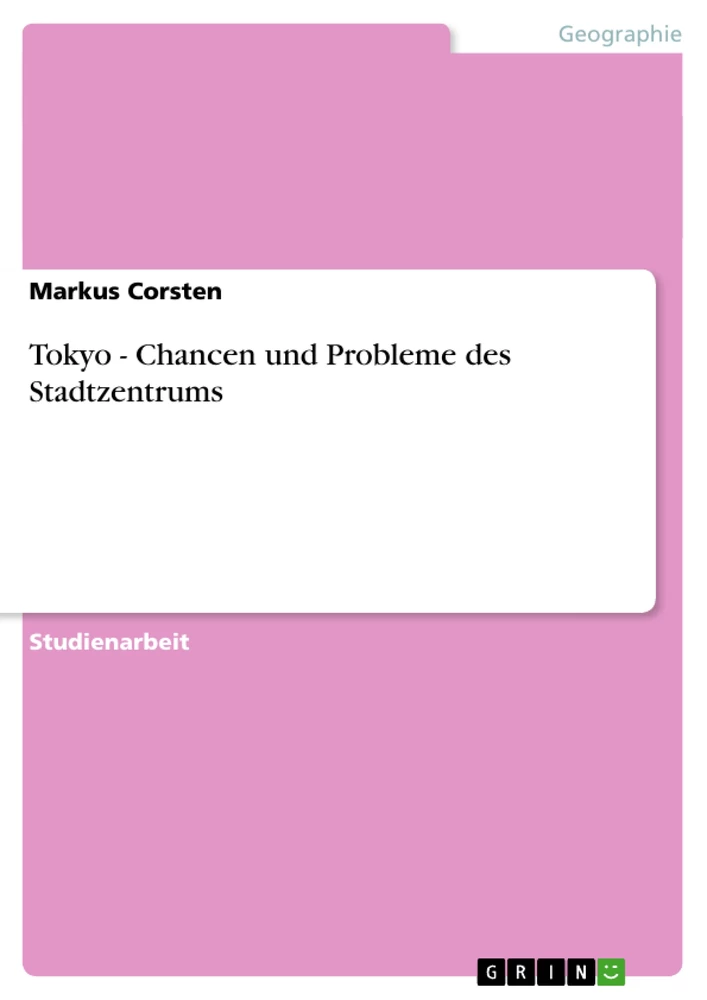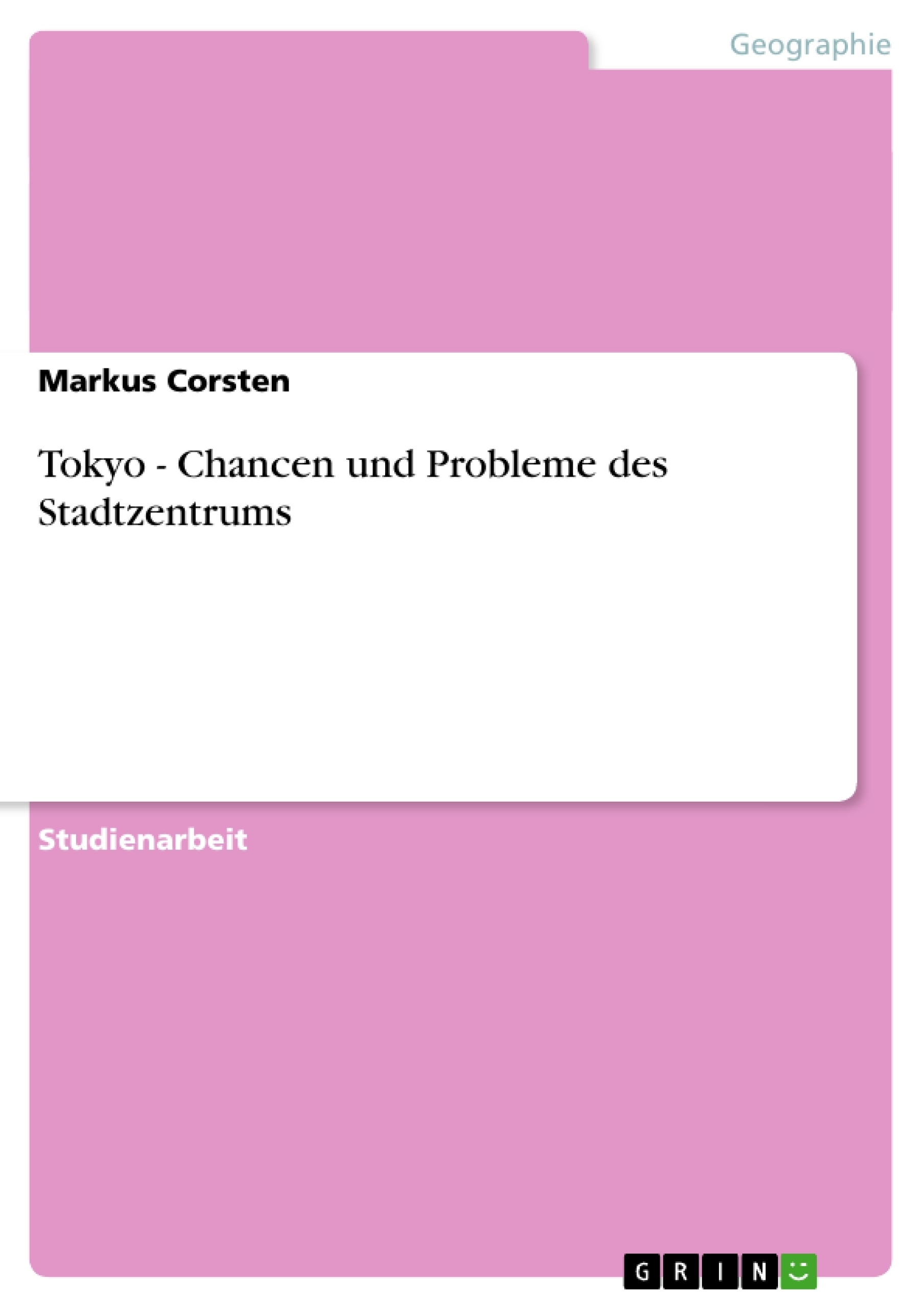Stellen Sie sich eine Stadt vor, die aus der Asche aufstieg, geformt von Erdbeben, Kriegen und einem unaufhaltsamen Drang zur Erneuerung: Tôkyô. Diese pulsierende Metropole, einst Edo genannt, ist mehr als nur die Hauptstadt Japans; sie ist ein globales Kraftzentrum, ein Spiegelbild japanischer Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft. Erkunden Sie die faszinierende Geschichte Tôkyôs, von ihrer bescheidenen Entstehung als Burgstadt bis zu ihrer heutigen Rolle als eine der führenden Megastädte der Welt. Tauchen Sie ein in die komplexen Herausforderungen, die mit einer solch immensen Konzentration von Menschen und Ressourcen einhergehen: der unerbittliche Pendlerverkehr, der chronische Raummangel und die allgegenwärtige Bedrohung durch Naturkatastrophen. Entdecken Sie gleichzeitig die unzähligen Vorteile, die Tôkyô zu einem Magneten für Unternehmen, Talente und Investitionen machen. Erfahren Sie, wie Stadtplaner und Architekten innovative Lösungen entwickeln, um den wachsenden Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur zu decken, von der Expansion in die Vertikale durch hochmoderne Wolkenkratzer bis zur Erschließung neuer Stadtteile an der Waterfront der Bucht von Tôkyô. Dieses Buch analysiert die treibenden Kräfte hinter der Reurbanisierung Tôkyôs und untersucht, wie sich die Stadt den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stellt, während sie gleichzeitig ihre einzigartige kulturelle Identität bewahrt. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die vielschichtige Realität Tôkyôs, einer Stadt, die ständig im Wandel ist und doch immer ihren unverwechselbaren Charakter bewahrt – ein faszinierendes Beispiel für die Dynamik urbaner Entwicklung im globalen Kontext. Lernen Sie die Stadt der Zukunft kennen, eine Stadt, die Tradition und Innovation, Chaos und Ordnung, Risiko und Chance auf einzigartige Weise miteinander verbindet. Verstehen Sie die Konzepte der Global City, Reurbanisierung und Stadtplanung am Beispiel einer der bevölkerungsreichsten und dynamischsten Metropolen der Welt. Erfahren Sie mehr über die Raumausweitung in der Vertikalen und Horizontalen und die historischen Hintergründe der Stadtentwicklung seit der Meiji Restauration.
Gliederung
1. Einleitung
2. Städtische Entwicklung von Tôkyô
2.1 Historische Stadtstruktur
2.2 Veränderung der traditionellen Stadtstruktur nach 1867
3. Megastadt und Global City Tôkyô
4. Agglomerationsprobleme
4.1 Pendlerverkehr
4.2 Raummangel
4.3 große Verwundbarkeit gegenüber Naturkatastrophen
5. Agglomerationsvorteile
6. Trend zur Reurbanisierung
7. Stadtplanerische Maßnahmen
7.1 Raumausweitung in die Vertikale
7.2 Raumausweitung in die Horizontale (Waterfrontentwicklung)
8. Fazit
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Weltweit gibt es keinen vergleichbar stark verdichteten Raum wie den Agglomerationsraum der japanischen Hauptstadt. Gut ein Viertel der japanischen Bevölkerung lebt in der japanischen Hauptstadt. Doch nicht allein wegen der Bevölkerungszahl ist die Stadt überragend. Tôkyô nimmt wegen der Hauptstadtfunktion und als wirtschaftlich wichtigster japanischer Standort nicht nur national eine dominierende Rolle ein, sondern bestimmt als Teil der Tirade der Global Cities wichtige internationale Geschicke.
Im Laufe der Geschichte hat die Stadt zahlreiche Veränderungen durchlebt. Angefangen durch den Umzug des Kaisersitzes von Kyoto nach Tôkyô (ehemals Edo), über die Zerstörungen durch Erdbeben und dem zweiten Weltkrieg, bis hin zu momentanen Prozessen der Reurbanisierung. Dabei spielen die historischen Strukturen und der Trend zur Konzentration in Japan eine entscheidende Rolle. Doch welche Probleme und Chancen gehen mit der immens hohen Bevölkerungsdichte einher.
Beispielhaft sollen für die Stadt Tôkyô die große Flächenknappheit im Stadtzentrum und die daraus bedingten Probleme angesprochen werden. Hohe Grundstückspreise führen zu einer Verdrängung der Wohnbevölkerung ins Suburbane und führen zu weiteren Problemen wie dem extrem hohen Pendlerverkehr. Traditionell kleine Grundstücke erschweren und verteuern den dringend benötigten Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
Chancen für den nötigen Stadtumbau ergeben sich durch nachlassenden Teritärisierungsdruck und nachlassende Grundstückspreise. Politiker und Verantwortliche forcieren dabei den Umbau Tôkyôs zu einer vertikalen Stadt und die Entwicklung der Stadtteile an den Waterfronts von der Bucht von Tôkyô.
Erschwerend liegt über der Stadt der bedrohliche Schatten eines kommenden, zerstörerischen Erdbebens, welches, durch die großteils noch traditionelle, nicht brand- und erdbebensichere Bauweise, verheerende Auswirkungen auf den Stadtbereich nach sich ziehen würde.
2. Städtische Entwicklung von Tôkyô
Die heutige Hauptstadt Japans trägt erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Namen Tôkyô. In der Mitte des 19. Jahrhunderts verlagerte der damalige Kaiser die Hauptstadt Japans von Kyoto in den Osten nach Edo. Edo wurde damit zu Japans „Hauptstadt des Ostens“ und hieß fortan To-Kyo ( “To“: Osten, “Kyo“: Hauptstadt).
2.1 Historische Stadtstruktur
Wie auch ca. 50 % aller japanischen Städte ist Tôkyô eine ehemalige Burgstadt, die durch Feudalherren (so genannte Daimyos) im gesamten Land aus militärischen bzw. verwaltungstechnischen Gründen angelegt wurden. Damit erhielt das japanische Städtenetz schon frühzeitig ein Netz zentraler Orte, welches sich im Zeitalter der Industrialisierung als sehr vorteilhaft erwies. Die Grundstrukturen der japanischen Burgstadt zeigen dabei auch im Falle Tôkyôs insgesamt eine vorherrschende Anordnung nach dem Ringmodell der Stadtentwicklung von Burgess, ergänzt durch einige Kerne wie buddhistische Tempel oder shintoistische Schreine. Im Gegensatz zum amerikanisch geprägten Burgess-Modell herrscht hier allerdings ein von innen nach außen abnehmender Sozialgradient vor (Samurai wohnen um Herrschersitz, weiter außen Kaufleute und Handwerker). Im Hinblick auf die Entwicklung Tôkyôs aus historisch-geographischer Sicht ist zunächst insbesondere das Jahr 1603 von Bedeutung, denn Tokugawa Leyasu wird in diesem Jahr vom Kaiser zum Shogun, dem obersten Feldherrn, ernannt. Als Shogun reißt er auch die politische Macht an sich und erklärt Edo (alte Bezeichnung für Tôkyô) zu seiner Residenzstadt. Die Provinzstadt übernimmt damit quasi die Hauptstadtrolle der Kaiserstadt Kyoto. Während der nächsten 264 Jahre entwickelt sich Edo unter dem Shogunat der Tokugawa zu einer großen Stadt. Handwerker, Händler, Beamte, Künstler und Krieger werden an den Hof des Shoguns gezogen.
2.2 Veränderung der traditionellen Stadtstruktur nach 1867
Mit der Auflösung der Feudalordnung durch den Zusammenbruch des Shogunats (Meiji-Restauration, seit 1867) beginnt die bürgerlich kapitalistische Stadtentwicklung Tôkyôs. Die Stadt wurde von Edo in Tôkyô (östliche Hauptstadt) umbenannt und Sitz des Kaiserhauses. Erhalten blieben vor allem die Kerne der alten Burgstadt mit ihren weitgehend intakten Palastbauten und Parkanlagen. Diese befinden sich heute in der Regel in öffentlicher Hand, sind mit Ausnahme des Kaiserpalastes allgemein zugänglich und stellen als Oasen der Ruhe im hektischen Tôkyô Anziehungspunkte im Fremden- und Naherholungsverkehr dar oder sind Standorte für Bildungseinrichtungen sowie Tagungs- und Begegnungszentren.
Die unmittelbare Umgebung der Burg hat sich bis zur Gegenwart zumindest teilweise als gehobenes Wohngebiet sowie Regierungs- und Botschaftsviertel behauptet.
Im 20. Jahrhundert wurde Tôkyô zweimal katastrophal zerstört. Die erste Katastrophe war das Kantô-Erdbeben der Stärke 7,9 von 1923 mit mehr als 100.000 Toten. Folgenschwerer als das Erdbeben waren die nachfolgenden Flächenbrände, denn dabei wurden 44 % der zuvor überbauten Stadtfläche zerstört.
Nach 1923 ergab sich aber auch die Chance, im Rahmen des Wiederaufbaus Tôkyô in eine moderne Stadt zu verwandeln. Dieser Prozess wurde schon 1945 jäh unterbrochen, als gegen Ende des zweiten Weltkrieges amerikanische Fliegerverbände Tôkyô bis zur japanischen Kapitulation planmäßig zerstörten. Verglichen mit dem großen Kanto-Beben war die Zerstörung diesmal noch weit stärker und umfangreicher. 80 % der Einwohner hatten ihr Hab und Gut verloren (FORUM BMK). Tôkyô glich einer ausgebrannten Wüste. Der Wiederaufbau verlief nach dem zweiten Weltkrieg völlig ohne Plan, unvermittelt, abrupt, alles dem Zufall überlassend. Ein Chaos für den modernen Großstadtverkehr, ein Irrgarten für Besucher, in dem man, um sich zurecht zu finden, auf der Visitenkarte den Lageplan des Hauses drucken muss, weil selbst Ortskenner nicht ans Ziel kommen würden.
3. Megastadt und Global City Tôkyô
Seit ihrer Gründung erlebte Tôkyô ein beispielsloses Wachstum in demographischer und räumlicher Hinsicht, welches die japanische Hauptstadt heute zur bevölkerungsreichsten Stadt der Welt hat werden lassen. In vielen Quellen schwankt jedoch die Angabe der Einwohnerzahl Tôkyôs, was mit der unterschiedlichen Auffassung zu tun hat, was genau unter Tôkyô verstanden wird. SCHWENKTER (SCHWENKTER 2006: 139-140) löst das Problem, indem er vier verschiedene Bedeutungen von Tôkyô voneinander unterscheidet:
a) Die Kernstadt Tôkyô (bis 1943 Tôkyô-shi = Tôkyô-Stadt): Es handelt sich dabei um die „kleinste“ Einheit, die bis heute auf ca 589km2 die 23 zentralen Stadtbezirke (ku) umschließt;
b) Tôkyô Metropolis (Tôkyô-to) oder auch Präfektur Tôkyô: Neben den 23 Bezirken zählen zur Tôkyô Metropolis auch die sich etwa 60km nach Westen hin ausstreckende Tama-Region mit einer Fläche vom 1200km2, die einen teils hochgradig suburbanisierten, teils noch ländlichen Charakter trägt und einige kleinere Inselgruppen im Pazifischen Ozean;
c) Tôkyô als metropolitane Agglomeration: Darunter versteht man die Präfektur Tôkyô sowie die mit ihr stark vernetzten umliegenden Präfekturen Chiba, Saitma und Kanagawa (mit Yokohama). Insgesamt erstreckt sich diese Großregion auf eine Fläche von ca 13.500km2;
d) Die Hauptstadtregion Tôkyô: Sie umschließt neben den unter c) genannten Präfekturen noch vier weitere (Yamanashi, Gunma, Tochigi und Ibaraki), die sich
wie ein Ring um die metropolitane Agglomeration legen. Die Hauptstadtregion ist eine Planungseinheit mit einer räumlichen Ausdehnung von knapp 37.000km2, die auf Überlegungen aus dem Jahre 1956 zurückgeht, um die fortschreitende Suburbanisierung in der Region regulativ einzuhegen.
Was die Zahl der Einwohner betrifft, so ist Tôkyô heute mit Abstand der größte Ballungsraum der Welt und übertrifft deutlich den von der UN auf derzeit 10 Millionen Einwohnern festgelegten Schwellenwert für Megastädte. Tôkyô als Metropolregion betrachtet umfasst 33 Millionen Menschen, was gut einem Viertel der Gesamtbevölkerung Japans entspricht (HOHN 2002: 229). Derzeit nimmt die Bevölke]rung nur noch geringfügig durch natürliches Wachstum zu. Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2015 35 Millionen Menschen in der Metropolregion leben werden. In der Hauptstadtregion Tôkyô, von der aber weniger häufig die Rede ist, leben momentan sogar 40,4 Millionen Menschen (FLÜCHTER W. 1996: 6).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes "Gliederung"?
Der Text "Gliederung" ist eine umfassende Übersicht über die städtische Entwicklung von Tôkyô, von seiner historischen Stadtstruktur bis hin zu aktuellen Stadtplanungsmaßnahmen. Er behandelt auch die Probleme und Vorteile, die mit der hohen Bevölkerungsdichte verbunden sind.
Welche Themen werden in der "Gliederung" behandelt?
Die wichtigsten Themen sind die städtische Entwicklung Tôkyôs, die Rolle als Megastadt und Global City, Agglomerationsprobleme (Pendlerverkehr, Raummangel, Naturkatastrophen), Agglomerationsvorteile, Reurbanisierungstrends und stadtplanerische Maßnahmen (Raumausweitung in die Vertikale und Horizontale).
Was sind die historischen Eckpunkte der städtischen Entwicklung von Tôkyô?
Die Eckpunkte umfassen den Umzug des Kaisersitzes von Kyoto nach Tôkyô (ehemals Edo), die Zerstörungen durch Erdbeben und den Zweiten Weltkrieg sowie die aktuellen Prozesse der Reurbanisierung.
Welche Agglomerationsprobleme werden in Bezug auf Tôkyô genannt?
Die genannten Probleme sind Pendlerverkehr, Raummangel und die große Verwundbarkeit gegenüber Naturkatastrophen, insbesondere Erdbeben.
Welche stadtplanerischen Maßnahmen werden zur Lösung der Probleme in Tôkyô vorgeschlagen?
Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen die Raumausweitung in die Vertikale (Hochhäuser) und die Horizontale (Waterfrontentwicklung).
Was bedeutet der Begriff "Global City" im Zusammenhang mit Tôkyô?
Tôkyô wird neben New York und London als eine der weltweit dominierenden Global Cities betrachtet, da es ein wichtiges internationales Handels-, Finanz- und Kulturzentrum ist.
Wie hat sich die Stadtstruktur von Tôkyô nach 1867 verändert?
Mit der Auflösung der Feudalordnung begann die bürgerlich-kapitalistische Stadtentwicklung. Edo wurde in Tôkyô umbenannt und Sitz des Kaiserhauses. Die alten Burgstadtkerne blieben erhalten, während die Stadt sich modernisierte.
Welche Rolle spielt das Kantô-Erdbeben von 1923 in der Geschichte Tôkyôs?
Das Kantô-Erdbeben verursachte massive Zerstörungen und bot die Chance, Tôkyô im Rahmen des Wiederaufbaus in eine moderne Stadt zu verwandeln. Dieser Prozess wurde jedoch durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen.
Was sind die verschiedenen Definitionen von Tôkyô bezüglich der Einwohnerzahl und Fläche?
Der Text unterscheidet zwischen der Kernstadt Tôkyô, Tôkyô Metropolis (Präfektur), der metropolianen Agglomeration Tôkyô und der Hauptstadtregion Tôkyô, die sich jeweils in Fläche und Einwohnerzahl unterscheiden.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hat Tôkyô für Japan und die Welt?
Tôkyô ist das Zentrum der Medienwirtschaft, Sitz vieler japanischer IT-Unternehmen und beherbergt einen Großteil der Japan-Zentralen ausländischer Unternehmen. Es spielt eine dominierende Rolle im nationalen und globalen Städtesystem.
- Quote paper
- Markus Corsten (Author), 2007, Tokyo - Chancen und Probleme des Stadtzentrums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110909