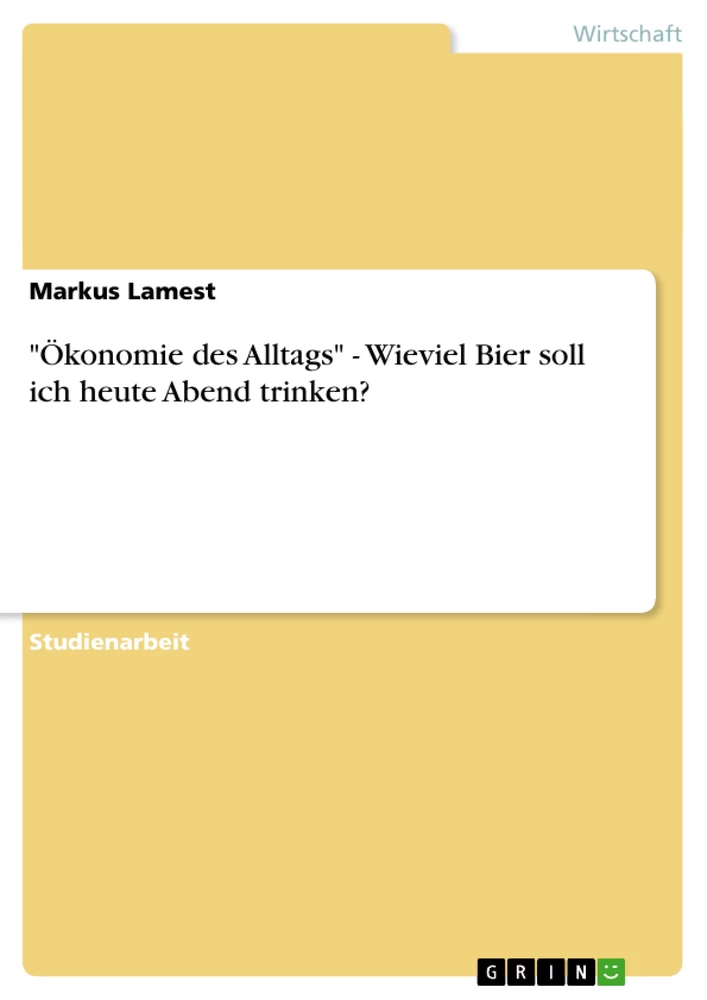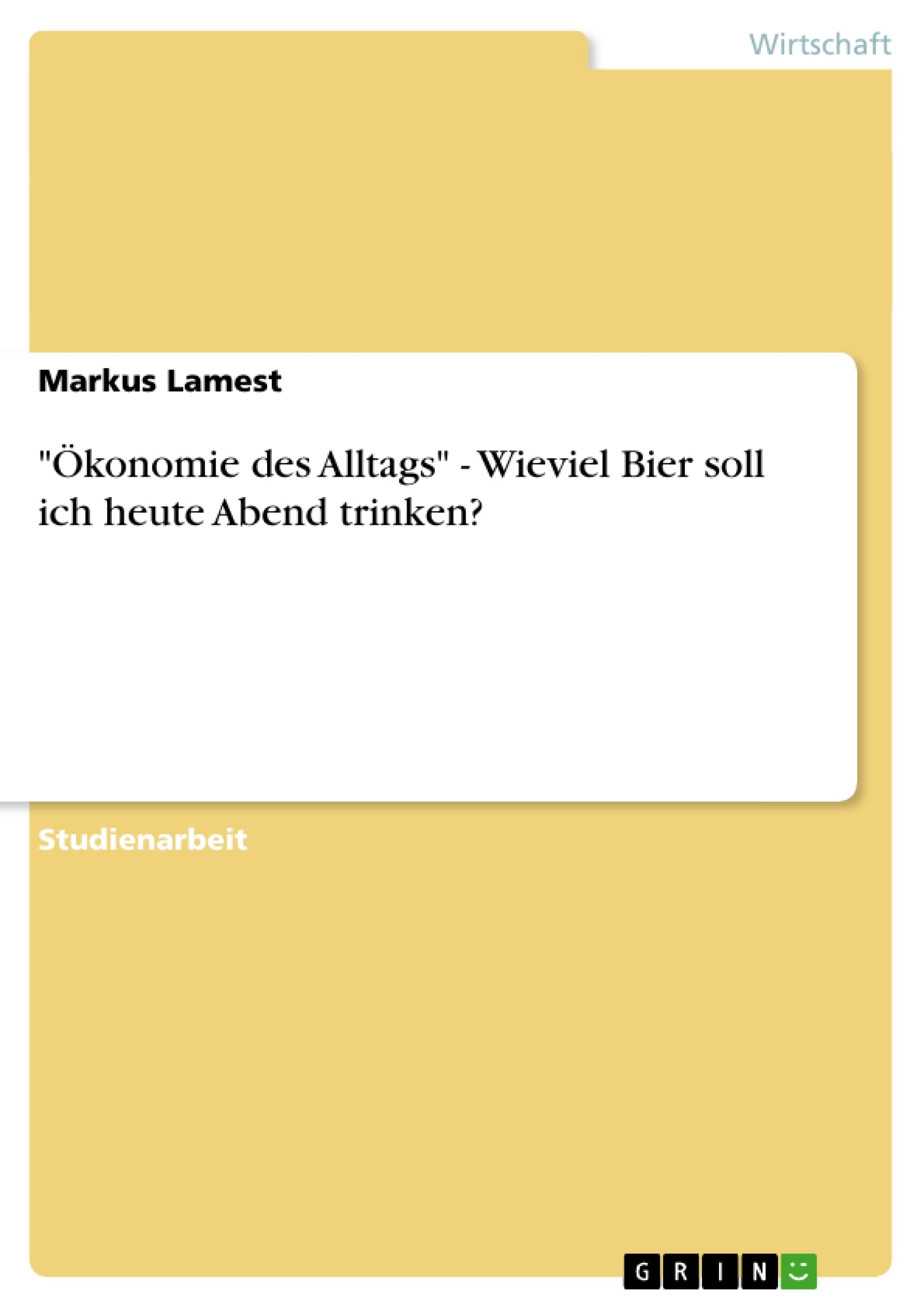Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Freunden zusammen, das Gespräch fließt, und ein kühles Bier in der Hand scheint die perfekte Ergänzung zu sein. Doch wie viele Biere sind zu viele? Diese Frage, die sich fast jeder schon einmal gestellt hat, steht im Zentrum dieser aufschlussreichen Analyse des Bierkonsums aus ökonomischer Perspektive. Jenseits von Stammtischweisheiten und feuchtfröhlichen Anekdoten beleuchtet dieses Werk die komplexen Beweggründe und Konsequenzen unseres Bierkonsums, indem es eine Brücke zwischen individuellen Genussmomenten und den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen schlägt. Es werden die Vor- und Nachteile des Biertrinkens seziert, von den geselligen Aspekten und der potenziellen Durstlöschung bis hin zu den gesundheitlichen Risiken und gesellschaftlichen Kosten des Alkoholmissbrauchs. Die Analyse stützt sich dabei auf ökonomische Theorien wie die Nutzen- und Grenznutzentheorie, um ein tieferes Verständnis für die individuellen Entscheidungsprozesse beim Bierkonsum zu entwickeln. Es geht darum, ein rationales Zielsystem zu generieren, das sowohl den persönlichen Nutzen maximiert als auch die potenziellen Kosten minimiert. Anhand von praxisnahen Beispielen wird aufgezeigt, wie jeder Einzelne seinen Bierkonsum bewusster gestalten und einen gesunden Mittelweg finden kann – zwischen dem Genuss eines Feierabendbiers und den negativen Auswirkungen übermäßigen Alkoholkonsums. Diese Lektüre richtet sich an alle, die ihren Umgang mit Bier reflektieren und informierte Entscheidungen treffen möchten, um die positiven Seiten des Bierkonsums zu genießen, ohne die negativen Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen. Eine ebenso unterhaltsame wie informative Reise in die Welt des Bieres, die den Leser dazu anregt, über sein eigenes Konsumverhalten nachzudenken und verantwortungsvoll zu handeln. Tauchen Sie ein in die überraschende Ökonomie des Bieres und entdecken Sie, wie wissenschaftliche Erkenntnisse Ihnen helfen können, Ihren Genuss zu optimieren und die Kontrolle zu behalten.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Biertrinken – Ein Für und Wider
2.1 Vorteile und Nutzen des Bierkonsums
2.2 Nachteile und Kosten des Bierkonsums
2.3 Das Bier als Ungut
3. Ökonomische Theorien bezüglich des Bierkonsums
3.1 Die Nutzen- und Grenznutzentheorie
3.2 Kosten und Grenzkosten
3.3 Die Generierung von Zielsystemen nach der Theorie des rationalen Entscheidens
4. Konsumverhalten im Fall des Bieres: Theorie und Praxis
4.1 Nutzen und Kosten des Bieres
4.2 Der Bierkonsum: Ziele und Entscheidungen
4.2.1 Beispiele
4.2.2 Analyse der Beispiele
5. Fazit
Anhang
1. Auswirkungen des Promillewertes auf den Menschen zu Kapitel 4.1
2. Quellen der Zielfindung in den Beispielen aus Kapitel 4.2.1
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb.1:Der Gesamtnutzen
Abb.2:Gesetz des abnehmenden Grenznutzens
Abb.3:Vergleich Grenznutzen / Gesamtnutzen
Abb.4:Grenznutzen und Grenzkosten des Bieres
Abb.5:Entscheidungsschema beim Bierkonsum
Tabellenverzeichnis
Tab.1:Gesamt- und Grenznutzen des Bieres
Tab.2:Grenznutzen und Grenzkosten beim Bierkonsum
1. Einleitung
Zu Anfang dieser Arbeit soll eine Situation geschildert werden, die sehr all- täglich ist, die aber auch von einer wissenschaftlichen Seite betrachtet wer- den kann. Nahezu jeder hat sich schon einmal mit Freunden zu einer geselli- gen Runde getroffen und dabei das ein oder andere Bier zuviel getrunken. Oft genug wird dabei nicht über die negativen Folgen des Alkoholkonsums nachgedacht, nur wenige stellen sich die Frage „Wie viel Bier soll ich heute Abend eigentlich trinken?“ bewusst.
Es handelt sich um eine Frage, die sich jeder von uns stellen sollte, denn in unserem Alltag steht die Konfrontation mit Bier an der Tagesordnung. Es gibt kaum eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeit oder ein Volksfest, bei dem einem kein Bier angeboten wird. Ferner konnte man kein einziges Spiel der Fußball- Weltmeisterschaft 2006 ansehen, ohne nicht mindestens zwei Mal den Wer- bespot einer bekannten Brauerei zu sehen, in der uns ein deutscher Natio- nalspieler zum Bierkonsum animiert.
Beim wissenschaftlichen Angehen des Themas begegnen einem Fragestel- lungen über optimale Mengen auch in ökonomischen Zusammenhängen, beispielsweise in Zusammenhang mit der Ermittlung von Produktions- oder Lagermengen. Allen diesen Fragestellungen ist gemeinsam, dass ein mög- lichst optimaler Zustand durch einen Vergleich von Kosten und Nutzen er- reicht werden soll.
Zunächst muss geklärt werden, wieso überhaupt Bier getrunken wird, worin also für den Einzelnen von uns ein Vorteil bzw. ein Nutzen im Biertrinken liegt.
Da das Bier im Vergleich zu anderen Konsumgütern des täglichen Bedarfs jedoch sowohl negative Auswirkungen auf den Körper als auch eine berau- schende Wirkung auf den Geist hat, muss mit seinem Konsum besonders vorsichtig umgegangen werden. Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, ob es einen gesunden Mittelweg zwischen übermäßigem Bierkonsum und völli- gem Verzicht gibt und wie er am besten erreicht werden kann. Bei der Be- trachtung der Fragestellung unter ökonomischen Gesichtspunkten gilt es, ein Optimierungsproblem zu lösen, indem diese Kosten minimiert werden und gleichzeitig der größtmögliche Nutzen erreicht wird.
Dazu werden im zweiten Teil dieser Arbeit sowohl Gründe für und gegen das Konsumieren von Bier aufgeführt, als auch die Bezeichnung „Ungut“, die es wegen des enthaltenen Alkohols trägt, erläutert und differenziert. Außerdem sollen aktuelle Statistiken über den Alkoholkonsum die Relevanz der Behandlung dieser Problematik weiter verdeutlichen.
Im darauf folgenden dritten Teil folgt die Beschreibung zweier ökonomischer Theorien, die eine zentrale Rolle bei der Beantwortung der Fragestellung spielen: Die Nutzen- und Grenznutzentheorie sowie die Generierung von Zielsystem als Teil der Theorie des rationalen Handelns. Der vierte Teil führt schließlich die Praxis des ersten Teils und die Theorie des zweiten Teils zu- sammen, während im fünften Teil die Ergebnisse dieser Arbeit abschließend dargestellt werden.
2. Biertrinken – Ein Für und Wider
Der folgende Teil zeigt die positiven und negativen Effekte auf, die mit dem Biertrinken verbunden sind. Diese umfassen sowohl individuelle, auf den Einzelnen von uns bezogene, als auch gesamtgesellschaftliche Auswirkun- gen.
2.1 Vorteile und Nutzen des Bierkonsums
Zunächst werden die Vorteile, die der Bierkonsum einem bringt, beschrieben. So kann ein kühles Bier, besonders an heißen Tagen, den Durst stillen: Die Einen trinken es im Biergarten nach einem Spaziergang in der Sonne, ande- re im Vereinsheim nach einem anstrengenden Fußballspiel.
Ein anderer, weitaus bedeutenderer Grund ist jedoch sicherlich nicht die er- frischende Wirkung eines eisgekühlten Bieres, sondern sein Alkoholgehalt. So kann das Bier in geselliger Umgebung die Stimmung heben, es wird lau- ter gelacht und ausgiebiger geplaudert. Bei vielen Menschen sinkt die Hemmschwelle, Dinge zu tun für die sie ohne Alkohol im Blut viel zu schüch- tern wären. So konsumieren viele Menschen alkoholische Getränke, wenn sie auf der Suche nach einem Partner sind oder flirten wollen, da sie sich angeheitert mehr zutrauen. Es lässt sich kaum abstreiten, dass die berau- schende Wirkung von Alkohol den Spaß und das Vergnügen auf Partys und an geselligen Abenden bei den meisten Menschen erheblich steigert.
Der Konsum von Alkoholgütern wird trotz zahlreicher unten dargestellter Nachteile in unserer Gesellschaft geduldet und im Grunde ist dagegen auch nichts einzuwenden, solange es sich in Maßen hält. Doch genau dieses Maß fehlt vielen Menschen, die Rede ist dabei nicht nur von Alkoholabhängigen.
2.2 Nachteile und Kosten des Bierkonsums
Die negativen Auswirkungen, die dem Nutzen gegenüberstehen, machen sich im harmlosesten Fall nach übermäßigem Konsum am nächsten Morgen in Form von Übelkeit und Kopfschmerzen bemerkbar. Viele Menschen be- reuen ihren Bierkonsum im Nachhinein, wenn sie wieder nüchtern sind. Es ist für sie oft nicht mehr nachvollziehbar, wie es so weit kommen konnte. Im schlimmsten Fall gerät man noch am selben Abend in eine ungewollte Situa- tion, die dem Alkohol zu "verdanken" ist. Die Spanne der alkoholbedingten kritischen Situationen geht zum Beispiel bei Autofahrern vom Verlust des Führerscheins bis hin zu schweren, oftmals tödlichen Verkehrsunfällen. Bei- spielsweise konnte man allein im Jahre 2004 knapp 21.000 Verkehrsunfälle mit Personenschäden auf den Alkoholkonsum der beteiligten zurückführen[1].
Manche Menschen trinken außerdem dann Bier, wenn sie einen schlechten Tag hatten oder sie vor unlösbaren Problemen stehen. Der Alkohol lässt sie diese Sorgen vorübergehend vergessen und wird dadurch ihr einziger „Be- gleiter“ in einsamen Stunden. Für viele ist dies der Beginn einer krankhaften Alkoholsucht. So leben nach Auskunft der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. in Deutschland etwa 2,5 Millionen behandlungsbedürftige Alkoholkranke[2].
Gerade die oben genannten Fälle von Alkoholmissbrauch machen es in mei- nen Augen so sinnvoll, die Frage nach dem „wie viel“ zu stellen und Möglich- keiten aufzuweisen, wie der eigene Alkoholkonsum verringert werden kann.
2.3 Das Bier als Ungut
Eine spezielle Art von Gütern stellen die Ungüter dar. Während der Konsum eines Gutes stets ohne Bedenken angestrebt werden kann, bringt der Kon- sum eines Unguts negative Effekte mit sich. In der Literatur wird “bad“ fol- gendermaßen bezeichnet: “Good, for which less is preferred rather than mo- re“[3] Bei einem Ungut strebt der Mensch also danach, so wenig wie möglich davon zu konsumieren. Anders als bei alkoholfreien Getränken (Güter) sollte demnach beim Konsum alkoholhaltiger Getränke (Ungüter) darauf geachtet werden, dass sie nicht regelmäßig verzehrt werden sondern nur bei speziel- len Gelegenheiten und auch dann nur in Maßen.
3. Ökonomische Theorien bezüglich des Bierkonsums
Im nun folgenden Teil werden die grundlegenden Theorien der Wirtschafts- wissenschaften, die Aussagen zu dem behandelten Themengebiet machen, dargestellt.
3.1 Die Nutzen- und Grenznutzentheorie
Gehen wir zunächst einmal nur vom Nutzen des Bieres aus, so gibt die Volkswirtschaftslehre Antworten durch die Nutzentheorie.
Der "Grad des Glücks oder der Zufriedenheit, den eine Person aus ihren Le- bensumständen erzielt"[4], wird als Nutzen bezeichnet.
Die Theorie geht davon aus, dass “der Nutzenzuwachs jeder zusätzlich kon- sumierten Einheit eines Gutes abnimmt, bis schließlich Sättigung eintritt.“[5]Dies entspricht dem ersten Gossenschen Gesetz und bedeutet, dass mit der ersten Einheit des Gutes der für mich persönlich größte Nutzen erzielt wird. Man nehme als Beispiel den Sportler, der nach einem Wettkampf mit dem ersten Glas Wasser seinen Durst stillt. Die Einnahme jeder weiteren Einheit des Gutes, bringt immer noch einen Nutzenzuwachs, jedoch verringert sich dieser. Man kann dieses Phänomen, wie nachfolgend in Abbildung 1 darge- stellt, durch eine streng monoton steigende Kurve veranschaulichen, in der auf der x-Achse die Menge an verbrauchten Gütern und auf der y-Achse der Gesamtnutzen dargestellt wird.
[...]
[1] o.V.; http://www.destatis.de/basis/d/verk/verktab9.php; Abgerufen am 21.06.06
[2] o.V.; http://www.krebsgesellschaft.de/alkohol_wertrinktwas,1060.html; Abgerufen am 01.06.06
[3] Pindyck, Rubinfeld (2005); S.73
[4] Mankiw (2004); S. 467
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, die Kapitelzusammenfassungen und die Schlüsselwörter enthält.
Was sind die Hauptthemen, die in diesem Dokument behandelt werden?
Die Hauptthemen sind das Biertrinken, die Vor- und Nachteile des Bierkonsums, ökonomische Theorien bezüglich des Bierkonsums und Konsumverhalten im Fall des Bieres.
Was sind die ökonomischen Theorien, die im Dokument behandelt werden?
Die ökonomischen Theorien sind die Nutzen- und Grenznutzentheorie sowie die Generierung von Zielsystemen nach der Theorie des rationalen Entscheidens.
Welche Vorteile des Bierkonsums werden genannt?
Es wird erwähnt, dass Bier den Durst stillen kann und in geselliger Umgebung die Stimmung heben kann.
Welche Nachteile des Bierkonsums werden genannt?
Es werden Übelkeit, Kopfschmerzen, ungewollte Situationen, Verkehrsunfälle und Alkoholabhängigkeit als negative Auswirkungen genannt.
Was bedeutet "Bier als Ungut"?
Bier wird als Ungut bezeichnet, weil es aufgrund seines Alkoholgehalts negative Effekte mit sich bringt und man daher danach streben sollte, so wenig wie möglich davon zu konsumieren.
Was ist die Nutzentheorie?
Die Nutzentheorie besagt, dass der Nutzenzuwachs jeder zusätzlich konsumierten Einheit eines Gutes abnimmt, bis schließlich Sättigung eintritt (erstes Gossensches Gesetz).
Welche Abbildungen und Tabellen sind im Dokument enthalten?
Es gibt Abbildungen zum Gesamtnutzen, Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, Vergleich Grenznutzen/Gesamtnutzen, Grenznutzen und Grenzkosten des Bieres sowie ein Entscheidungsschema beim Bierkonsum. Tabellen zeigen den Gesamt- und Grenznutzen des Bieres sowie Grenznutzen und Grenzkosten beim Bierkonsum.
Was wird im Fazit behandelt?
Im Fazit werden die Ergebnisse der Arbeit abschließend dargestellt.
Welche Anhänge sind enthalten?
Es gibt Anhänge zu den Auswirkungen des Promillewertes auf den Menschen und zu den Quellen der Zielfindung in den Beispielen.
- Quote paper
- Markus Lamest (Author), 2006, "Ökonomie des Alltags" - Wieviel Bier soll ich heute Abend trinken? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110883