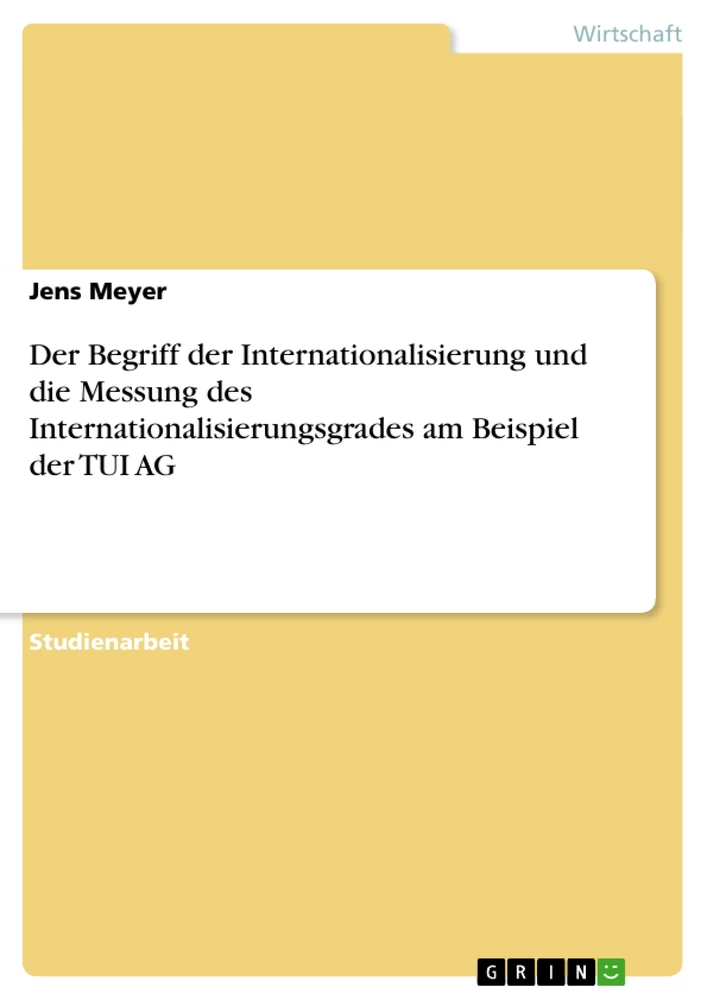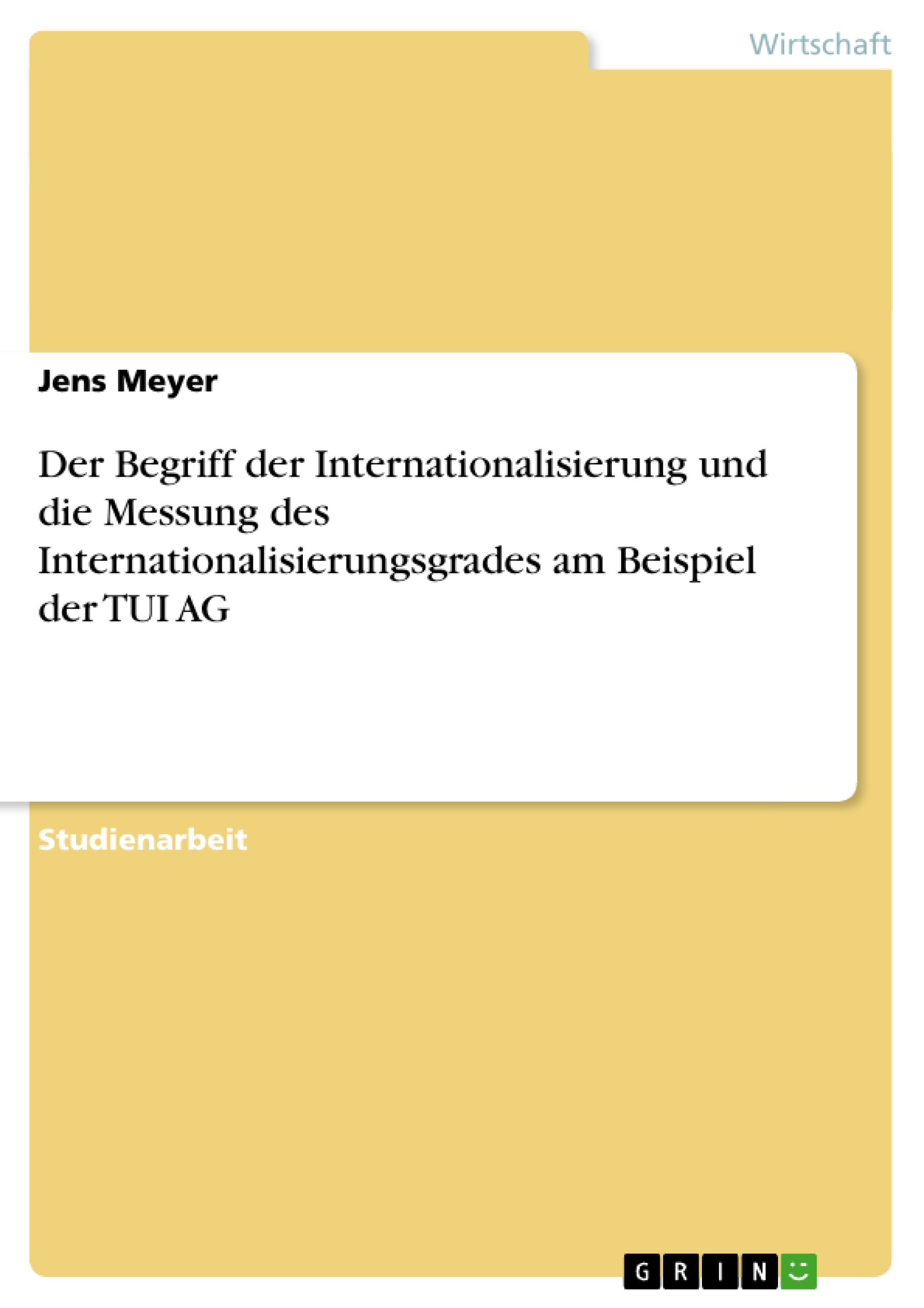Der Prozess der Globalisierung ermöglichte die Evolution der heutigen Global Player. Die Globalisierung wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit als eine wirtschaftliche Entwicklung gesehen, die politischen und ökologischen Dimensionen sollen hier nicht berücksichtigt werden. Die vorliegende Arbeit, soll im weiteren Verlauf, neben der einführenden Beschreibung des Begriffs des Global Players auch die Internationalisierung von Unternehmen sowie die Messung des Internationalisierungsgrades darstellen.
Inhaltsverzeichnis
II. Abbildungsverzeichnis
III. Abkürzungsverzeichnis
1. Der Begriff der Global Player
2. Die Internationalisierung der Wirtschaft
2.1 Motive für eine Internationalisierung
2.2 Chancen und Risiken der Internationalisierung
3. Internationalisierungsformen
3.1 Der Internationalisierungsprozess
3.2 Bestandsgrößen der Internationalisierung
4. Internationalisierungsgrad
4.1 Absolute und relative Merkmale
4.2 Das Internationalisierungsprofil
5. Der Internationalisierungsgrad der TUI AG
5.1 Die Zusammensetzung der Mitarbeiterstruktur der TUI AG
6. Perspektiven der Internationalisierung und Globalisierung
II. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Unternehmenstypen im Kontext zur Verlagerung von Prozessen
Abbildung 2: Motive der Internationalisierung
Abbildung 3: Motive zur Internationalisierung in China
Abbildung 4: Geschäftssysteme
Abbildung 5: Entwicklung der Ein- und Ausfuhr
Abbildung 6: Arbeitslosigkeit: Globalisierung taugt nicht als Buhmann
Abbildung 7: Stufen- und Phasenmodell
Abbildung 8: Vertragssituation der Internationalisierungsform
Abbildung 9: Umsatz nach Regionen
Abbildung 10: Auftragszusammensetzung für das In- und Ausland
Abbildung 11: Internationalisierungsprofil der SIEMENS AG
Abbildung 12: Mitarbeiter nach Spaten
Abbildung 13: Mitarbeiterverteilung Touristik
Abbildung 14: Prozentuale Verteilung der Mitarbeiter der TUI AG
III. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Der Begriff der Global Player
Der Prozess der Globalisierung ermöglichte die Evolution der heutigen Global Player. Die Globalisierung wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit als eine wirtschaftliche Entwicklung gesehen, die politischen und ökologischen Dimensionen sollen hier nicht berücksichtigt werden.
Der Ausdruck Globalisierung und damit auch der Begriff der Global Player wird allgemein seit den 80er Jahren verwendet. Er beschreibt die fortlaufende Verschmelzung der verschiedenen Volkswirtschaften der gesamten Welt. Dabei dienen der Handel und die Finanzströme als entsprechende Mittel. Allerdings kann sich die Globalisierung auch auf die Bewegungen von Menschen, hier als Arbeitskräfte gemeint oder Wissen, in Form von Technologien beziehen.
Als eine Art Basisbeschreibung der Globalisierung kann festgehalten werden, dass durch die technologischen Fortschritte die internationalen Transaktionen im Handel wie auch bei den Finanzströmen schneller und leichter umgesetzt werden sollen.
Die verschiedenen globalen Märkte unterstützen die Unternehmensleistung durch die entstandene Arbeitsteilung, Spezialisierung oder den Wettbewerb.
Gerade die Spezialisierung als ein Teilaspekt der Globalisierung ermöglicht es den Menschen, ihre individuelle Stärke auf dem Markt anzubieten. Die Weltmärkte bieten den Unternehmen wie auch den Menschen größere Möglichkeiten, mehr und wiederum größere Märkte auf der ganzen Welt zu nutzen. Das hat zur Folge, dass die Menschen einen erhöhten Zugang zu Kapitalströmen, Technologien, günstigeren Einfuhren und größeren Exportmärkten haben. Schon hier ist kritisch zu bemerken, dass ein Zugang nur im Einklang mit der erforderlichen Politik des Landes möglich sein kann. Werden seitens der Politik Barrieren errichtet, ist eine Partizipation nicht ausgeschlossen. Häufig ist das bei den armen Ländern dieser Welt mit einer diktatorischen Regierung zu sehen.1
Die vorliegende Arbeit, soll im weiteren Verlauf, neben der einführenden Beschreibung des Begriffs des Global Players auch die Internationalisierung von Unternehmen sowie die Messung des Internationalisierungsgrades darstellen.
Bei dem Gedanken an den Ausdruck des Global Players und der Gleichstellung dessen mit einem Großunternehmen werden Unternehmen wie die DaimlerChrysler AG, General Motors, Microsoft oder Siemens genannt.2 In diesem Zusammenhang ist die Herleitung des Terminus Globalisierung interessant, auf der die Global Player ihr Grundfundament aufbauen. Von dem Ökonom Levitta, T. ist im Jahr 1983 der Begriff der Globalisierung zum ersten Mal verwendet wurden. Dabei stellt die Globalisierung einen Prozess für Unternehmen dar, der u. a. die wirtschaftlichen Grenzen zwischen den einzelnen Staaten aufhebt und so zu einer weltweiten Vernetzung der Wirtschaftseinheiten führt. Die Aufhebung der wirtschaftlichen Grenzen erfolgt durch eine differenzierte geographische Verbreitung der Auslandstätigkeiten der Unternehmen.3 Dies soll anhand eines Beispiels aus der Praxis deutlich gemacht werden. Ein koreanischer Autohersteller ermöglicht die Konzeption und Entwicklung einer neuen Limousine durch eine Finanzierung aus Japan, lässt das Design in Italien anfertigen, den Motor und das Getriebe in Deutschland herstellen. Die Zusammenführung der einzelnen Teile geschieht in Großbritannien durch die Hilfenahme von lohnintensiven Schlüsselkomponenten aus Korea und elektronischen Bauteilen, die in den USA entwickelt aber in China zusammengebaut worden sind.4
Die nachstehende Grafik Nr. 1 soll verdeutlichen, wo der Global Player im Vergleich zu anderen Unternehmenstypen steht und wie die Verlagerung von Unternehmensprozessen im Sinne von überschreiten von Landesgrenzen zu verstehen ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Fleisch, E. / Geginat, J. / Loeser, B. O.: Verlagern oder nicht verlagern? Die Zukunft der produzierenden Industrie in der Schweiz
Der Global Player ist daraus als weniger regional tätig sondern agiert in weltumspannenden Netzwerken. Dies beinhaltet z. B. das Beschaffungen nicht regional oder landesintern sondern vielmehr durch überregionale Strukturen gekennzeichnet sind. Damit einhergehend ist auch, dass der Auslandsumsatz der Unternehmen einen überdurchschnittlich hohen Wert ausmacht.5
2. Die Internationalisierung der Wirtschaft
Schumpeter hatte bereits 1912 mit seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung den einen Beitrag zur Internationalisierung der Wirtschaftssubjekte beigetragen. In seiner Theorie stellte er denjenigen Unternehmen potentiell neue Gewinne in Aussicht, die in einer dynamischen Weiterentwicklung ihrer Tätigkeiten den Schritt auf fremde Märkte wagen. Der von Schumpeter beschriebene Wettbewerbsvorteil sollte sich seiner Meinung nach u. a. aus der Synthese von verschiedenen Faktoren ergeben. Zu diesen Faktoren zählen z. B. innovativere und kostengünstigere Produktionsverfahren. Der dadurch aufkommende Druck für die Konkurrenz führt zu einem weiteren Vorteil der Internationalisierung.6 Die Wertschöpfungselemente7 global zu integrieren und gleichzeitig eine Lokalisierung von Strukturen im Gastland zu koordinieren, gilt als die zu lösende Aufgabe für die Unternehmen im Rahmen der Internationalisierung. Im Verlauf der Internationalisierung sind Fragen der Differenzierung in Bezug auf die Marketing- und Produktionsstrategien zu klären. Weiterführend ist auch die Komplexität der Transport- und Auslieferungsbedingungen oder die Extension der Produktanpassung im jeweiligen Land aktiv zu untersuchen.8
Betrachtet man nun die wirtschaftliche Internationalisierung, so ist sie aus Sicht der Unternehmen mit einer steigenden Intensität des Wettbewerbs zwischen den Wirtschaftssubjekten zu verstehen. Bei den Arbeitnehmern im europäischen Wirtschaftsraum ist in einigen Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit oder wenig gut bezahlten Arbeitsmöglichkeiten ein Kampf um Beschäftigung und aus der Sicht von Unternehmen und nationalen Gesellschaften ein Wettbewerb um das Investitionskapital vorhanden.9 Festgehalten werden kann, dass die Internationalität eines Unternehmen mit dem Grad der im Ausland getätigten Umsätze, der Anzahl der ausländischen Mitarbeiter oder der im Ausland umgesetzten Investitionen steigt.10
2.1 Motive für eine Internationalisierung
Bei der Betrachtung der Motive ist auffällig, dass zwei Beweggründe der
Internationalisierung besonders hervortreten. Hier ist zum einen die Erschließung neuer Märkte zu nennen, die zum Teil durch eine Sättigung der bisherigen Märkte entsteht und zum anderen ist der Erwerb von neuem technischem Wissen als ein weiterer Faktor zu nennen. Allerdings kann sich die Internationalisierung auch aus einer Verknüpfung von vorangestellten Anforderungen an das Unternehmen ergeben. So kann es aufgrund von veränderten Standorten für die Produktion oder den Vertrieb zu einer internationalen Tätigkeit des Unternehmens kommen.11
Diese These wird durch die Annahme von Robinson12 aus dem Jahr 1961 unterstützt. Auch in seinen Ausführungen ist die Erschließung neuer Märkte ein wesentlicher Beweggrund für eine Internationalisierung von Unternehmen. Weiter führt er die Aussicht auf eine höhere Rendite, die Erhaltung bestehender Marktanteile oder die Schaffung einer Exportbasis für benachbarte Länder als Gründe einer Internationalisierungsstrategie an.13
Die Grafik Nr. 2 soll einige der genannten Motive graphisch darstellen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Kreikebaum / Gilbert / Reinhardt: Organisationsmanagement internationaler Unternehmen, S. 10
Abgesehen von der Betrachtung der Produktionsverlagerung und den damit verbundenen Auswirkungen wie der Erlangung von neuem Wissen oder dem Aufbau neuer Absatzmärkte ist auch die Einsparung von Personalkosten als ein weiteres Motiv zur Internationalisierung zu erkennen. Laut dem Fraunhofer Institut aus Karlsruhe waren in den Jahren 1996 bis 1998 die Personalkosten das dominierende Motiv für eine Internationalisierung.14
Für die Investitionstätigkeiten in China, einem der wohl meistbeachteten Globalisierungsländer, ergeben sich aus einer Untersuchung von 1996 verschiedene Operationsfelder, die für Unternehmen ein Motiv und Anreiz für eine Internationalisierung der Geschäftsprozesse darstellen. Neben dem Kundendienst, der Sicherung eines bisherigen Marktanteils, eines Investitions – Enthusiasmus bzw. einer Investitions – Euphorie sind vor allem die Motive der Schaffung einer Exportbasis für Produkte der deutschen Muttergesellschaft, die Ausdehnung auf neue Märkte in Asien und eine Kostensenkung als primäre Motive zu nennen. Die Grafik Nr. 3 stellt die Motive graphisch dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dülfer, E.: Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, S. 94
Im Verlauf der Untersuchung sind die Geschäftssysteme, die in Kapitel 3 im Rahmen der Internationalisierungsformen wiedergegeben werden analysiert wurden. Die Grafik Nr. 4 stellt das Ergebnis der Untersuchung dar:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dülfer, E.: Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, S. 94
Abschließend wird kurz auf die aktive und passive Motivationsgrundlage von Unternehmen für eine Internationalisierungsstrategie eingegangen. Liegen Wettbewerbsvorteile im Inland vor, so könnten diese unter bestimmten Umständen im Ausland ebenfalls genutzt und für die Erreichung neuer Renditeziele eingesetzt werden. In diesem Fall würde das Unternehmen aktiv und aus eigenen Überlegungen heraus die Internationalisierung vorantreiben. Besteht hingegen ein Konflikt zwischen den gesetzten Zielen und den vorhandenen Potentialen im Unternehmen, so ist die Aufnahme neuer Vorgänge nötig, um die Zielvorstellungen nicht nach unten korrigieren zu müssen. Eine Internationalisierung aus diesem Kontext wäre einer passiven Motivationsgrundlage zuzuordnen.
2.2 Chancen und Risiken der Internationalisierung
Die Globalisierung ermöglicht neue Wege im Außenhandel zu gehen und bringt synchron unbekannte Akteure auf den so entstehenden Weltmarkt. Hieraus entstehen im Rahmen des Internationalisierungsprozesses von Unternehmen Chancen aber auch Bedrohungen.15
Bei der Betrachtung von Industrieunternehmen kann als eine Chance der Internationalisierung gesehen werden, dass die Fertigungstiefe der Unternehmen abnimmt. Auf der anderen Seite werden im gleichen Zuge die Lieferanten mit in die Wertekette aufgenommen. Die Folge ist eine Rückführung der Kosten für die Lagerhaltung, den Zeitaufwand oder den eigenen Ressourcen. Ein Beispiel für die Umsetzung der vorangestellten Maßnahmen findet sich in der Automobilindustrie wieder. Hersteller wie Volkswagen, BMW oder Audi arbeiten mit möglichst wenig Zulieferungsunternehmen zusammen, wobei diese neben der Lieferung der Komponenten auch die Entwicklung, Produktion und einen gewissen Grad an Vormontage übernehmen. Produzierende Unternehmen profitieren von einer zunehmenden nationalen Endgrenzung und der damit einhergehenden Vernetzung verschiedener Volkswirtschaften untereinander.16
Die stetig zusammenwachsende internationale Arbeitsteilung führt zu einem anhaltenden positiv wachsenden Verhältnis zwischen den deutschen Ausfuhr- und Einfuhrpreisen. Die Grafik Nr. 5 zeigt diesen Zusammenhang. Die sich aus diesem positiven Verhältnis ergebenden Möglichkeiten lassen es zu, dass durch die höheren Exporterlöse mehr Importe finanziert werden können. Die Folge war, dass Produkte mit dem Prädikat „made in Germany“ teuerer in das Ausland verkauft werden konnten und Importe entsprechender Güter preisgünstiger wurden.17
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Anlage zur Pressemitteilung Nr. 15/2007 des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln zu Pressemitteilung Nr. 15/2007 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
Neben der Betrachtung von Chancen für Unternehmen ergeben sich durch die Internationalisierung auch positive Anzeichen für die Arbeitnehmer in Deutschland. Kam es in der Zeit von 1995 bis 2004 noch zu einem Abbau von Stellen vorzugsweise in den Branchen der Elektroindustrie, der Chemie, dem Maschinenbau oder dem Fahrzeugbau, so konnte im gleichen Zuge eine Verlagerung der wegfallenden Stellen in andere Wirtschaftsbereiche oder zu zuliefernden Unternehmen festgestellt werden.
Die Zahlen des Instituts für Wirtschaft in Köln verzeichnen für den Zeitraum von 1995 bis 2005 für die im Export tätigen Beschäftigten einen Zuwachs von 2,4 Millionen. Die Zahl der Geringqualifizierten ist durch die Globalisierung zurückgegangen. Die Grafik Nr. 6 stellt dies dar:18
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Anlage zur Pressemitteilung Nr. 15/2007 des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln
Allerdings ergeben sich nicht nur Chancen für Unternehmen im Rahmen der Internationalisierung, es kann ebenfalls zu Risiken kommen. Anhand des Geschäftsberichts der STADA Gesundheits AG aus dem Jahr 2006 sollen einige der Risiken aufgezeigt werden. Regulatorische Risiken die sich aus verändernden Vorschriften oder Gesetzen ergeben, können z. B. in diktatorisch geführten Ländern oder stark staatlich geführten Ländern ( siehe China ) zu einem teilweisen oder vollkommenen Verlust führen. Für diejenigen Unternehmen, die nicht Marktführer sind und dennoch eine Internationalisierung anstreben, können sich Nachteile ergeben, wenn Wettbewerber mit höheren finanziellen Ressourcen in den ausländischen Markt eintreten. Aktivitäten dieser Wettbewerber in den Bereichen der Preisfindung, Serviceorientierung, Rabattpolitik oder bei den Lieferbedingungen führen zu einer Drucksituation und einem damit verbundenen Gewinnrisiko. Diese Risiken können im Rahmen der wettbewerbsbedingten Risiken eingestuft werden. Wachstumsbedingte Risiken hingegen ergeben sich aus Engpässen bei den sachlichen und personellen Kapazitäten, den internen Strukturen oder fehlenden Finanzmitteln. Als eine letzte Risikogruppe sollen die rechtlichen Risiken dargestellt werden.
Hier kann es zu der Verletzung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen kommen oder zu Uneinigkeiten über gewerbliche Schutzrechte ( z. B. Patente ).19
3. Internationalisierungsformen
Zu den einzelnen Formen der Unternehmensinternationalisierung gehören der Handel (Exporte, Importe von Rohstoffen und Teilen, Lohnveredelung), die Direktinvestitionen ( Vertrieb, Produktion, Forschung und Entwicklung, Ausländische Montagewerke ), Kooperation mit anderen Unternehmen im Ausland (Strategische Allianzen: Ohne Kapitalbeteiligung oder mit Kapitalbeteiligung (Joint-venture), Lizenzverträge und Franchising oder Tochtergesellschaften. Die Wahl der entsprechenden Internationalisierungsform hängt mit den Motiven und Voraussetzungen des Unternehmens zusammen.20
Die folgende Grafik Nr. 7 stellt das Verhältnis der einzelnen Internationalisierungsform zu der Leistung des Unternehmens im In- bzw. Ausland in einem Stufen- bzw. Phasenmodell dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: : Müller, St. / Gelbrich, K.: Interkulturelles Marketing, S. 725
Die einzelnen Schritte der Internationalisierung können der entsprechenden Vertragssituation und der Art der wirtschaftlichen Internationalisierung zugeordnet werden. In Grafik Nr. 8 ist eine derartige Einteilung dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Marcharzina, K. / Welge, M. K.: Export und Internationale Unternehmung, S. 976
3.1 Der Internationalisierungsprozess
Der Internationalisierungsprozess beginnt in der Regel mit jeder grenzüberschreitenden Tätigkeit des Unternehmens. Häufig ist der Export der erste Schritt in diesem Prozessablauf. Die veränderte Umweltsituation mit den kulturellen, sprachlichen, religiösen oder räumlichen Unterschieden ist hierbei zu berücksichtigen. Weitere Anforderungen an den Internationalisierungsprozess ergeben sich durch das kulturell differente Konsumverhalten in den verschiedenen Ländern. Hier ist auf die Unterschiede nicht nur beim direkten und indirekten Export zu achten, sondern auch bei der Lizenz- oder Franchisevergabe.21
Die Prozessanalyse geht bei der Internationalisierung daher von einem sukzessiven Fortgang der Entwicklung aus. Ein sprunghaftes Verhalten der Unternehmen wird ausgeschlossen.22
Dies wird auch durch die Beschreibung des Internationalisierungsprozesses im Rahmen eines Phasenschemas dokumentiert. Hier wird davon ausgegangen, dass die drei Phasen in einer Beziehung zueinander stehen. Beginnend mit der ersten Phase, der Entschlussphase fortführend mit der zweiten Phase, der Aufbauphase und abschließend mit der dritten Phase, der Betriebs- bzw. Umsetzungsphase.
Der Verlauf des Internationalisierungsprozesses wird dabei von den prozessbegleitenden Umständen beeinflusst. Hierunter fallen zum einen die Marktsituation im Absatzgebiet und das damit verbundenen Potential. Zum anderen die Unternehmenssituation, zu der neben der Unternehmensgröße, die Finanzkraft des Unternehmens sowie die bereits gemachten Erfahrungen des Unernehmens mit Internationalisierungsprozessen zu fassen sind.23
Allerdings ist der Internationalisierungsprozess nicht zu verallgemeinern und der Export als Beginn des Prozesses sowie die Endsituation mit der Gründung einer Tochtergesellschaft gleichzustellen. Eine derartige Darstellung ist aus den vielfältig unterschiedlichen Märkten und deren differenten Absatzpotential nicht möglich. So kann es vorkommen, dass ein Auslandsmarkt für die Gründung einer Tochtergesellschaft zu klein ist, Exporte in den Markt aber eine passende Lösung darstellen.24
3.2 Bestandsgrößen der Internationalisierung
Für eine Unterscheidung der nationalen von den internationalen Unternehmen können verschiedene Attribute herangezogen werden.25 In der vorliegenden Arbeit wird unter 4.2: Absolute und relative Merkmale detaillierter auf die zwei Kriterien eingegangen, während in diesem Kapitel anhand einiger praxisorientierten Beispiele die Bestandsgrößen dargestellt werden.
Bevor aus den Geschäftsberichten der Firmen ADIDAS Group AG, Bayer AG, SIEMENS AG Zahlenbeispiele folgen, erfolgt eine kurze Betrachtung der Bestandsgrößen. Zu der Gruppe der Bestandsgrößen im Rahmen einer Internationalisierung wird die Anzahl der Länder, in denen Betriebsstätten, Niederlassungen, Filialen oder Tochtergesellschaften vorhanden sind, gezählt. Fortführend zählen zu der Gruppe die Anzahl der Länder in denen Geschäftsaktivitäten über Lizenz- oder Franchisegeschäfte abgewickelt werden, die Anzahl der mit dem Ausland vereinbarten Marktbearbeitungsverträge in Form von Joint Ventures, die Zahl der ausländischen Mitglieder im Top Management, wie z. B. im Vorstand eines Unternehmen, der Umfang der direkten oder indirekten Beteiligungen im Ausland oder das im Ausland befindliche Vermögen, hier unterteilt in Umlauf- und Anlagevermögen.
Die genannten Größen sind nicht als komplett anzusehen sondern geben eher einen allgemeinen Überblick der wichtigsten und bekanntesten Kriterien wieder.26
Einige Geschäftsberichte der o. g. Unternehmen geben Aufschluss drüber, wie international die Unternehmen in unterschiedlichen Segmenten aufgestellt sind. Die Mitarbeiter bei der ADIDAS Group AG ( Geschäftsbericht aus dem Jahr 2006 ) setzen sich z. B. wie folgt zusammen:
ADIDAS beschäftigte Mitarbeiter an mehr als 150 Standorten weltweit. Im Jahr 2006 waren 42 % des Personals in Europa, 35 % in Nordamerika, 19 % in Asien und 4 % in Lateinamerika für das Unternehmen beschäftigt. Der aus vier Mitgliedern bestehende Vorstand setzt sich aus zwei deutschen, einem amerikanischen und einem Mitglied aus Neuseeland zusammen.27
Die Bayer AG ( laut Geschäftsbericht von 2006 ) unterhält Geschäftsaktivitäten in den USA, im Euroraum, in Japan, Lateinamerika ( Brasilien: Niederlassungen ), in den Schwellenländern Asiens und in China ( Produktion ). Im Gegensatz zu der ADIDAS Group AG ist der Vorstand weniger international aufgestellt. Hier ist das Gremium, das aus vier Mitgliedern besteht, komplett mit Deutschen besetzt. Die Mitarbeiterstruktur ist aufgrund der weltweiten Geschäftsaktivitäten hingegen international ausgerichtet. So stellt sich das Bild der beschäftigten Mitarbeiter pro Region wie folgt dar: Europa 45.700, Nordamerika 13.100, Fernost / Ozeanien 13.200 und in Lateinamerika / Nahost / Afrika 10.600 (Festanstellungen und befristete Arbeitsverhältnisse). Für die Siemens AG ergibt sich das folgende Bild ( Daten aus dem Geschäftsbericht 2005 ):
Der Konzernumsatz wurde aus den einzelnen Umsätzen der Regionen erzielt. Die Grafik Nr. 9 zeigt die Anteile der entsprechenden Regionen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Geschäftsbericht der SIEMENS AG, 2005, S. 17
Die monetäre Auftragszusammensetzung und die erzielten Umsätze im In- und Ausland zeigt die die nachstehende Grafik Nr. 10:
Quelle: Geschäftsbericht der SIEMENS AG, 2005, S. 94
Die Anzahl der ausländischen Anteilseigner in Form von Aktieninhabern gibt Siemens auf der unternehmenseigenen Internetpräsens wie folgt wieder: „Siemens gehört heute mit rund 800.000 Aktionären aus über 100 Nationen zu den größten Publikumsgesellschaften. Knapp 55 Prozent des Aktienkapitals werden außerhalb Deutschlands gehalten.“28
4. Internationalisierungsgrad
Der Internationalisierungsgrad zeigt, wie das Unternehmen in Relation mit dem Ausland in Bezug auf wirtschaftliche Verflechtungen zu sehen ist. Die Ermittlung der Daten erfolgt durch einen Abgleich der Auslandsaktivitäten des Unternehmens in Bezug auf die im Inland getätigten Aktivitäten. Hieraus ergeben sich allerdings kritische Ansatzpunkte der Betrachtung. Die Beschreibungs- und Erklärungsqualität der entsprechenden Aktivitäten ist hier von großer Bedeutung für ein qualitatives Ergebnis der Berechnung des Internationalisierungsgrad.29
4.1 Absolute und relative Merkmale
Für die Bestimmung des Internationalisierungsgrades werden unterschiedliche Größen oder Aktivitäten herangezogen. Die Absoluten und relativen Merkmale sind für die Abgrenzung von der nationalen zur internationalen und damit für eine Ermittlung des Internationalisierungsgrades von Bedeutung. Zu den absoluten Merkmalen gehören die Bewegungs- und Bestandsgrößen. Einige der Bestandsgrößen sind bereits in Kapitel 3.2 erwähnt und aufgezählt wurden. Der Begriff der Bestandsgröße wird hier noch mal näher dargestellt. Die relativen Merkmale werden durch die Auslandsquote, den Internationalisierungsindex und das Internationalisierungsprofil wiedergegeben. In diesem Kapitel soll das Internationalisierungsprofil nur kurz beschrieben werden, da im folgenden Kapitel 4.2 die aktuellen Geschäftsdaten der TUI AG in ein Internationalisierungsprofil eingearbeitet und dargestellt werden sollen.
Die schon erwähnten Bestandsgrößen ( siehe Kapitel 3.2 Praxisbeispiele ) werden häufig zu Beginn oder Ende eines Kalenderjahres in Form eines Stichtages herangezogen. So kann die Zahl der ausländischen Mitarbeiter im Unternehmen oder das im Ausland vorhandene Vermögen exakt ausgewiesen werden.
Die Bewegungsgrößen als zweite Gruppe der absoluten Merkmale werden nicht zu einem Stichtag sondern für eine Betrachtungsperiode ermittelt. Dabei sind in der Regel die folgenden Attribute wiederzufinden: Die im Ausland erzielten Erlöse, die im Ausland gezahlten Steuern, die im Ausland anfallenden Aufwendungen, der aus dem Ausland stammende Auftragseingang, der im Ausland erzielte Gewinn, das für das Ausland bereitgestellte Budget oder die im Ausland getätigten Investitionen. Da sich die Bewegungsgrößen nicht auf einen Stichtag beziehen, können sie für das gesamte Jahr analysiert werden. Eine Abweichung von der Kalenderjahrbetrachtung hin zu einer quartalsweisen oder monatlichen Analyse ist ebenfalls denkbar. Abhängig von dem jeweilig zu betrachtenden relativen Merkmal können auch größere Zeitintervalle in Form von einer Zusammenfassung von mehreren Kalenderjahren sinnvoll sein.30
4.2 Das Internationalisierungsprofil
Für die Erstellung des Internationalisierungsprofils wird die horizontale Achse mit einer Skalierung von 0% bis 100% versehen. Auf die Senkrechte Achse werden die entsprechenden Merkmale eingetragen, die berücksichtig wurden. Durch die Verbindung der einzelnen Punkte entsteht das Internationalisierungsprofil.31
Die Vorteile liegen in der sehr übersichtlichen Visualisierung des Auslandsengagements des Unternehmens in Bezug auf bestimmte absolute oder relative Merkmale. Dadurch lassen sich bei einer Berücksichtigung verschiedener Zeitperioden die unterschiedlichen Entwicklungen der Unternehmung darstellen. Ein Vergleich von mehreren Unternehmen ist ebenfalls denkbar. Allerdings ist bei einer vergleichenden Gegenüberstellung von Internationalisierungsprofilen verschiedener Unternehmungen kritisch zu beachten, dass sich die Unternehmen nur bedingt ähnlich sind. Besonders entscheidend ist die Strategie des Unternehmens, hier kann es zu großen Abweichungen innerhalb einer identischen Branche kommen.32
Zur Veranschaulichung eines Internationalisierungsprofils soll ein Beispiel anhand der Daten aus dem Geschäftsbericht 1999 der Siemens AG erfolgen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Kutschker, M. / Schmid, St.: Internationales Management, S. 251, Geschäftsbericht der
SIEMENS AG von 1999
5. Der Internationalisierungsgrad der TUI AG
An dieser Stelle soll kritisch angemerkt werden, dass die in Kapitel 4.1 beschriebenen Merkmale zur Beschreibung und Identifikation des Internationalisierungsgrades eines Unternehmens aus den vorliegenden Unterlagen ( Geschäftsbericht der TUI AG für das Jahr 2006 ) nicht hervorgehen. Nach Aussage33 von Herrn Rainer Feuerhake, Finanzvorstand der TUI AG müssen Angaben wie die Anzahl der ausländischen Aktionäre der TUI AG im Verhältnis zu den Aktionären aus Deutschland, die Höhe des Umsatzes der TUI AG bzw. der TUI Deutschland GmbH im In- und Ausland, die Auftragseingänge der TUI AG die aus Deutschland stammen im Verhältnis zu denen aus dem Ausland, die getätigten Investitionen im In- und Ausland ( der TUI AG / TUI Deutschland GmbH ) oder die Höhe der Ertragssteueraufwendungen im In- und Ausland der TUI AG und TUI Deutschland GmbH erst rechnerisch ermittelt werden.
Aus dem vorliegenden Jahresabschlußbericht 2006 konnte lediglich ermittelt werden, wie international die Zusammensetzung des TUI AG Vorstandes ist. Hier zeigt sich allerdings, dass wenig Internationalisierung in der obersten Führungsetage der TUI AG vorherrscht. Von den sieben Vorstandsmitgliedern ist nur ein Mitglied, Peter Rothwell als Vorstandsmitglied für den Bereich Touristik, nicht aus Deutschland. Die Mitarbeiterstruktur der TUI AG wird im anschließenden Kapitel 5.1 behandelt.
5.1 Die Zusammensetzung der Mitarbeiterstruktur der TUI AG
Die Mitarbeiterstruktur der TUI AG wird anhand des vorliegenden Geschäftsberichtes des Unternehmens aus dem Jahr 2006 dargestellt. Da hier von der Konzernbelegschaft ausgegangen wird, ist auch die zweite Branche des Konzerns, die Schifffahrt, mit einbezogen wurden. In der Grafik Nr. 8 ist dargestellt, wie sich die Mitarbeiter auf die verschiedenen Bereiche des Konzerns aufteilen. Die Sparte des Zentralbereichs beschreibt hier, wie die zahlenmäßige Mitarbeiterzusammensetzung in Deutschland, dem Stammland des Konzerns, ausgerichtet ist. Die Gesamtzahl von 950 Mitarbeitern in diesem Bereich kann nochmals in zur Zeit 400 Mitarbeiter bei der TUI AG, 380 Mitarbeiter bei der TUI Deutschland GmbH, 100 Mitarbeiter bei der ROBINSON Club GmbH und 70 Mitarbeitern bei IT unterstützenden Unternehmen aufgeteilt werden.34
Für einen Überblick der einzelnen Sparten dient die Grafik Nr. 11:
Quelle: Geschäftsbericht 2006, TUI AG, S. 101
Die jeweiligen Größen werden in Grafik Nr. 12 in eine prozentuale Relation gebracht. Hier ist zu erkennen, dass der Bereich der Zielgebiete, der die vor Ort angebotenen Dienstleistungen ( z. B. Transferleistungen, Ausflüge, etc. ) beinhaltet, mit 26% einen großen Teil der Gesamtbelegschaft ausmacht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung der Zahlen aus dem Geschäftsbericht der TUI AG, 2006,S. 101
Interessanter gestaltet sich die Betrachtung der internationalen Belegschaft. Auch hier wurden die Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2006 der TUI AG herangezogen. Der Mitarbeiterschwerpunkt der TUI AG liegt dabei mit 86% in Europa ( siehe auch die Aufteilung der Mitarbeiterstruktur von Europa in Grafik Nr. 10 ). Von den 86% der in Europa beschäftigten Mitarbeiter waren in 2006 im Stammland Deutschland 21% angestellt.
Die weitere Aufteilung für Europa ergibt sich wie folgt: In Großbritannien waren 24% tätig, in Frankreich 13% und den Benelux – Ländern, in Spanien 14% und in den Nordischen Ländern 3%.35 In Grafik Nr. 13 wird die prozentuale Verteilung unter Einbeziehung von Amerika und den übrigen Ländern visualisiert dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung der Zahlen aus dem Geschäftsbericht der TUI AG, 2006, S. 102
6. Perspektiven der Internationalisierung und Globalisierung
Die Globalisierung und die damit einhergehende Entwicklung und Fortführung der Internationalisierung bietet ein großes Spektrum der verschiedensten Chancen für ein weltweit dynamisches Wirtschaftsumfeld. Allerdings muss kritisch beobachtet werden, ob die Entwicklung gleichmäßig verläuft oder ob es in einigen Bereichen zu großen Differenzen kommt. An erster Stelle sind hier sicherlich die armen, schwachen und nicht so weit sozialisierten und demokratisierten Länder, wie Indien, Ruanda und andere Schwellenländer zu nennen. Die Gefahr ist, dass in diesen Ländern bedingt durch eine diktatorische Regierung die Integration in die dynamische weltweite Wirtschaftsentwicklung nicht stattfindet. In diesen Ländern geht das Verhältnis von arm und reich immer weiter auseinander, dass Wachstum stagniert und die Inflation steigt.
Die Region Ostasiens hat es gezeigt, wie durch eine offen ausgerichtete Politik, die Armut und der Rückstand durch die Folgen der Globalisierung vermindert werden kann.
Die Kehrseite des großen Potentials das durch die Globalisierung entfaltet werden kann, zeigte sich in dem Zusammenbruch der New Economy. In Deutschland war es zu sehen an dem Einbruch der Kurse am neuen Markt. Die Kapitalströme haben keine Heimat und befinden sich ständig in Bewegung. So entstehen durch die Chancen der Globalisierung auf der Kehrseite auch Risiken.
Es ist kritisch zu betrachten, dass einige Unternehmen bei Direktinvestitionen im Rahmen der Internationalisierung zwar die billigen Arbeitnehmer oder Subventionen in Anspruch nehmen, aber das Land in dem investiert wird, die Wirtschaft und schlussendlich die Menschen in Form von höherem Einkommen von dem Wissen und den Innovationen der Unternehmen, die investieren nicht partizipieren.
Diese Annahme bestätigen die Angaben aus dem World Economic Outlook von 2007. Im Rahmen der dort untersuchten 42 Länder, die nahezu 90% der Weltbevölkerung ausmachen, wurde ermittelt, dass im 20. Jahrhundert das Pro -Kopf - Einkommen stark gestiegen ist.
Es kommt allerdings zu großen Unterschieden zwischen den Ländern. Die Analyse der 42 Länder macht deutlich, dass das Pro – Kopf – Einkommen zwar gestiegen ist, die Einkommensgefälle zwischen den Reichen und den Armen aber zunehmend größer werden.
Unbestritten sind die Wettbewerbsvorteile, die sich für die deutschen Unternehmen durch die Globalisierung ergeben. Durch die Nutzung von Kostenvorteilen im Personalbereich oder durch die Ansiedlung verschiedener Aktivitäten im Ausland können Wettbewerbsvorteile für die Unternehmen entstehen. Hier liegt jedoch die Gefahr für die Länder, in denen die Kostenvorteile aufgrund z. B. niedriger Löhne genutzt werden. Das Beispiel des Sportartikelherstellers NIKE ist nur eines von vielen. In den Produktionsstätten von NIKE im Ausland müssen die Arbeiter 15, 16 oder mehr Stunden weit unter dem Standard der westlichen Arbeitsbedingungen arbeiten. Niedriger Lohn ist inbegriffen.
Die Wertschöpfung hingegen fließt zu den großen Unternehmen ab, die einfachen Mitarbeiter im Produktionsland profitieren nur in einem sehr geringen Maß davon.
Die Perspektiven der Globalisierung dürfen durchaus als positiv gesehen werden. Allerdings ist es notwendig, dass die Partizipation der Globalisierungsteilnehmer gleichförmig verläuft, da ansonsten die Spanne zwischen den Ländern, die durch die Globalisierung profitieren und den Ländern, die ausgenutzt werden, zunehmend größer wird.
Literaturverzeichnis
Dülfer, E. (1999)
Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, München/Wien: R. Oldenbourg Verlag
Macharzina, K. / Welge, M. (1989)
Export und Internationale Unternehmung, Stuttgart: C. E. Poeschel Verlag
Müller, St. / Gelbrich, K. ( 2004)
Interkulturelles Marketing, München: Franz Vahlen Verlag
Kreikebaum, H. / Gilber, D. / Reinhartd, G. (2002)
Organisationsmanagement internationaler Unternehmen, Wiesbaden: Gabler Verlag
Kutschker, M. / Schmid, St. (2002)
Internationales Management, München/Wien: R. Oldenbourg Verlag
Berger, R. (1997)
Chancen und Risiken der Internationalisierung aus Sicht des Standortes Deutschland. In: Krystek, U. / Zur, E. ( Hrsg.): Internationalisierung – Eine Herausforderung für die Unternehmensführung -, Berlin: Springer Verlag, Seiten 19 - 33
Periodika, Dissertationen und Internetartikel:
Rohleder, C. (2004)
Globalisierung, Tertiarisierung und multinationale Unternehmen -Eine international vergleichende Analyse zur Diskordanz von wirtschaftlicher und politischer Entwicklung, Universität Köln
Kinkel, St. / Wengel, J. (1998)
Produktion zwischen Globalisierung und regionaler Vernetzung, Fraunhofer Institut
Universität St. Gallen: Projekterkenntnisse - Auszug : „Internationalisierung der Wertschöpfungskette“
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 18/00
http://www.iwkoeln.de ( Abruf: 02.05.2007 ): Globalisierung - Vorlaute Unkenrufe –
Anlage zur Pressemitteilung Nr. 15/2007 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 15/2007 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/deu/041200g.htm#II ( vom 30.04.07 )
Globalisierung: Bedrohung oder Chance? Der IWF-Stab 12. April 2000
http://www.adidas-group.com/de/overview/executive_board/default.asp ( Abruf: 02.05.2007 )
Portrait SIEMENS AG auf http://www.siemens.de ( Abruf: 04.05.07 )
Geschäftsberichte
Geschäftsbericht 2006, TUI AG
Geschäftsbericht aus 2006, STADA Gesundheits AG
Quellenverzeichnis:
http://www.iwkoeln.de ( Abruf: 02.05.2007 ): Globalisierung - Vorlaute Unkenrufe –
Anlage zur Pressemitteilung Nr. 15/2007 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 15/2007 des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/deu/041200g.htm#II ( vom 30.04.07 )
Globalisierung: Bedrohung oder Chance? Der IWF-Stab 12. April 2000
http://www.adidas-group.com/de/overview/executive_board/default.asp ( Abruf: 02.05.2007 )
Portrait SIEMENS AG auf http://www.siemens.de ( Abruf: 04.05.07 )
[...]
1 Vgl. http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/deu/041200g.htm#II ( vom 30.04.07 )
2 Vgl. H. Kreikebaum / D. U. Gilbert / G. O. Reinhardt: Organisationsmanagement internationaler Unternehmen, S. 7
3 Vgl. Rohleder, C.: Globalisierung, Tertiarisierung und multinationale Unternehmen, S. 52
4 Vgl. Berger, R.: Chancen und Risiken der Internationalisierung aus Sicht des Standortes Deutschland, S. 19 In: Krystek / Zur: Internationalisierung eine Herausforderung für die Unternehmensführung
5 Vgl. Kinkel, St. / Wengel, J.: Produktion zwischen Globalisierung und regionaler Vernetzung, S. 6
6 Vgl. Rohleder, C.: Globalisierung, Tertiarisierung und multinationale Unternehmen, S. 114
7 Wertschöpfungselemente können u. a. Bestandteile der Produktion von Gütern sein
8 Vgl. Universität St. Gallen: Internationalisierung der Wertschöpfungskette, S.
9 Vgl. Streeck, W. / Hassel, A.: Eine quantitative Analyse des Einflusses der Internationalisierung auf das deutsche System industrieller Beziehungen
10 Vgl. Hassel, A. / Kurdelbusch, A. / Höpner, M. / Rehder, B. / Zugehör, R.: Dimensionen der Internatio nalisierung, S. 15
11 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Wochenbericht 18/00
12 Vgl. Robinson, H. J.: The Motivation and Flow of Private Foreign Investment, 1961
13 Vgl. Dülfer, E.: Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, S. 92
14 Vgl. Fraunhofer Institut, Produktion zwischen Globalisierung und regionaler Vernetzung, S. 4
15 Vgl. Globalisierung - Vorlaute Unkenrufe -: http://www.iwkoeln.de ( Abruf: 02.05.2007 )
16 Vgl. Krystek / Zur: Internationalisierung eine Herausforderung für die Unternehmensführung, S. 22
17 Vgl. Globalisierung - Vorlaute Unkenrufe -: http://www.iwkoeln.de
18 Vgl. Globalisierung - Vorlaute Unkenrufe -: http://www.iwkoeln.de
19 Vgl. STADA Gesundheits AG, Geschäftsbericht aus 2006, S. 77 ff.
20 Vgl. Kulke, E. (Hrs.): Wirtschaftsgeographie Deutschlands, Gotha 1998, S. 106
21 Vgl. Dülfer, E.: Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, S. 101
22 Vgl. Kutschker, M. / Schmid, St.: Internationales Management, S. 450
23 Vgl. Marcharzina, K. / Welge, M. K.: Export und Internationale Unternehmung, S. 975
24 Vgl. Kreikebaum, H. / Gilbert, D. U. / Reinhardt, G. O.: Organisationsmanagement internationaler Unternehmen, S. 11
25 Vgl. Kutschker, M. / Schmid, St.: Internationales Management, S. 243
26 Vgl. Kutschker, M. / Schmid, St.: Internationales Management, S. 243
27 Vgl. http://www.adidas-group.com/de/overview/executive_board/default.asp ( Abruf: 02.05.2007 )
28 Vgl. Portrait SIEMENS AG auf http://www.siemens.de ( Abruf: 04.05.07 )
29 Vgl. Marcharzina, K. / Welge, M. K.: Export und Internationale Unternehmung, S. 975
30 Vgl. Kutschker, M. / Schmid, St.: Internationales Management, S. 243 ff.
31 Vgl. Marcharzina, K. / Welge, M. K.: Export und Internationale Unternehmung, S. 966
32 Vgl. Kutschker, M. / Schmid, St.: Internationales Management, S. 251 ff.
33 Telefonat mit Herrn Feuerhake am 30.04.2007
34 Vgl. Geschäftsbericht 2006, TUI AG, S. 101
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Begriff des Global Player laut dieser Analyse?
Die Analyse beschreibt Global Player als Unternehmen, die durch die Globalisierung entstanden sind, welche als wirtschaftliche Entwicklung verstanden wird. Globalisierung beschreibt die fortlaufende Verschmelzung der verschiedenen Volkswirtschaften der Welt durch Handel, Finanzströme und Bewegungen von Menschen und Wissen.
Welche Motive für eine Internationalisierung werden genannt?
Die Haupmotive sind die Erschließung neuer Märkte (teilweise wegen Sättigung der bisherigen Märkte) und der Erwerb von neuem technischem Wissen. Weitere Motive sind veränderte Standorte für Produktion/Vertrieb, höhere Rendite, Erhaltung von Marktanteilen, Schaffung einer Exportbasis für Nachbarländer, und Einsparung von Personalkosten.
Welche Chancen und Risiken der Internationalisierung werden aufgeführt?
Chancen: Reduzierte Fertigungstiefe, Aufnahme von Lieferanten in die Wertschöpfungskette, Kostenreduktion, Vernetzung verschiedener Volkswirtschaften, positiver Einfluss auf Ausfuhr- und Einfuhrpreise, Schaffung neuer Arbeitsplätze im Exportbereich. Risiken: Regulatorische Risiken (Gesetzesänderungen), Wettbewerbsrisiken (stärkere Konkurrenz), wachstumsbedingte Risiken (Engpässe bei Kapazitäten), rechtliche Risiken (Verletzung von Geschäftsgeheimnissen).
Welche Internationalisierungsformen werden unterschieden?
Genannt werden Handel (Exporte, Importe, Lohnveredelung), Direktinvestitionen (Vertrieb, Produktion, F&E), Kooperationen (strategische Allianzen, Joint Ventures), Lizenzverträge, Franchising und Tochtergesellschaften.
Wie wird der Internationalisierungsprozess beschrieben?
Der Prozess beginnt mit grenzüberschreitenden Aktivitäten, oft Export. Er beeinflusst die Umweltsituation durch kulturelle und sprachliche Unterschiede. Es wird ein sukzessiver Fortschritt angenommen, beginnend mit einer Entschlussphase, gefolgt von einer Aufbauphase und schließlich einer Betriebs- bzw. Umsetzungsphase. Marktsituation und Unternehmenssituation beeinflussen den Verlauf.
Welche Bestandsgrößen der Internationalisierung werden genannt?
Die Anzahl der Länder mit Betriebsstätten, Niederlassungen, Filialen oder Tochtergesellschaften; Anzahl der Länder mit Lizenz- oder Franchisegeschäften; Anzahl der Marktbearbeitungsverträge (Joint Ventures); Zahl ausländischer Top-Managementmitglieder; Umfang der Beteiligungen im Ausland; Vermögen im Ausland.
Wie wird der Internationalisierungsgrad ermittelt?
Durch einen Abgleich der Auslandsaktivitäten des Unternehmens mit den Inlandaktivitäten. Es werden absolute (Bewegungs- und Bestandsgrößen) und relative (Auslandsquote, Internationalisierungsindex, Internationalisierungsprofil) Merkmale betrachtet.
Was ist ein Internationalisierungsprofil?
Eine graphische Darstellung des Auslandsengagements eines Unternehmens in Bezug auf bestimmte Merkmale. Es visualisiert die Entwicklung im Zeitverlauf und ermöglicht Vergleiche zwischen Unternehmen.
Wie international ist die TUI AG laut dieser Analyse?
Laut Analyse des Geschäftsberichts der TUI AG für das Jahr 2006, ist die Zusammensetzung des Vorstands wenig international. Allerdings ist die Mitarbeiterstruktur international ausgerichtet, mit dem Schwerpunkt in Europa. Der Bereich der Zielgebiete macht einen großen Teil der Gesamtbelegschaft aus.
Welche Perspektiven der Internationalisierung und Globalisierung werden diskutiert?
Die Globalisierung bietet Chancen für ein dynamisches Wirtschaftsumfeld, aber es besteht die Gefahr, dass arme und diktatorische Länder nicht ausreichend integriert werden. Ungleichmäßige Verteilung der Gewinne, Ausnutzung niedriger Löhne ohne angemessene Beteiligung der lokalen Bevölkerung an Wissen und Innovationen, und die Notwendigkeit einer gleichmäßigeren Partizipation aller Globalisierungsteilnehmer werden kritisch betrachtet.
- Quote paper
- Jens Meyer (Author), 2007, Der Begriff der Internationalisierung und die Messung des Internationalisierungsgrades am Beispiel der TUI AG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110811