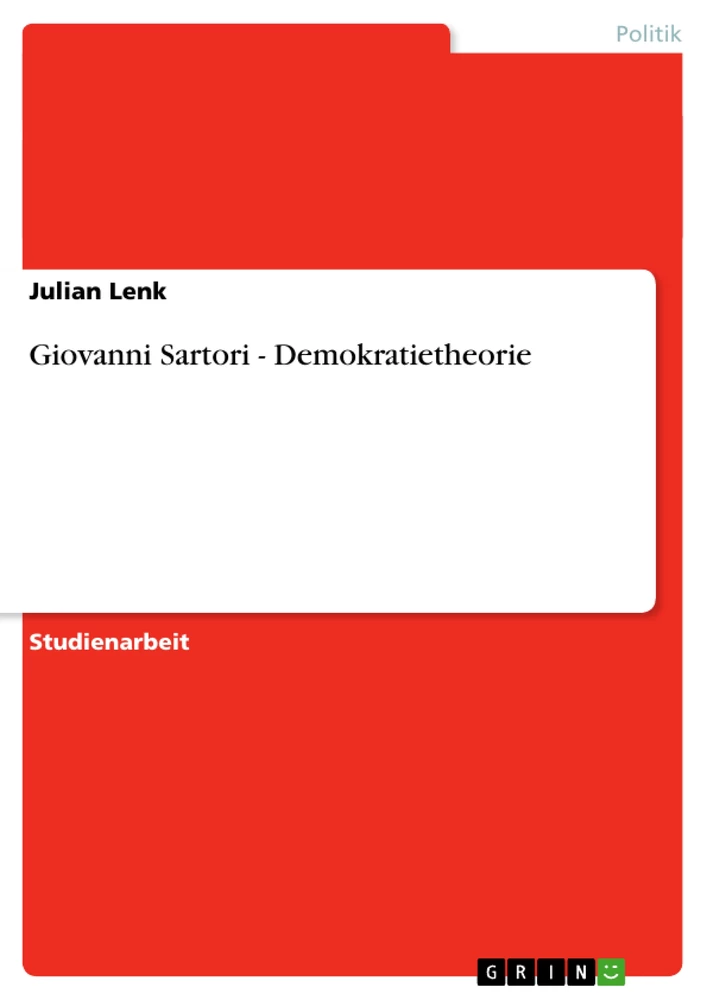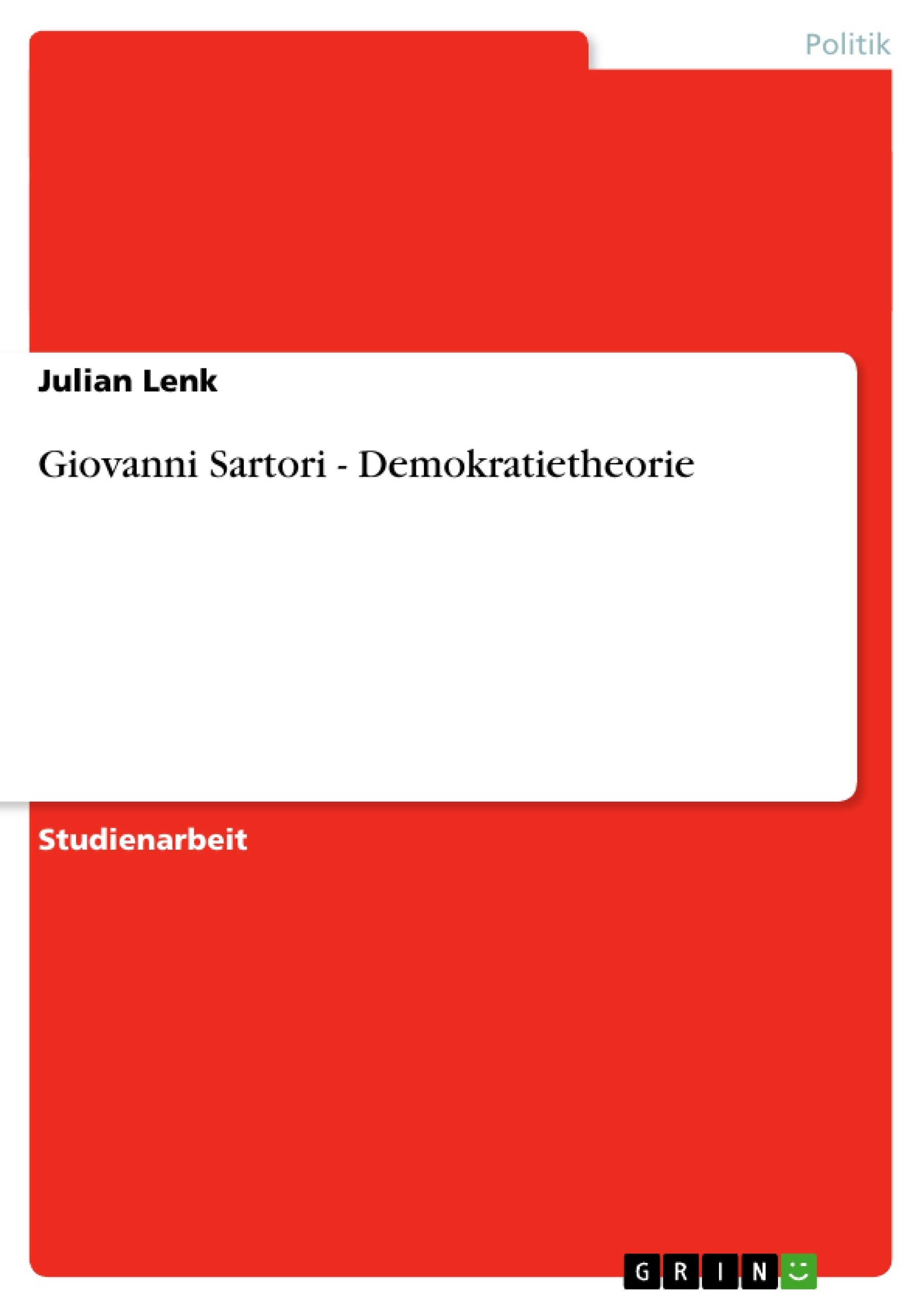Der vorliegende Text (Seite 1 – 120) aus dem Buch „Demokratietheorien“ von Giovanni Sartori, handelt von grundlegenden Annahmen und Voraussetzungen, die Sartori bei der Bearbeitung seiner Demokratietheorie für wichtig erachtet. Es ist die Basis auf der Sartori seine eigene Demokratietheorie ausarbeitet. Sartori besteht auf eine argumentativ absolut schlüssigen Argumentationsform und einer strikten Trennung von normativer- und empirischer Theorie und baut sein gesamtes Buch nach diesem Schema auf. Somit ist der hier bearbeitete Teil Grundlage um Sartoris Theorieansatz zu verstehen. Beide Grundcharakteristika können durch den gesamten Verlauf des Buches immer wieder anhand von Einzelbeispielen nachvollzogen werden.
Gliederung:
2 Vorbemerkung
Zur Stellung des Texts im Gesamtwerk
Zur Vorgehensweise
2 Grundlegende Annahmen und Voraussetzungen
Argumentative Demokratietheorie
Eine Näherung an den Bergriff Demokratie
Etymologische Näherung
Macht
2.2.3.3 Massengesellschaft
Die Lincolnsche Formel
Trennung von normativer- und empirische Theorie
Idealismus
3. Literaturangaben
2 Vorbemerkung
Zur Stellung des Texts im Gesamtwerk
Der vorliegende Text (Seite 1 - 120) aus dem Buch „Demokratietheorien“ von Giovanni Sartori, handelt von grundlegenden Annahmen und Voraussetzungen, die Sartori bei der Bearbeitung seiner Demokratietheorie für wichtig erachtet. Es ist die Basis auf der Sartori seine eigene Demokratietheorie ausarbeitet. Sartori besteht auf eine argumentativ absolut schlüssigen Argumentationsform und einer strikten Trennung von normativer- und empirischer Theorie und baut sein gesamtes Buch nach diesem Schema auf. Somit ist der hier bearbeitete Teil Grundlage um Sartoris Theorieansatz zu verstehen. Beide Grundcharakteristika können durch den gesamten Verlauf des Buches immer wieder anhand von Einzelbeispielen nachvollzogen werden.
Zur Vorgehensweise
Die Reihenfolge, in der die besprochenen Kapitel im Text aufgebaut sind, erscheint mir streckenweise nicht unbedingt als die methodisch Sinnvollste. Ich habe daher entschieden, die Besprechung des Textes nicht an dieser Abfolge entlang, sondern auf andere Weise zu ordnen (siehe Gliederung).
Die zwei Grundannahmen: a) Trennung von normativer- und empirischer Theorie und
b) die Argumentative Demokratietheorie, werde ich im Folgenden herausarbeiten und anhand von Beispielen zeigen, wie Sartori diese Grundannahmen anwendet und welche Komplexität sich daraus ergibt.
Wichtig wäre es zu erwähnen, dass sich die verwendete Sekundärliteratur bei der Bearbeitung auf eine knappe Interpretation Sartoris „Liberaler Elitetheorie“ von Peter Massing (2004, in „Demokratietheorien, von der Antike bis zur Gegenwart“) beschränkt. Ich bin dem Problem der äußerst beschränkten Quellenanzahl ausgeliefert.
2 Grundlegende Annahmen und Voraussetzungen
Argumentative Demokratietheorie
Sartori geht davon aus, dass es nach dem Ende der Studentenbewegung in den 60’er Jahren, welche gute Ideen hatte, jedoch nichts Produktives zu Tage gefördert hat und von einer starken Diskussionskultur geprägt war, keinen informierten Bürger mehr gibt (vgl. Sartori, 1992, 3), da die real existierende Demokratie nicht mehr durch ein theoretisches, für den Bürger verständliches, Fundament untermauert sei.
Gleiches gilt für die „neue, erregende Kreativität“ (Sartori, 1992, 3) der Demokratietheorie der 80’er Jahre.
„Doch es bleibt dabei, dass sich aus dieser neuen Literatur keine ausgewachsene Theorie der Demokratie ergibt“ (Sartori, 1992, 3). Bezeichnender Weise benennt Sartori sein erstes Kapitel auch „Das Zeitalter der verworrenen Demokratie“ (Sartori, 1992, 11). Im allgemeinen Verständnis bezeichnet der Begriff Demokratie heute eher eine Zivilisationsform als eine Staatsform, was zu Verwirrung führt. „Demokratie“ ist im Wortgebrauch positiv belegt. Das hat zur Folge, dass sich viele Staatsformen demokratisch nennen, die diesem Anspruch jedoch nicht genügen.
Deshalb plädiert Sartori für eine neue argumentative Demokratietheorie, die in ihrer Begriffdefinition eindeutig ist (vgl. Sartori, 1992, 1) und sich durch eine logische Diskussionsform (vgl., Sartori, 4) auszeichnet. Ohne jedoch eine präskriptive Vorstellung von Demokratie zu haben ist es unmöglich den Demokratisierungsgrad einzuschätzen. Betrachte man die Aussage „Der Sozialismus ist der liberalen Demokratie überlegen“ (Sartori, 1992, 22), fällt auf, dass es keinen Sinn machen kann eine normative Vorstellung der liberalen Demokratie mit dem real existierenden Sozialismus zu vergleichen. Die Ebenen des Vergleichs, empirisch mit empirisch, normativ mit normativ und Umsetzungsgrad mit Umsetzungsgrad müssen beachtet werden. Sonst, so Sartori, „laufen wir alle auf die Dauer Gefahr, etwas abzulehnen, was wir gar nicht richtig identifiziert haben, und dafür etwas zu bekommen, was wir bestimmt nicht wollen.“ (Sartori, 1992, S. 22). Sicherlich führte Sartoris Engagement in der Forschungsgruppe „Comitee on Conceptual and Terminoligical Analysis“
(COCTA) im Rahmen der „International Political Science Association“, welche sich mit der Offenheit der natürlichen Sprache im Gegensatz zur Geschlossenheit der naturwissenschaftlichen Sprache befasste (P. Massing/G. Breit (Hrsg.), 2004, S. 207), zu einer verstärkten Sensibilisierung gegenüber der etymologischen Bedeutung zentraler Begriffe in der Demokratie.
Eine Näherung an den Bergriff Demokratie
Sartori versucht als Lösungsansatz für die sprachliche Verwirrung, eine Annäherung an den Demokratiebegriff aus vier Richtungen. Erstens aus der Richtung der reinen, etymologischen Wortbedeutung, zweitens vom Machtbegriff aus, drittens vom Volk in der Massengesellschaft und viertens von der „Lincolnschen Formel“.
Etymologische Näherung
Nach Sartori ist die historische Entwicklung eines Begriffs wichtig, da er eine verlässliche Ausgangsbasis bietet. Verzichtet man auf diese Analyse, „verzichtet man auf einen Kompaß bei einer gefährlichen Seefahrt“ (Sartori, 1992, 29). Deshalb untersucht Sartori den aus „Demos“ abgeleiteten Begriff „Volk“. Es gibt nicht weniger als sechs Deutungen von „Volk“:
1. Volk als buchstäblich jedermann,
2. Volk als ein unbestimmter großer Teil, sehr viele,
3. Volk als Unterschicht,
4. Volk als unteilbare Einheit, als organisches Ganzes,
5. Volk als größerer Teil im Sinne eines absoluten Mehrheitsprinzips,
6. Volk als größerer Teil im Sinne eines eingeschränkten Mehrheitsprinzips (vgl. Sartori, 1992, 30).
Bezeichnet man jedoch „Volk“ als buchstäblich jedermann, muss man, historische Tatsachen betrachtet, zugeben, dass es diesen Zustand nie gegeben hat. Ausgeschlossen waren sowohl in Athen, Sklaven, Frauen, Mitöken, u.a. als auch Heute, Minderjährige, Wohnsitzlose, Geisteskranke, u.a. Die Deutungsmöglichkeit „Volk als ein unbestimmter großer Teil“ verwirft Sartori, mit der Frage: „wie viele bezüglich welcher Gesamtheit?“ (Sartori, 1992, 31), ebenso als zu ungenau.
Die dritte Möglichkeit eröffnet zwar eine klare Unterscheidung, wird jedoch hinfällig in dem Moment, indem sich eine Mittelschicht etabliert und die Grenzen zunehmend ungenau werden. Zudem schließt diese Unterscheidung jeden aus, der sich nicht zur Unterschicht zählen kann. Auch die vierte Auslegung bereitet Schwierigkeiten. Sie unterstellt einen Gemeinwillen, wie er bei Rousseaus Vertragsauffassung der Gesellschaft vorkommt und ist damit mehr eine Legitimation „totalitärer Autokratien, nicht von Demokratien“ (Sartori, 1992, 32). Der fünften Wortbedeutung geht es ähnlich. Das „absolute Mehrheitsprinzip“ birgt mehrere Gefahren für die Demokratie. Nach diesem Prinzip hat eine Mehrheit, welche einmal die Macht errungen hat, erstens die Möglichkeit, sich dauerhaft an dieser zu halten und zweitens ein absolutes Recht für alle, also auch die Minderheit, zu entscheiden. Dies kann zu gespaltenen Gesellschaften, sowie Minderheitenverfolgung führen. Ändert ein Individuum der Mehrheit seine Meinung, wird es zur Minderheit und hat die Chance auf Machtausübung verloren. Das beschränkte Mehrheitsprinzip ist nicht mehr gleich dem Volkswillen, weil der Volkswille durch Regeln die nicht dem Mehrheitswillen entsprechen begrenzt wird. Die Denotation des Begriffs „Volk“ ist als „Volk als größerer Teil im Sinne eines eingeschränkten Mehrheitsprinzips“, bestimmt. Denn ohne einen Souverän, der sich aus Mehrheit und Minderheit zusammensetzt, kann man nicht von einem Volkswillen sprechen. „Bei näherer Betrachtung erweist sich also das beschränkte Mehrheitsprinzip als die demokratische Verfahrensregel der Demokratie“ (Sartori, 1992, 33).
Macht
Sartori gibt folgende Definition von politischer Macht, nach der „Macht stets die Kraft und Fähigkeit ist, andere zu lenken - einschließlich der Verfügung über ihr Leben und der Möglichkeit, sie töten zu lassen“ (Sartori, 1992, 38). Hierbei gilt es zu beachten: „Die wichtigste Unterscheidung bei der Macht ist die zwischen den nominellen und den tatsächlichen Inhabern der Macht“ (Sartori, 1992, 38). Zwischen Beiden muss jedoch ein Zusammenhang bestehen. Dieser wird durch die Art der Übertragung der Macht und die echte Fähigkeit zu repräsentieren sichergestellt. Die Übertragung der Macht muss durch Wahlen erfolgen, weil „in der ganzen Geschichte […] schrankenlose Herrscher ebensosehr durch Wahlen wie durch nackte Gewalt und Erbfolge in den Sattel gehoben“ (Sartori, 1992, 39) wurden. Beispiele aus dem Mittelalter zeigen, dass Repräsentation durchaus auch „den monarchischen Absolutismus als ständige, unwiderrufliche Repräsentation legitimieren [kann, J.L.] - und sie tat es auch“.
Die Übertragung der Macht muss also durch freie Wahlen erfolgen und die verbürgte Fähigkeit haben zu repräsentieren.
Massengesellschaft
Das Volk in der Massengesellschaft ist im Vergleich zur Polis, in der der „Demos“ eine überschaubare Bürgerschaft war, heute „ein amorphes Etwas, eine höchst diffuse, atomisierte und letztlich anomische Gesellschaft“ (Sartori, 1992, 34). Das Konstrukt der heutigen Gesellschaft, auch „Megapolis“, ist viel heterogener und abstrakter als dies im alten Griechenland der Fall gewesen wäre. Drei sozialwissenschaftliche Faktoren sind dabei ausschlaggebend. Der naheliegendste ist augenscheinlich der Größenfaktor. Er führt zu Anonymisierung und beschränkt das „Gefühl der individuellen Wirkungsmöglichkeit“ (Sartori, 1992, 35). Der Mensch fühlt sich auf Grund der großen Masse an Mitbestimmenden als klein und unbedeutend. Zwei weitere Umstände führen speziell zur einem Gefühl der Entwurzelung. Die Geschwindigkeit der Entwicklung, sowie die horizontale Mobilität (vgl. Sartori, 1992, 35f.). Mit „Geschwindigkeit der Entwicklung“ meint Sartori konkret die technische und soziale Entwicklung unserer Zeit. Man lebt als Erwachsener nicht mehr in der technisch gleichen Welt in der man geboren wurde, soziale Gefüge ändern sich schnell. „Horizontale Mobilität“ umschreibt einen Prozess der Entwurzelung aus der Gemeinschaft in der man geboren wurde. Viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens gezwungen ihren Heimatort zu verlassen. „In den westlichen Gesellschaften leben und sterben immer weniger Menschen dort, wo sie geboren wurden“ (Sartori, 1992, 35). Sartori umschreibt diesen Prozess salopp mit der Formulierung: „Kurz, die Primärgruppen-Nestwärme unseres Lebens ist dahin; die Anpassung an ständig rasch veränderliche Verhältnisse ist ein anstrengendes Rennen, bei dem mancher im Straßengraben endet“ (Sartori, 1992, 35).
Die drei genannten Faktoren führen mutmaßlich zu einem isolierten, einsamen und damit leicht zu manipulierenden Menschen. Hier sieht Sartori die Gefahr der Selbstentfremdung, welche in Apathie und/oder Aktivismus, mit Neigung zu totalitären Regimen, münden kann.
Die Lincolnsche Formel
Anhand der „Lincolnschen Formel“ macht Sartori deutlich wo die Gefahren der Missinterpretation von politischen Schlagsätzen liegen. In Lincolns Ansprache, 1863 in Gettysburger, fällt zum Thema der Kennzeichnung der Demokratie folgender, berühmter Satz: „Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk“. Der von der Demokratie überzeugte Laie, wird diesem Satz mit Sicherheit zustimmen. Er birgt jedoch bei näherer Betrachtung viele Unklarheiten und sagt weniger, als die überzeugende Rhetorik vermuten lässt.
Sartoris Analyse der Phrase „Regierung des Volkes“, ergibt 5 Konjekturen:
a) Selbstregierung des Volkes, direkte Demokratie,
b) das Volk wird regiert,
c) Legitimität wird aus Zustimmung des Volkes abgeleitet,
d) Die Regierung wird von Volk gewählt,
e) Die Regierung wird vom Volk gelenkt.
(vgl. Sartori, 1992, 44). Schon hier wird die Mehrdeutigkeit sichtbar. „Regierung des Volkes“ deckt viele Formen politischer Herrschaft ab. Auch die zweite Kennzeichnung „durch das Volk“ ist wenig aufschlussreich und „lässt sich nicht auf den Punkt bringen“ (Sartori, 1992, 44). Einzig die dritte Kennzeichnung scheint eindeutig zu sein: „Für das Volk bedeutet offenbar: in seinem Interesse, zu seinem Wohle, zu seinem Vorteil“ (Sartori, 1992, 44). Denkt man jedoch an andere Regierungen die nie von sich behauptet haben demokratisch und trotzdem „für das Volk“ zu sein, wird auch diese Kennzeichnung hinfällig. Was bleibt ist die Gewissheit, dass durch Lincolns politischen Hintergrund, wir von eine demokratischen Intention ausgehen können „- ihr demokratischer Charakter leitet sich von der Person Lincolns her“.
Trennung von normativer- und empirische Theorie
Sartoris zweiter, grundlegender Anspruch liegt in der Trennung von normativer- und empirischer Theorie. Wie sich diese Trennung manifestiert, welche Gefahren bei Missachtung auftreten und wie man mit der Trennung umgehen soll, werde ich am Beispiel der Diskussion Sartoris über Ideale nachvollziehbar machen. Sartori ist sich, trotz strikter Trennung, drüber bewusst, dass ein empirischer Zustand auf einer normativen Vorstellung beruht und Empirie und Norm damit unabdingbar miteinander verwoben sind. „Was Demokratie ist, lässt sich nicht davon trennen, was Demokratie sein sollte “ (Sartori, 1992, 16). Und so erhebt Sartori an seine Theorie den Anspruch beide Elemente zu verbinden und eine abstrakte Theorie zu schaffen die auch dem Kriterium der praktischen Anwendbarkeit gerecht wird.
Idealismus
Ideale sind Handlungsanreize, weil sie der Vorstellung einer „besseren Welt“ entspringen. Genauer: Nicht verwirklichte Ideale sind Handlungsreize, weil sie nur so lange motivierend wirken wie sie gerade nicht in die politische Realität umgesetzt sind. Die Rolle der Ideale kann man gut an einem Beispiel verdeutlichen. Angenommen es kommt zu einem Regimewechsel und die zum Umsturz aufrufende Bevölkerung hat sich das Ideal: „alle Macht dem ganzen Volke“ (Sartori, 1992, 80) auf die revolutionären Fahnen geschrieben und versteht hierunter die direkte Machtausübung des Volkes, dann muss sich dieses Ideal nach dem Regimewechsel der Realität anpassen. Das Recht auf direkte Machtausübung ist nur ein nominelles Recht und wirkt wörtlich genommen destruktiv. „Wird innerhalb einer Demokratie das demokratische Ideal in seiner extremen Form aufrechterhalten, so beginnt es gegen die von ihm geschaffene Demokratie zu wirken (Sartori, 1992, 80)“. Ideale müssen also konstruktiv, sinngebend sein und so positive Entwicklungstendenzen ermöglichen. Diese Rückkopplungsregel beschreibt Sartori: „In dem Maße, wie ein Ideal in Wirklichkeit umgesetzt wird, muß es durch Rückkopplung gesteuert werden“ (Sartori, 1992, 80).
Diese Flexibilität der Ideale, also ihre Fähigkeit sich in Gewissem Maße der Wirklichkeit anzupassen und sich realen Anforderungen zu unterwerfen, ist die entscheidende Komponente, welche darüber entscheidet ob ein Ideal in der Wirklichkeit funktionieren kann.
Deshalb muss der Anspruch „alle Macht dem Volke“ bei der Entwicklung einer Demokratie in dem realistischeren Grundsatz „niemandem alle Macht“ überführt werden (vgl. Sartori, 1992, 81). Aus diesem Grund lehnt Sartori jede Form von „Hyperrealismus“ (Sartori, 1992, 65) kategorisch ab.
3. Literaturangaben
a) Massing, Peter / Breit, Gotthard (Hrsg.): Demokratietheorien. Von der Antike bis zur Gegenwart. 5. Aufl. Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2004
Sartori, Giovanni: Demokratietheorie. Darmstadt: Wiss. Buchges., 1992
Häufig gestellte Fragen
Was sind die grundlegenden Annahmen und Voraussetzungen in Sartoris "Demokratietheorien"?
Giovanni Sartoris Buch "Demokratietheorien" behandelt grundlegende Annahmen und Voraussetzungen, die er für die Ausarbeitung seiner Demokratietheorie für wichtig erachtet. Er betont eine argumentativ schlüssige Argumentationsform und eine strikte Trennung von normativer und empirischer Theorie. Diese Grundlagen bilden die Basis, um Sartoris Theorieansatz zu verstehen.
Was versteht Sartori unter argumentativer Demokratietheorie?
Sartori plädiert für eine neue argumentative Demokratietheorie, die in ihrer Begriffdefinition eindeutig ist und sich durch eine logische Diskussionsform auszeichnet. Er kritisiert die Unklarheit und Verwirrung im zeitgenössischen Demokratiebegriff und fordert eine klare, definierte Theorie, um den Demokratisierungsgrad einschätzen zu können.
Wie nähert sich Sartori dem Begriff Demokratie?
Sartori nähert sich dem Demokratiebegriff aus vier Richtungen: der etymologischen Wortbedeutung, dem Machtbegriff, dem Volk in der Massengesellschaft und der "Lincolnschen Formel".
Welche Deutungen von "Volk" gibt es laut Sartori?
Sartori nennt sechs Deutungen von "Volk": 1) Volk als buchstäblich jedermann, 2) Volk als ein unbestimmter großer Teil, 3) Volk als Unterschicht, 4) Volk als unteilbare Einheit, 5) Volk als größerer Teil im Sinne eines absoluten Mehrheitsprinzips, 6) Volk als größerer Teil im Sinne eines eingeschränkten Mehrheitsprinzips. Er argumentiert, dass das beschränkte Mehrheitsprinzip die demokratische Verfahrensregel der Demokratie ist.
Wie definiert Sartori politische Macht?
Sartori definiert politische Macht als die Kraft und Fähigkeit, andere zu lenken, einschließlich der Verfügung über ihr Leben. Er betont die Unterscheidung zwischen nominellen und tatsächlichen Machthabern und die Notwendigkeit einer legitimen Machtübertragung durch freie Wahlen.
Wie beeinflusst die Massengesellschaft das Verständnis von Demokratie?
Sartori argumentiert, dass das Volk in der Massengesellschaft ein amorphes Etwas ist, eine diffuse und atomisierte Gesellschaft. Faktoren wie Größe, Geschwindigkeit der Entwicklung und horizontale Mobilität führen zu Anonymisierung, Entwurzelung und einem Gefühl der individuellen Wirkungslosigkeit, was die Manipulierbarkeit des Individuums erhöht.
Welche Kritik übt Sartori an der "Lincolnschen Formel"?
Sartori analysiert die Phrase "Regierung des Volkes, durch das Volk, für das Volk" und zeigt, dass sie mehrdeutig ist und weniger aussagt, als die Rhetorik vermuten lässt. Er dekonstruiert die einzelnen Teile der Formel und zeigt die vielfältigen Interpretationsmöglichkeiten auf, die zu Missverständnissen führen können.
Warum betont Sartori die Trennung von normativer und empirischer Theorie?
Sartori betont die Trennung von normativer und empirischer Theorie, räumt aber ein, dass beide Elemente miteinander verwoben sind. Er strebt eine abstrakte Theorie an, die sowohl normativen Idealen als auch praktischer Anwendbarkeit gerecht wird. Er lehnt jede Form von Hyperrealismus ab.
Wie geht Sartori mit dem Idealismus um?
Sartori sieht Ideale als Handlungsanreize, die der Vorstellung einer besseren Welt entspringen. Er betont jedoch, dass Ideale flexibel sein müssen und sich in gewissem Maße der Wirklichkeit anpassen müssen, um konstruktiv zu wirken. Er warnt davor, dass Ideale in ihrer extremen Form gegen die Demokratie wirken können, wenn sie nicht durch Rückkopplung gesteuert werden.
Welche Literatur verwendet Sartori in seiner Analyse?
Sartori bezieht sich unter anderem auf Peter Massing/Gotthard Breit (Hrsg.): Demokratietheorien. Von der Antike bis zur Gegenwart. 5. Aufl. Schwalbach: Wochenschau Verlag, 2004.
- Quote paper
- Julian Lenk (Author), 2004, Giovanni Sartori - Demokratietheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110806