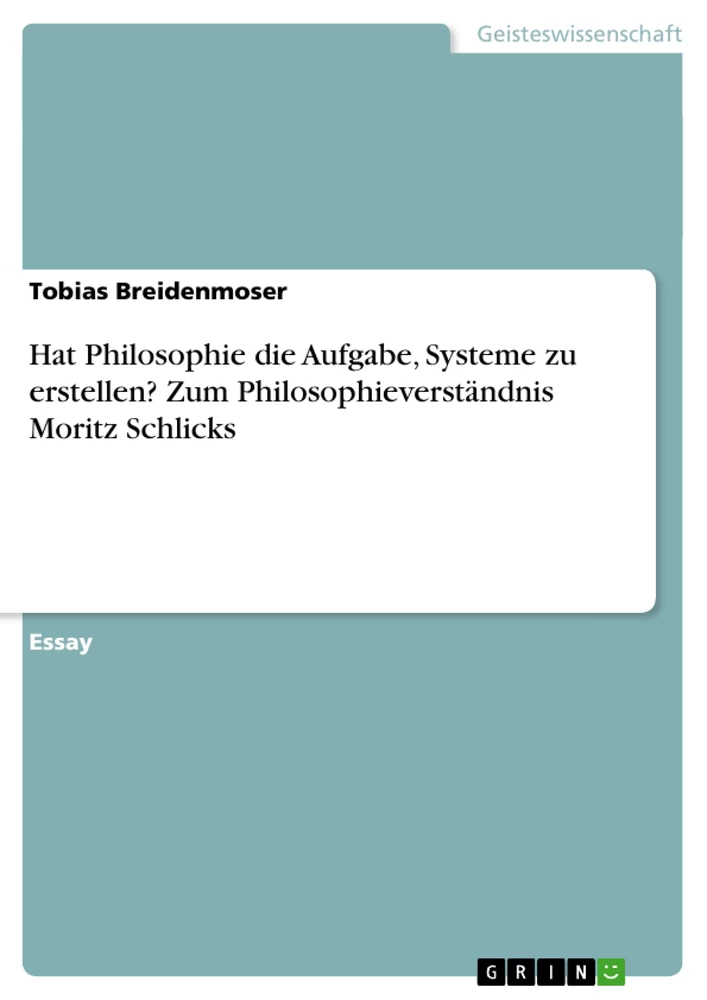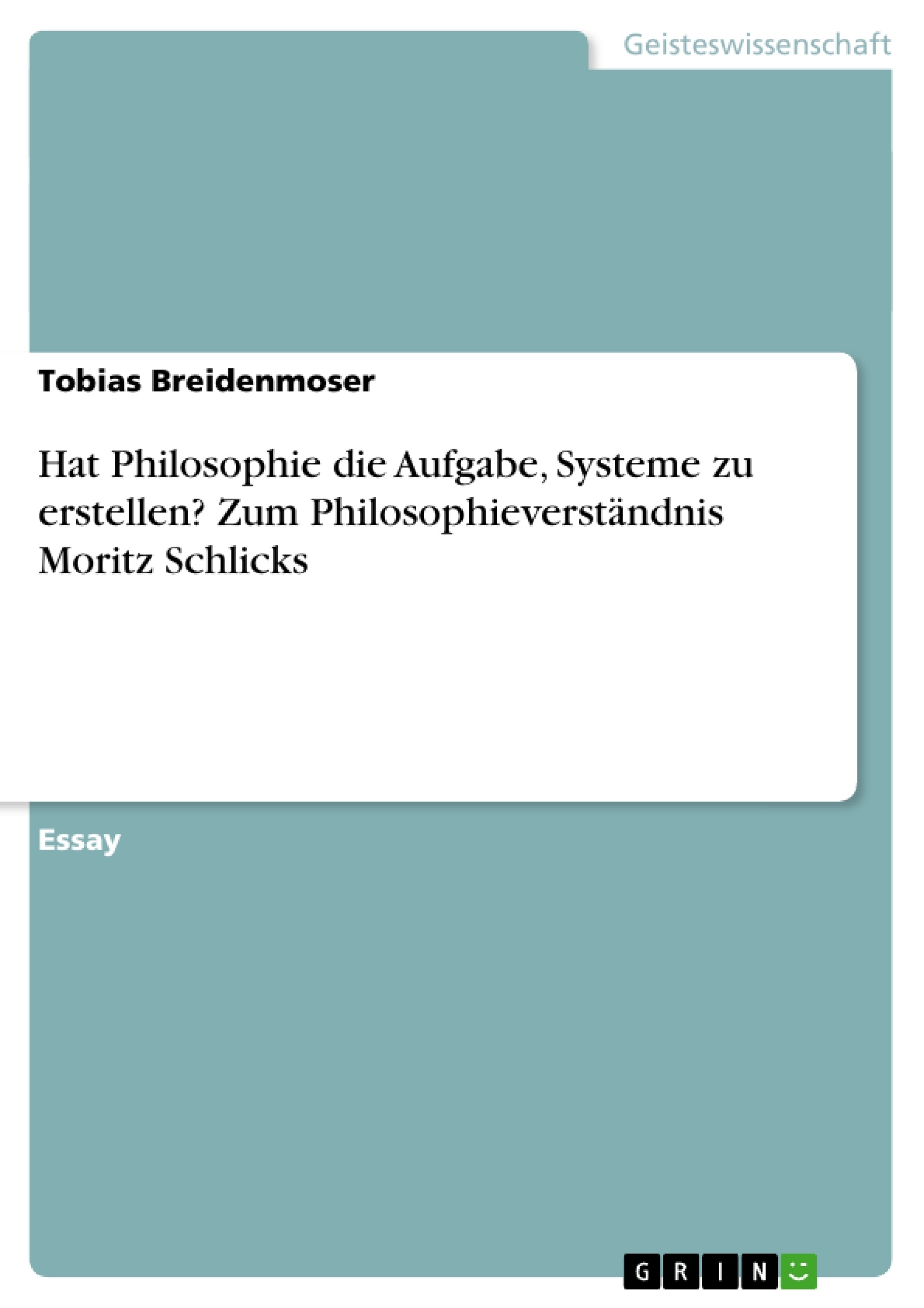Wenn man die Philosophiegeschichte betrachtet, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass es in der Philosophie keinen Fortschritt gebe. Die großen philosophischen Probleme wurden seit Platon in beinahe jeder Epoche der Philosophie neu diskutiert. Die Antworten auf diese Fragen hängen davon ab, ob man Platonist, Scholastiker, Rationalist, Empirist, Kantianer oder ein Anhänger der zahlreichen weiteren philosophischen Schulen ist. Eine endgültige und allgemeine Antwort auf eine philosophische Frage gibt es scheinbar nicht, und wenn man dem obigen Fichte-Zitat glauben möchte, hängt vom Seelenleben eines Philosophen auch seine Antwort auf philosophische Fragen ab.
Gegenüber diesem Verständnis der Philosophie kam es zu Beginn des letzten Jahrhunderts zu einem umfassenden Paradigmenwechsel. Vor allem von Mathematikern und Naturwissenschaftlern in Wien und Berlin wurde eine neue Art zu Philosophieren entwickelt, die als wissenschaftliche Philosophie bezeichnet wird und später unter dem Begriff Logischer Empirismus bekannt wurde.
Eine herausragende Rolle in dieser Entwicklung spielte Moritz Schlick, der für den Wiener-Kreis-Forscher Michael Friedman als „der erste professionelle ‚wissenschaftliche Philosoph’ “ gilt. Schlick lehrte ab 1922 in Wien gründete dort den später als Wiener Kreis bekannt gewordenen Schlick-Zirkel, in dem zahlreiche Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten über Grundlagen und Probleme der Philosophie diskutieren. Dabei wurde sich weniger auf die Lehrgebäude der Philosophiegeschichte bezogen, sondern philosophische Probleme mit den Methoden der Logik und der exakten Wissenschaften behandelt.
Beispielhaft für die Auffassung des logischen Empirismus ist Schlicks Aufsatz Die Wende der Philosophie. Wie das anfangs angeführte Zitat belegt, hält Schlick die Zeit der Systemstreitigkeiten in der Philosophie für beendet. Er verweist in seinem Aufsatz zunächst auf die Entwicklungen der modernen Logik durch Frege, Russell und Wittgenstein.
Hat Philosophie die Aufgabe, Systeme zu erstellen?
Zum Philosophieverständnis Moritz Schlicks
Was für eine Philosophie man wähle, hängt sonach davon ab, was man für ein Mensch ist: denn ein philosophisches System ist nicht ein todter Hausrath, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte, sondern es ist beseelt durch die Seele des Menschen, der es hat.
Johann Gottlieb Fichte
Ich bin nämlich überzeugt, daß wir in einer durchaus endgültigen Wendung der Philosophie mitten darin stehen und daß wir sachlich berechtigt sind, den unfruchtbaren Streit der Systeme als beendigt anzusehen.
Moritz Schlick
Wenn man die Philosophiegeschichte betrachtet, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass es in der Philosophie keinen Fortschritt gebe. Die großen philosophischen Probleme wurden seit Platon in beinahe jeder Epoche der Philosophie neu diskutiert. Die Antworten auf diese Fragen hängen davon ab, ob man Platonist, Scholastiker, Rationalist, Empirist, Kantianer oder ein Anhänger der zahlreichen weiteren philosophischen Schulen ist. Eine endgültige und allgemeine Antwort auf eine philosophische Frage gibt es scheinbar nicht, und wenn man dem obigen Fichte-Zitat glauben möchte, hängt vom Seelenleben eines Philosophen auch seine Antwort auf philosophische Fragen ab.
Gegenüber diesem Verständnis der Philosophie kam es zu Beginn des letzten Jahrhunderts zu einem umfassenden Paradigmenwechsel. Vor allem von Mathematikern und Naturwissenschaftlern in Wien und Berlin wurde eine neue Art zu Philosophieren entwickelt, die als wissenschaftliche Philosophie bezeichnet wird und später unter dem Begriff Logischer Empirismus bekannt wurde.[1]
Eine herausragende Rolle in dieser Entwicklung spielte Moritz Schlick, der für den Wiener-Kreis-Forscher Michael Friedman als „der erste professionelle ‚wissenschaftliche Philosoph’ “[2] gilt. Schlick lehrte ab 1922 in Wien gründete dort den später als Wiener Kreis bekannt gewordenen Schlick-Zirkel, in dem zahlreiche Wissenschaftler aus verschiedenen Fachgebieten über Grundlagen und Probleme der Philosophie diskutieren. Dabei wurde sich weniger auf die Lehrgebäude der Philosophiegeschichte bezogen, sondern philosophische Probleme mit den Methoden der Logik und der exakten Wissenschaften behandelt.
Beispielhaft für die Auffassung des logischen Empirismus ist Schlicks Aufsatz Die Wende der Philosophie. Wie das anfangs angeführte Zitat belegt, hält Schlick die Zeit der Systemstreitigkeiten in der Philosophie für beendet. Er verweist in seinem Aufsatz zunächst auf die Entwicklungen der modernen Logik durch Frege, Russell und Wittgenstein. Diese haben nicht nur die Mathematik revolutioniert, sondern auch einen neuen Weg für die Philosophie eingeschlagen. Die große Bedeutung der Logik für die Philosophie liegt in der Tatsache, dass „jede Erkenntnis ein Ausdruck, eine Darstellung ist“[3] und die verschiedenen Darstellungsarten einer Erkenntnis dieselbe logische Form haben müssen. „So ist alle Erkenntnis nur vermöge ihrer Form Erkenntnis.“[4]
Dies führt zu einer empiristischen Sichtweise, da die Auffassung der Erkenntnis als Darstellung eine Beziehung zwischen Sinnesdaten und Sprache ausdrückt und metaphysische Spekulationen aufgrund fehlender Sinnesdaten ausgeschlossen werden. Das hat Folgen für Reichweite und Grenzen der Erkenntnis. „Erkennbar ist alles, was sich ausdrücken läßt, und das ist alles, wonach man sinnvoll fragen kann. Es gibt daher keine prinzipiell unbeantwortbaren Fragen, keine prinzipiell unlösbaren Probleme. Was man bisher dafür gehalten hat, sind keine echten Fragen, sondern sinnlose Aneinanderreihungen von Worten.“[5]
Die Philosophie selbst kann dafür natürlich keine Ausnahme bilden. Eine philosophische Frage muss beantwortet werden können oder ist sinnlos gestellt. Der fehlende Fortschritt in der Philosophie liegt anscheinend nicht an der Unvollkommenheit der philosophischen Systeme, sondern daran, dass sich Generationen von Denkern über falsch gestellte Fragen den Kopf zerbrochen haben. Laut Schlick müssen alle Fragen durch Rückführung auf die Beobachtung beantwortet werden, wodurch klassische philosophische Probleme wie die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele hinfällig werden. „Jede Wissenschaft [...] ist ein System von Erkenntnissen, d.h. von wahren Erfahrungssätzen; und die Gesamtheit der Wissenschaften, mit Einschluß aller Aussagen des täglichen Lebens, ist das System der Erkenntnisse, es gibt nicht außerhalb seiner noch ein Gebiet ‚philosophischer’ Wahrheiten, die Philosophie ist nicht ein System von Sätzen, sie ist keine Wissenschaft.“[6]
Obwohl die Philosophie nach Schlick keine eigenen Erkenntnisse liefert, ist sie für die Einzelwissenschaften unverzichtbar. Sie soll die Bedeutung von Sätzen herauszustellen und ihre Aufgabe besteht in der Sinngebung von Aussagen. Die Bildung metaphysischer Systeme ist hingegen ein Irrweg und muss um jeden Preis vermieden werden.
Der Philosoph ist im Philosophieverständnis Moritz Schlicks zum Grundlagenforscher der Einzelwissenschaften geworden, der sich immer dann einmischt, wenn die Bedeutung ihrer fundamentalen Begriffe fraglich wird. Dies waren zu seiner Zeit beispielsweise die Begriffe „Raum“ und „Zeit“ in der Physik, die durch die Relativitätstheorie einen starken Bedeutungswandel vollzogen und mit dessen Konsequenzen sich auch Schlick beschäftigte.[7] Es lässt sich zeigen, dass er im persönlichen Austausch mit Albert Einstein nicht nur die damals überzeugendste Interpretation der Relativitätstheorie lieferte, sondern durch Grundlagenreflexion seinerseits wichtige Impulse für die Relativitätstheorie gab.[8] Dies ist ein Beispiel dafür, dass große wissenschaftliche Leistungen nur mit Hilfe der Klärung von Grundbegriffen möglich ist. Es zeigt sich, dass der Philosoph durch Schlicks Philosophieverständnis keineswegs überflüssig geworden ist, denn „der große Forscher ist immer auch Philosoph.“[9]
Das Philosophieverständnis Moritz Schlicks prägt die analytische Philosophie bis heute maßgeblich. Der analytische Philosoph der Gegenwart zeichnet sich nicht mehr durch umfassendes Wissen über die Philosophiegeschichte aus, sondern besonders durch einen sicheren und klaren Argumentationsstil. Darüber hinaus zeigt sich die Notwendigkeit, die Kompetenzen des Philosophiestudiums nicht im berühmten Elfenbeinturm zu lassen, sondern sie mit den Einzelwissenschaften zu verbinden. Dies geschieht beispielsweise mit Ethik und Wissenschaftstheorie, die zwar vorwiegend an philosophischen Lehrstühlen gelehrt werden, aber im Grunde genommen Einzelwissenschaften sind und gegenwärtig an wenigen Universitäten Deutschlands auch als eigenständige Fächer gelehrt werden. Analytische Philosophie wird aber auch in Verbindung mit Logik, Mathematik, Physik, Biologie, Kognitionswissenschaften, Linguistik, Medizin, Recht und vielen weiteren Wissenschaften betrieben.
Durch diese Vorgehensweise kann die Analytische Philosophie auch als Reflexionswissenschaft bezeichnet werden. Sie hinterfragt die Grundprinzipien und die versteckten Annahmen, die von den Einzelwissenschaftlern einfach vorausgesetzt werden. Außerdem behält der Philosoph gegenüber den oft überspezialisierten Wissenschaftlern einen Blick auf das Ganze. Im Hinblick auf die Frage nach Anwendbarkeit und Rechtfertigung der akademischen Philosophie kann daher geschlussfolgert werden, dass in einem größeren Forschungsteam gleich welcher Art ein analytischer Philosoph großen Nutzen bringen kann.
[...]
[1] Im Gegensatz zur Bezeichnung „wissenschaftliche Philosophie“ beschreibt „Logischer Empirismus“ diese Richtung nur ungenügend. Zwar standen alle Philosophen der wissenschaftlichen Philosophie dem Empirismus nahe und bezeichneten sich selbst als Empiristen. Historische Neuinterpretationen konnten jedoch zeigen, dass konventionalistische Elemente in der Philosophie des Logischen Empirismus eine sehr große Rolle spielten und ihr philosophischer Standpunkt daher keine reiner Empirismus ist, sondern zwischen Empirismus, Konventionalismus und Neukantianismus steht. Vgl. hierzu Michael Friedman – Reconsidering logical positivism. Cambridge University Press, Cambridge 1999.
[2] Michael Friedman – Wissenschaftliche Philosophie und die Dynamik der Vernunft. Unveröffentlichter Vortrag, gehalten an der Universität Rostock im Rahmen der Veranstaltungsreihe Natur und Geist 2004, übersetzt von Niko Strobach.
[3] Moritz Schlick – Die Wende der Philosophie. Zuerst erschienen in: Erkenntnis Bd. 1, S.4-11, hier 6. Erscheint in: MSGA I–VI, hrg. von Johannes Friedl und Heiner Rutte, Springer, Wien und New York 2007, S.173-182.
[4] Moritz Schlick – Die Wende der Philosophie. A.a.O. S.7
[5] Ebd.
[6] Moritz Schlick – Die Wende der Philosophie. A.a.O. S.7f
[7] Moritz Schlick – Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik. MSGA I–II, hrsg. von Fynn Ole Engler und Matthias Neuber, Springer, Wien und New York 2006.
[8] Fynn Ole Engler – Moritz Schlick und Albert Einstein. Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 309, Berlin 2006. Erscheint in: Schlick-Studien Bd.1, hrsg. von Friedrich Stadler und Hans Jürgen Wendel, Springer, Wien und New York, 2007.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Hat Philosophie die Aufgabe, Systeme zu erstellen?"?
Der Text befasst sich mit dem Philosophieverständnis von Moritz Schlick und der Frage, ob es die Aufgabe der Philosophie ist, Systeme zu erstellen. Er beleuchtet Schlicks Kritik an traditionellen philosophischen Systemen und seine Hinwendung zu einer wissenschaftlichen Philosophie, dem Logischen Empirismus.
Was ist der Logische Empirismus nach Moritz Schlick?
Der Logische Empirismus, wie ihn Schlick vertrat, ist eine philosophische Richtung, die sich auf die moderne Logik und die exakten Wissenschaften stützt. Er betont die Bedeutung der Sinneserfahrung und der logischen Analyse von Sprache, um philosophische Probleme zu lösen. Metaphysische Spekulationen werden abgelehnt.
Was ist laut Schlick die Rolle der Philosophie?
Schlick argumentiert, dass die Philosophie keine eigenen Erkenntnisse liefert, sondern die Aufgabe hat, die Bedeutung von Sätzen zu klären und Aussagen Sinn zu geben. Sie soll die Grundlagen der Einzelwissenschaften erforschen und bei der Klärung fundamentaler Begriffe helfen.
Was kritisiert Schlick an der traditionellen Philosophie?
Schlick kritisiert den Systemstreit in der Philosophie und die Beschäftigung mit falsch gestellten Fragen, die nicht auf Beobachtung zurückgeführt werden können. Er hält die Bildung metaphysischer Systeme für einen Irrweg.
Welche Bedeutung hat die Logik für Schlicks Philosophieverständnis?
Die Logik spielt eine zentrale Rolle, da sie es ermöglicht, die logische Form von Erkenntnissen zu analysieren und Darstellungsweisen zu vergleichen. Laut Schlick ist alle Erkenntnis nur durch ihre Form Erkenntnis.
Wie steht Schlick zur Frage der Unsterblichkeit der Seele?
Schlick betrachtet die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele als hinfällig, da sie nicht durch Rückführung auf die Beobachtung beantwortet werden kann.
Welche Rolle spielt die Beobachtung (Erfahrung) in Schlicks Philosophie?
Die Beobachtung, bzw. Erfahrung ist zentral. Alle Fragen müssen durch Rückführung auf Beobachtung beantwortet werden, wodurch klassische philosophische Probleme hinfällig werden. Erkenntnisse sind demnach wahre Erfahrungssätze.
Was bedeutet es, dass die analytische Philosophie eine "Reflexionswissenschaft" ist?
Die analytische Philosophie hinterfragt die Grundprinzipien und versteckten Annahmen, die von den Einzelwissenschaften oft unhinterfragt vorausgesetzt werden. Sie behält den Blick auf das Ganze und kann somit in Forschungsteams von großem Nutzen sein.
Wer waren wichtige Einflüsse auf Schlicks Philosophie?
Wichtige Einflüsse auf Schlicks Philosophie waren Frege, Russell und Wittgenstein, deren Arbeiten die moderne Logik revolutionierten.
In welchen Bereichen ist die analytische Philosophie heute relevant?
Die analytische Philosophie ist heute in vielen Bereichen relevant, darunter Ethik, Wissenschaftstheorie, Logik, Mathematik, Physik, Biologie, Kognitionswissenschaften, Linguistik, Medizin und Recht.
Was ist das Fazit des Textes?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass Schlicks Philosophieverständnis die analytische Philosophie bis heute prägt und dass analytische Philosophen in interdisziplinären Forschungsteams von großem Nutzen sein können.
- Quote paper
- Tobias Breidenmoser (Author), 2007, Hat Philosophie die Aufgabe, Systeme zu erstellen? Zum Philosophieverständnis Moritz Schlicks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110766