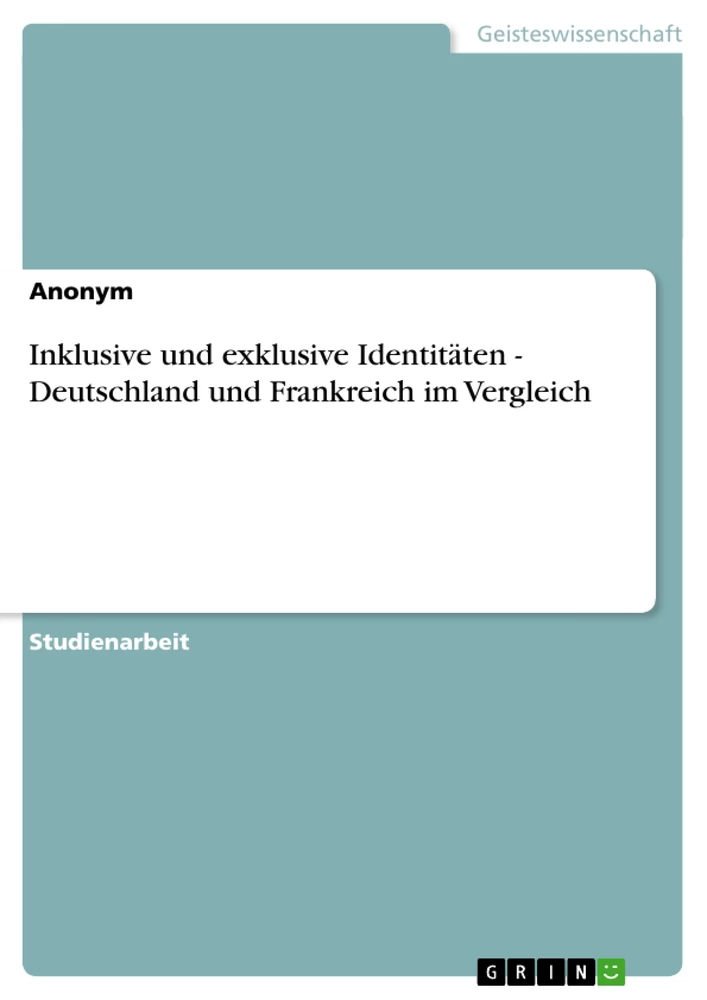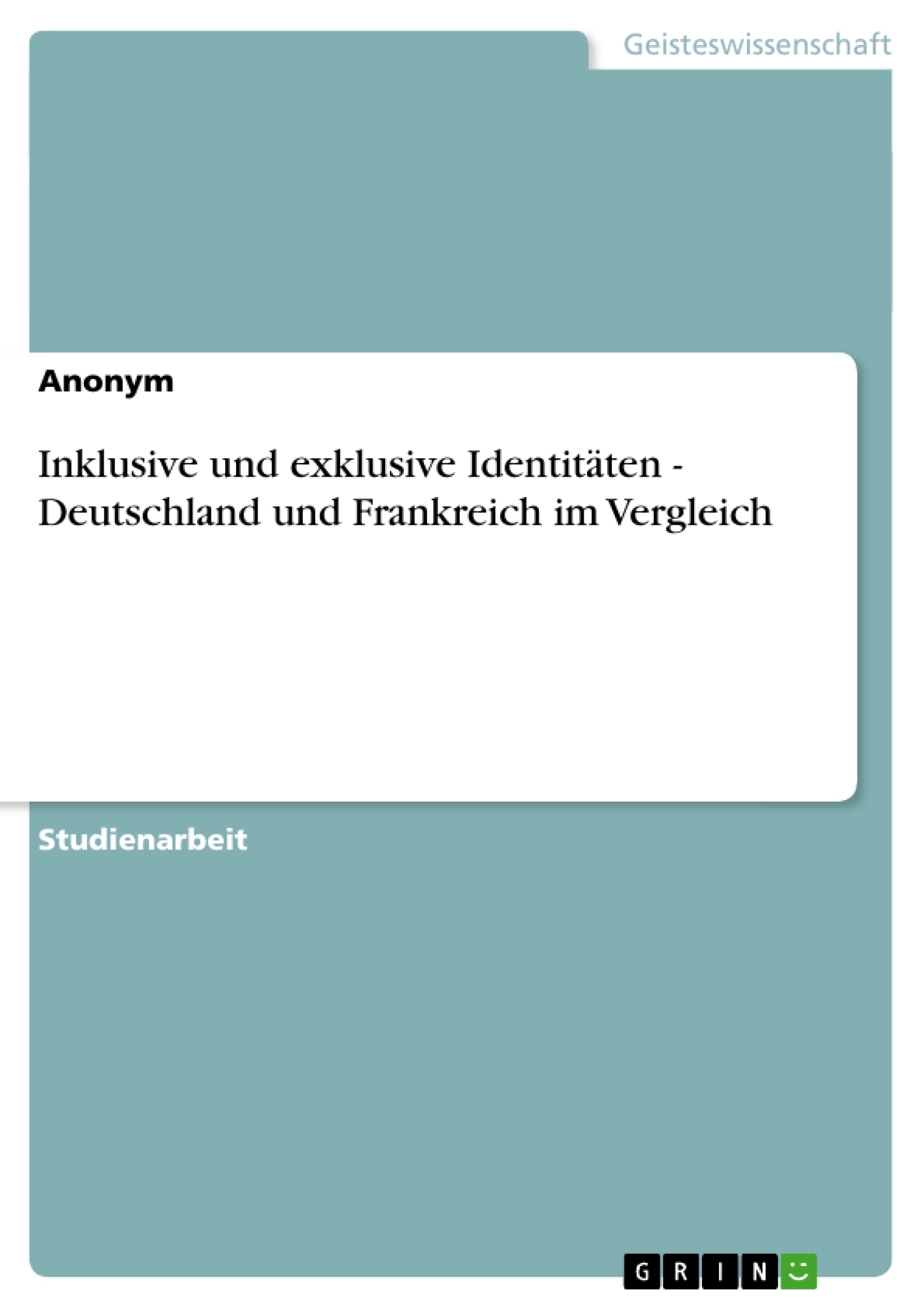Mit dem Kopftuch muslimischer Frauen wird all das verbunden, was in Anbetracht der Sicherheitsbedrohung durch global agierende Terroristen oder durch negative Entwicklungen in der islamischen Welt bzw. das allgemein negative Stimmungsbild über Muslime in den Islam hineinprojiziert wird. Wenn früher mit dem Kopftuch die Unterdrückung der Frau, ihre Unmündigkeit, Rückständigkeit und Schwäche assoziiert wurde, so sind heute Terrorismus, Extremismus, Anti-Moderne und Ablehnung demokratischer Werte hinzugekommen. Dies wird auch im Rahmen der Überlegungen zur Integration von Muslimen deutlich. Diese wird immer mehr unter sicherheitspolitischen Aspekten geführt.
Doch in der Politik bleibt die Frage nach der Integration von Muslimen und dem Umgang mit muslimischen Frauen mit Kopftuch in erster Linie eine migrationspolitische Debatte, da der Islam als eine fremde Religion betrachtet wird, die mit der Gastarbeitergeneration nach Deutschland hineingetragen wurde. Die wachsende Zahl deutschstämmiger und eingebürgerter Muslime wird dabei zu wenig berücksichtigt.
Das Kopftuch ist in Deutschladn und Frankreich somit zum Gegenstand eines Ersatzdiskurses geworden, der eine längst überfällige sachliche und zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Umgang der Gesellschaft mit Muslimen im Besonderen und zugewanderten Menschen im Allgemeinen beiseite schiebt. Sie hat aber auch ganz andere bisher nicht hinreichend reflektierte Fragen aufgeworfen, nämlich: Wie viel Religion vertragen Staat und Gesellschaft? Wie viel kulturelle und religiöse Vielfalt will man hier zulassen?
Inhaltsverzeichnis
1. Inklusive und exklusive Identitäten- eine Einleitung
2. Nationen
2.1. Allgemeines zum Begriff „Nation“
2.2. Ebenen des Begriffs "Nation"
2.3. Die moderne Nation- Definition
3. Die nationale Identität- Definition
3.1. Bestandteile der nationalen Identität
3.2. wichtige Merkmale der nationalen Identität
4. Nationalismus- Definition
4.1. Hauptmerkmal der Nationalismus
4.2. Der Doppelcharakter des Nationalismus und sein Einfluss auf die nationale Identität
5. Unterschiede zwischen inklusiven und exklusiver Identitäten: Deutschland und Frankreich im Vergleich
6. Die Kopftuchdebatte
6.1. die öffentliche Kritik
6.2. der Fall Ludin
6.3. „entscheidend ist, was im und nicht was auf dem Kopf ist!“ - ein Fazit
7. Hintergründe
8. Schlussfolgerung
9. Literatur
1. Einleitung
Diese Seminararbeit behandelt den Wandel und die Unterschiede der nationalen Identität am Beispiel von Deutschland und Frankreich. Sie setzt sich außerdem auch mit der Frage nach den Ursachen und Konsequenzen dieses Wandels auseinander.
Eine Frage, die in der Nationalismus und nationale Identitätsforschung immer wieder auftaucht, bestimmt das Feld des vorliegenden Themas: In wie weit wird die nationale Identität beeinflusst und welche Faktoren tragen dazu bei?
Ein solches Thema wird allerdings ohne bestimmte Voraussetzungen von Grundbegriffen der Nation und des Nationalismus nicht auskommen, weil das Verständnis der nationalen Identität ohne das Verständnis von Nation undenkbar ist und weil der Nationalismus bei dem Wandel der nationalen Identität eine entscheidende Rolle spielt. Deshalb werden auch Grundlagen für die Analyse von Zusammenhängen zwischen Nationalismus, nationaler Identität und Nation erarbeitet. Dazu gehört ihre Begriffserklärung, die Erläuterung ihrer Merkmale und- wie schon erwähnt- die Unterschiede und die Faktoren, die zu dem Wandel der nationalen Identität in Deutschland und Frankreich, beigetragen haben.
Ich habe mich entschlossen, den Unterschied in der Einwanderungspolitik zwischen Deutschland und Frankreich wegen zwei Gründen zu analysieren: erstens haben diese Länder bis im Jahr 1999 eine- von einander- völlig verschiedene Einwanderungspolitik betrieben. Dieser Unterschied wird im ersten Beispiel erläutert. Die Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und französischen nationalen Identität, werden anhand des zweiten Beispiels behandelt, wobei damit auch der Wandel dieser Identitäten festgestellt und analysiert wird.
Das zentrale Ziel dieser Seminararbeit sind somit die Zusammenhänge zwischen Nation, Nationalismus und nationale Identität festzustellen.
Die Recherchen für diese Seminararbeit beziehen sich auf zwei Hauptquellen. Ein Teil der Informationen, die für diese Seminararbeit erforderlich waren, kommen von zwei Kapitel aus dem Buch „ Am Rande Europas? „ vom Dr. Jerzy Mackow, der Professor für vergleichende Politikwissenschaft im Institut für Politikwissenschaft an der Universität Regensburg ist. In diesem Buch behandelt Pr. Mackow die Geschichte der Entstehung und Entwicklung der Nationen, der Zivilgesellschaft und die außenpolitische Integration der Staaten in Mittel- und Osteuropa.
Die Materialien für die Kopftuchdebatte habe ich von einem Internetquelle genommen, nachdem ich sicher war, dass es sich auch um aktuelle und vertrauenswürdige Informationen handelte.
2. Nationen
Die Nationen treten in unterschiedlicher Gestalt auf. Ihre Unterschiedlichkeit in Geschichte und Gegenwart geht einerseits auf Unterschiede hinsichtlich der „objektiven“ Eigenarten der betroffenen Population zurück: Sprache, Bräuche, Kultur, Geschichte, Rassenmerkmale, etc. Andererseits resultiert sie aus den „subjektiven“ Eigenarten, die untrennbar mit der nationalen Identität- mit den gemeinsamen Vorstellungen über die eigenen Ursprünge und die eigenen Wesensart- verbunden sind.
In Europa hat es Nationen gegeben, noch bevor der moderne Nationalismus aufkam. In der Literatur zur Nation und Nationalismus gibt es außerdem viele Termini und Konzepte, wenn es um die Nationen geht. Bezüglich dieses Themas aber, ist nur die moderne Nation von zentraler Bedeutung, da in ihr die Zusammenhänge zwischen Nation, Nationalismus und nationale Identität am besten gespiegelt werden.
2.1. Allgemeines zum Begriff „Nation“
Die Idee der Nation entstand in den 18 Jh. in Folge der französischen Revolution. Durch zunehmende Mobilität begünstigt, entfaltete ihre Idee eine hohe Dynamik, die anfangs gegen Feudalismus und Autokratie (Frankreich, Deutschland), gegen wirtschaftlich und politisch einengende Kleinstaaterei (Deutschland), oder aber gegen imperiale Herrschaft (Russland, Donaumonarchie) gerichtet war. Die Vorstellung vom ethnisch homogenen Nationalstaat gipfelte im 20. Jahrhundert in verschiedenen ethnischen Säuberungen und Genoziden.
2.2. Ebenen des Begriffs "Nation"
Nation wird als ethnische Homogenität (als Volk), aber auch als Stamm (Stammesvolk, früher Völkerstamm) verstanden. Diese Definition der Nation geht von der gemeinsamen Abstammung der Angehörigen der Nation und einer daraus resultierenden Kultur- und Spracheinheit aus. Lange Zeit war diese Auffassung vorherrschend, besonders im Mittel- und Osteuropa des 19. und 20. Jahrhunderts, wo sie zur massenwirksamen Ideologie ausgebaut wurde. Heute wird dieses Konzept vielfach angegriffen und kritisiert.
Nation ist außerdem die Homogenität der Sprache und Tradition (Kulturnation). Sie ist dann die durch die Geschichte bewahrte Einheit in Sprache, Kultur und Traditionen. Sie lässt sich nicht durch territoriale Grenzen definieren. Dies galt für die Kulturnation Deutschland im 19. Jahrhundert, ebenso für die ungarischen Minderheiten aus den unabhängig gewordenen Nachbarstaaten.
Gegenwärtig ist z.B. ein gewisses Streben nach einer Nation z.B. unter den Kurden beobachtbar. Dieser Prozess wird allerdings von heftigen Auseinandersetzungen von innen und außen begleitet.
2.3.Die moderne Nation
Die moderne Nation wird als eine, über einen Eigennamen verfügende Population definiert, die ein historisches Territorium, gemeinsame Mythen und historische Erinnerungen, eine öffentliche Kultur für die Massen, eine gemeinsame Wirtschaft und einen „juristischen Code“ der gemeinsamen Rechte und Pflichten besitzt.
3. Die nationale Identität
Die von den meisten Angehörigen geteilten Vorstellungen über die eigene Nation bilden die nationale Identität. Eine alle Schichten der Gesellschaft durchgreifende nationale Identität hatte es vor dem Französischen Revolution nicht gegeben, weshalb diese Revolution von vielen als die Geburtsstunde der modernen Nationen betrachtet wird. Insofern wird deren Entstehung in den Zusammenhang der gesellschaftlichen Veränderungen von revolutionärer Reichweite gebracht, mit zwingenden Folgen für das Verständnis der modernen Nationen
3.1. Bestandteile der nationalen Identität
Die nationale Identität besteht aus drei Teile: Die Vorstellungen über die gemeinsamen Ursprünge, Vorstellungen über die eigene Wesensart und Vorstellungen über die politische Souveränität. Diese drei Bestandteile sind unterschiedlich bei den Nationen. Sie können außerdem in einer ganzen Population nie völlig einheitlich sein. „Doch allein schon die unbestreitbare Tatsache, dass sich alle Betroffenen darüber Gedanken machen, was es bedeutet, ein Deutscher, Spanier, Franzose oder Tscheche zu sein, zeugt von ihrem Glauben, sie hätten als die Deutschen die Spanier oder die Franzosen usw. eine je eigene und gemeinsame Geschichte und Wesensart“ 3
3.2. Wichtige Merkmale der nationalen Identität
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit behandelt den Wandel und die Unterschiede der nationalen Identität am Beispiel von Deutschland und Frankreich. Sie untersucht auch die Ursachen und Konsequenzen dieses Wandels.
Welche Hauptfrage wird in dieser Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die nationale Identität beeinflusst wird und welche Faktoren dazu beitragen.
Welche Grundbegriffe sind für das Verständnis des Themas unerlässlich?
Die Begriffe Nation und Nationalismus sind von grundlegender Bedeutung, da das Verständnis der nationalen Identität ohne diese nicht möglich ist. Die Arbeit erarbeitet Grundlagen für die Analyse der Zusammenhänge zwischen Nationalismus, nationaler Identität und Nation, einschließlich Begriffserklärungen und Merkmale.
Warum wurden Deutschland und Frankreich als Beispiele gewählt?
Der Unterschied in der Einwanderungspolitik zwischen Deutschland und Frankreich wird analysiert, da diese Länder bis 1999 eine völlig verschiedene Einwanderungspolitik verfolgten. Gemeinsamkeiten und der Wandel der nationalen Identitäten werden anhand eines weiteren Beispiels behandelt.
Was ist das zentrale Ziel der Seminararbeit?
Das zentrale Ziel ist, die Zusammenhänge zwischen Nation, Nationalismus und nationaler Identität festzustellen.
Welche Hauptquellen wurden für die Recherche verwendet?
Die Recherchen basieren auf zwei Hauptquellen, darunter Kapitel aus dem Buch „Am Rande Europas?“ von Dr. Jerzy Mackow und Informationen zur Kopftuchdebatte aus einer vertrauenswürdigen Internetquelle.
Wie werden Nationen in der Einleitung beschrieben?
Nationen treten in unterschiedlicher Gestalt auf, bedingt durch "objektive" (Sprache, Bräuche, Kultur, Geschichte) und "subjektive" (nationale Identität, gemeinsame Vorstellungen) Eigenarten.
Welche Bedeutung hat die moderne Nation im Kontext der Arbeit?
Die moderne Nation ist von zentraler Bedeutung, da in ihr die Zusammenhänge zwischen Nation, Nationalismus und nationaler Identität am besten gespiegelt werden.
Wie wird die Idee der Nation erklärt?
Die Idee der Nation entstand im 18. Jahrhundert infolge der Französischen Revolution. Sie richtete sich anfangs gegen Feudalismus, Autokratie, Kleinstaaterei oder imperiale Herrschaft.
Welche Ebenen des Begriffs "Nation" werden unterschieden?
Die Nation wird als ethnische Homogenität (Volk), als Homogenität der Sprache und Tradition (Kulturnation) und als moderne Nation definiert.
Wie wird die moderne Nation definiert?
Die moderne Nation wird als eine Population mit einem Eigennamen, historischem Territorium, gemeinsamen Mythen, öffentlicher Kultur, gemeinsamer Wirtschaft und einem "juristischen Code" gemeinsamer Rechte und Pflichten definiert.
Wie wird die nationale Identität definiert?
Die nationale Identität wird als die von den meisten Angehörigen geteilten Vorstellungen über die eigene Nation definiert. Sie umfasst Vorstellungen über gemeinsame Ursprünge, die eigene Wesensart und die politische Souveränität.
Welche sind die wichtigen Merkmale der nationalen Identität?
Der Wandel der nationalen Identität trägt zur Veränderung der Gesellschaft bei. Sie wird zum "Eigentum" aller Schichten, wodurch sich eine moderne Nation bildet. Gesellschaftlicher Struktur- und Kulturwandel verändern wiederum die nationale Identität.
Was ist Nationalismus?
Die Texte do not contain an explicit definition of 'Nationalismus', but describe it is as a political ideology.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Inklusive und exklusive Identitäten - Deutschland und Frankreich im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110640