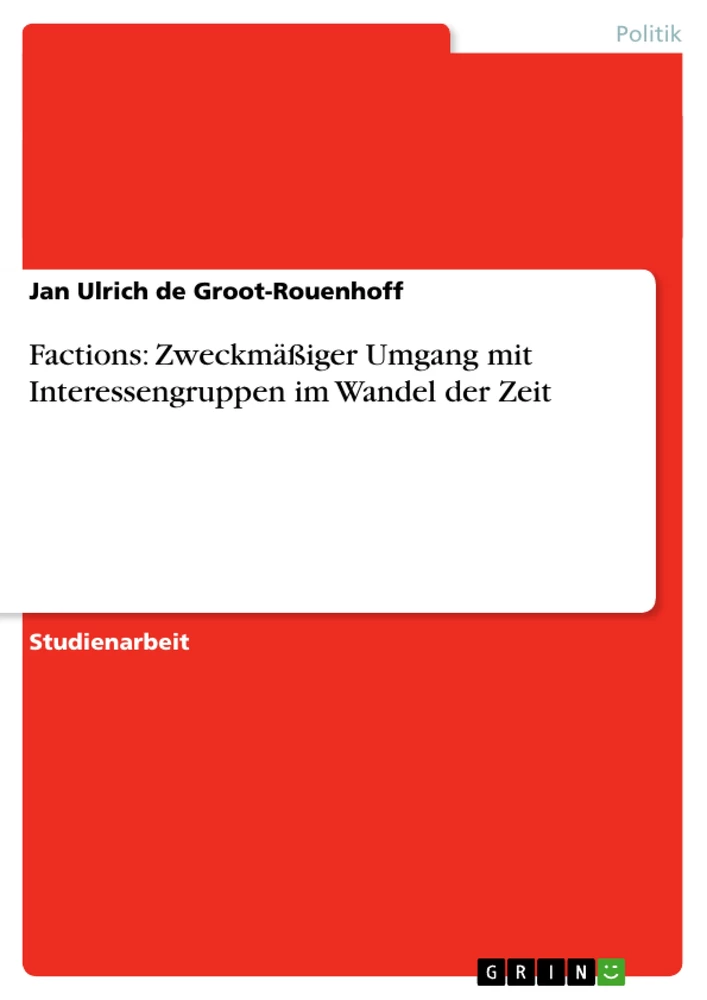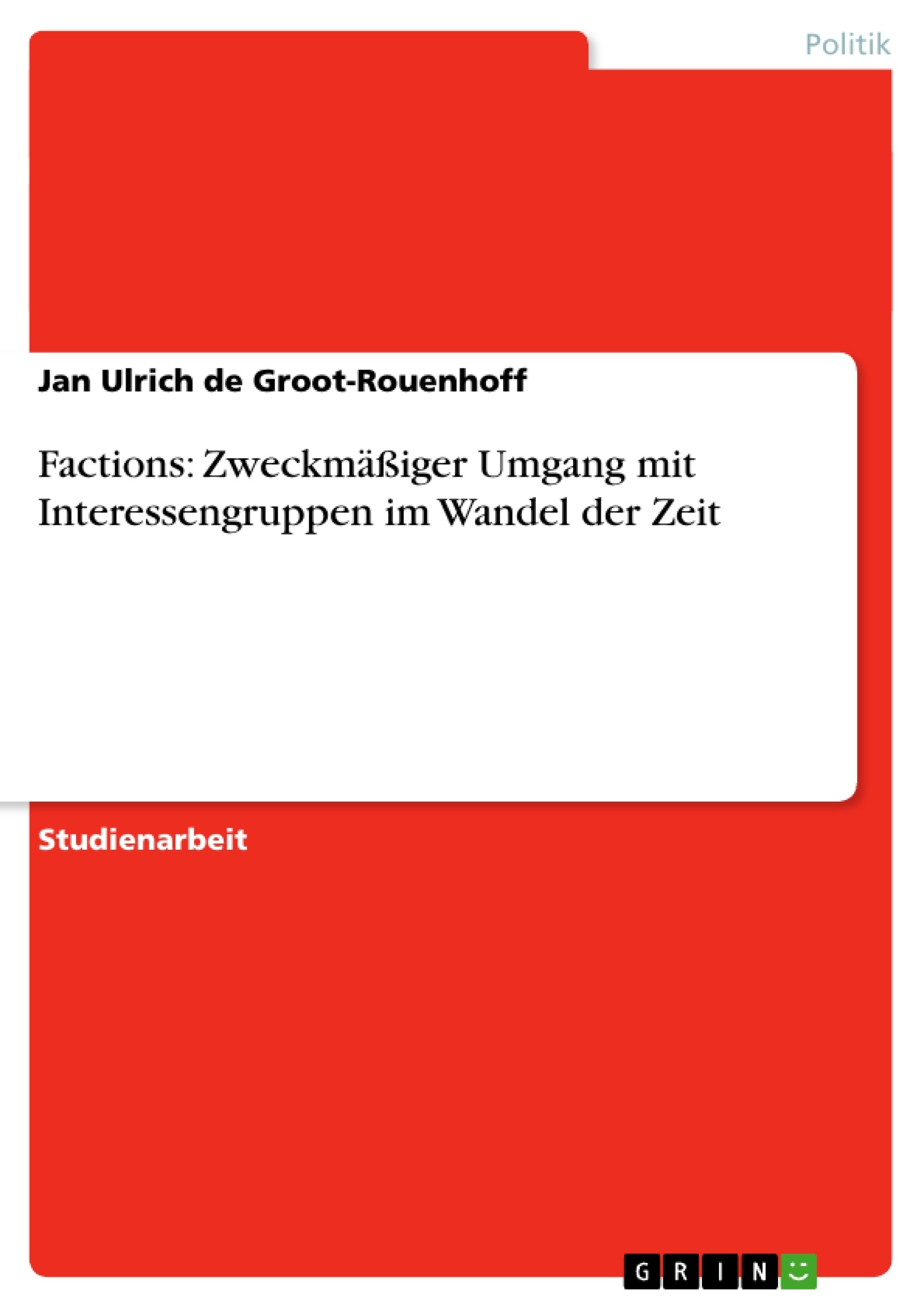Die Beeinflussung politischer Entscheidungen durch Interessengruppen wird gegenwärtig von der deutschen Öffentlichkeit zwiespältig bewertet: Zwar wird das gemeinschaftliche Engagement in Bürgerinitiativen meist wohlwollend beurteilt, die Einflussnahme durch Lobbyisten jedoch wird oftmals als „schmutziges Geschäft“, als allgemein schädlich verurteilt. Dass es sich hier um Aktivitäten ähnlichen Charakters handelt, scheint in derartigen Überlegungen keine Rolle zu spielen.
In der politischen Ideengeschichte finden sich ebenfalls einige bekannte Theoretiker, welche allgemein die Natur des Menschen, aber auch im speziellen die Aktivitäten von Interessengruppen in Demokratien eher kritisch-pessimistisch einschätzen. An dieser Stelle kann man gewiss die Federalist Papers anführen, welche zur Frage, wie man das als potentiell schädlich erachtete Streben der Interessengruppen nach Durchsetzung ihrer Partikularinteressen in Zaum halten könne, explizit Stellung nehmen.
Die Federalist Papers waren ohne Zweifel Wegbereiter moderner Demokratietheorien. Jedoch haben sich die äußeren Bedingungen bedingt durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt in einem Ausmaß verändert, das ein Überdenken und Überarbeiten mancher ihrer Theorien notwendig erscheinen lässt. Ausgehend von der Prämisse, die Selbsterhaltung ist das erste, das Erreichen des (wie auch immer gearteten) Gemeinwohls das zweite Ziel eines jeden politischen Systems, soll die Frage beantwortet werden, wie ein demokratischer Staat bestmöglich mit der Vielfalt an Einflüssen durch organisierter Interessen umgehen sollte, um seinen Selbsterhalt zu garantieren und daraufhin das Gemeinwohl durchzusetzen. Dem Autor ist bewusst, dass „Gemeinwohl“ ein vieldiskutiertes, mitunter schwierig zu fassendes Konstrukt ist. Im folgenden soll Gemeinwohl als „Metapher für die Resultante im Kräfteparallelogramm der Gruppen“ verstanden werden.
Zunächst soll gezeigt werden, wie das Phänomen der Interessengruppen von den Federalists erörtert wurde. Darauf folgend sollen gegenwärtige theoretische Konzepte zur Beschreibung und Erklärung der Beteiligung der Interessengruppen vorgestellt werden; dabei wird es um Pluralismus, Korporatismus und politischer Netzwerke gehen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Umgang mit Interessengruppen in den Federalist Papers
2.1 Die Federalist Papers
2.2 Factions – und der adäquate Umgang mit ihnen
2.3 Kritik am Konzept der Federalists
3. Weiterentwicklung des Verhältnisses zwischen Staat und Interessengruppen
4. Theoretische Konzepte des Einflusses organisierter Interessen
4.1 Pluralismus
4.2 Korporatismus und Neokorporatismus
4.3 Politische Netzwerke
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Beeinflussung politischer Entscheidungen durch Interessengruppen wird gegenwärtig von der deutschen Öffentlichkeit zwiespältig bewertet: Zwar wird das gemeinschaftliche Engagement in Bürgerinitiativen meist wohlwollend beurteilt, die Einflussnahme durch Lobbyisten jedoch wird oftmals als „schmutziges Geschäft“, als allgemein schädlich verurteilt. Dass es sich hier um Aktivitäten ähnlichen Charakters handelt, scheint in derartigen Überlegungen keine Rolle zu spielen.
In der politischen Ideengeschichte finden sich ebenfalls einige bekannte Theoretiker, welche allgemein die Natur des Menschen, aber auch im speziellen die Aktivitäten von Interessengruppen in Demokratien eher kritisch-pessimistisch einschätzen. An dieser Stelle kann man gewiss die Federalist Papers anführen, welche zur Frage, wie man das als potentiell schädlich erachtete Streben der Interessengruppen nach Durchsetzung ihrer Partikularinteressen in Zaum halten könne, explizit Stellung nehmen.
Die Federalist Papers waren ohne Zweifel Wegbereiter moderner Demokratietheorien. Jedoch haben sich die äußeren Bedingungen bedingt durch technischen und wissenschaftlichen Fortschritt in einem Ausmaß verändert, das ein Überdenken und Überarbeiten mancher ihrer Theorien notwendig erscheinen lässt. Ausgehend von der Prämisse, die Selbsterhaltung ist das erste, das Erreichen des (wie auch immer gearteten) Gemeinwohls das zweite Ziel eines jeden politischen Systems, soll die Frage beantwortet werden, wie ein demokratischer Staat bestmöglich mit der Vielfalt an Einflüssen durch organisierter Interessen umgehen sollte, um seinen Selbsterhalt zu garantieren und daraufhin das Gemeinwohl durchzusetzen. Dem Autor ist bewusst, dass „Gemeinwohl“ ein vieldiskutiertes, mitunter schwierig zu fassendes Konstrukt ist. Im folgenden soll Gemeinwohl als „Metapher für die Resultante im Kräfteparallelogramm der Gruppen“[1] verstanden werden.
Zunächst soll gezeigt werden, wie das Phänomen der Interessengruppen von den Federalists erörtert wurde. Darauf folgend sollen gegenwärtige theoretische Konzepte zur Beschreibung und Erklärung der Beteiligung der Interessengruppen vorgestellt werden; dabei wird es um Pluralismus, Korporatismus und politischer Netzwerke gehen.
2. Der Umgang mit Interessengruppen in den Federalist Papers
2.1 Die Federalist Papers
Die Federalist Papers sind eine Serie von 85 Artikeln, welche von 1787 bis1789 in New Yorker Zeitungen mit dem Ziel publiziert wurde, die Öffentlichkeit vom Verfassungsentwurf des Philadelphia-Konvents zu überzeugen.[2] Drei Autoren, namentlich James Madison, John Jay und Alexander Hamilton, traten unter dem Pseudonym „Publius“ in Erscheinung. Im Gegensatz zu den Anti-Federalists warben sie für eine starke Stellung des Bundes innerhalb des föderalistisch angelegten politischen Systems der USA. Sie vertraten damit hauptsächlich die Interessen der wohlhabenden Schichten.
2.2 Factions - und der adäquate Umgang mit ihnen
Unter dem Begriff der faction versteht James Madison, mutmaßlicher Autor des zehnten Artikels der Federalist Papers, eine entweder eine Mehrheit oder eine Minderheit der Bevölkerung zählende Menge an Bürgern, welche, durch gemeinsame Interessen oder Leidenschaften vereint, den Rechten anderer Bürger oder dem Gemeinwohl widerstreben.[3] Ursache für factions sind nach Madison die unterschiedlichen Besitzverhältnisse, welche wiederum auf die unterschiedlichen menschlichen Fähigkeiten zurückzuführen sind. Sie liegen also in der Natur des Menschen. Er sieht diese Art der Interessengruppen, basierend auf geschichtlichen Erfahrungen, als potentielle „tödliche Krankheit“, an der Demokratien scheitern können. Daher diskutiert er im zehnten Artikel verschiedene Möglichkeiten, der von ihnen ausgehenden Gefahr Herr zu werden: die Beseitigung der Ursachen auf der einen, die Kontrolle der Auswirkungen auf der anderen Seite.
Schnell wird jedoch klar, dass die Ursachen kaum im Rahmen einer Demokratie zu beseitigen sind, da doch Freiheit einen Grundpfeiler demokratischer Systeme darstellt. Die Ausstattung aller Bürger mit gleichen Meinungen, Leidenschaften und Interessen lehnt Madison als nicht verwirklichbar ebenfalls ab. Vielmehr wird die Regulierung von verschiedenen, sich gegenseitig zuwiderlaufenden Interessen als Hauptaufgabe moderner Gesetzgebung angesehen.
Die einzig verbleibende Alternative ist somit die Kontrolle der Auswirkungen der factions. Dies ist bei Minderheitenfactions weniger dringlich, da diese zwar die Administration blockieren und die Gesellschaft erschüttern können, jedoch nicht unter dem Deckmantel der Legitimität die Verfassung unter ihre Kontrolle zu bringen imstande sind. Die Machtergreifung einer Mehrheits faction wird von Madison aufgrund mehrerer Faktoren als unwahrscheinlich eingestuft: Zum einen sieht er hier die geographische und die Bevölkerungsgröße der USA als klaren Vorteil gegenüber kleinen Demokratien, welche seinen Ausführungen zufolge häufiger unter die Kontrolle von Mehrheitsfaktionen fallen. Durch die aus der Größe des Landes resultierende größere Anzahl von Faktionen wird es unwahrscheinlicher, dass eine einzige Faktion sich die Macht verschaffen kann, um die Rechte anderer zu beeinträchtigen. Durch den Föderalismus könnte es zwar in einzelnen Bundesstaaten gelegentlich zur (evtl. dem Gemeinwohl zuwiderlaufenden) Herrschaft einer Faktion kommen, dies ist aber auf Bundesebene höchst unwahrscheinlich. Zudem scheint ihm die Repräsentation des Volkes durch den Kongress der Direktdemokratie überlegen, da Repräsentanten die Meinungen der repräsentierten Öffentlichkeit verfeinern und erweitern, so dass das Resultat in Form verabschiedeter Gesetze dem Gemeinwohl eher förderlich ist als die (eventuell radikalen) Partikularinteressen der Bürger.
2.3 Kritik am Konzept der Federalists
Aus Madisons Definition der factions geht nicht klar hervor, ob er alle Interessengruppen als den Freiheiten anderer und dem Gemeinwohl zuwiderlaufend betrachtet oder ob er nur die schädlichen gearteten Interessengruppen zum Gegenstand seiner Ausführungen machen wollte, aber stillschweigend davon ausgegangen ist, dass auch dem Gemeinwohl nutzbringende Faktionen existieren können. Nachdem James Madison nicht mehr unter den Lebenden weilt, kann diese Frage nicht mit letzter Sicherheit beantwortet werden und nunmehr Objekt von Spekulationen sein.
Sollte er alle Interessengruppen a priori als gemeinwohlschädlich einstufen, so muss man sich fragen, warum er überhaupt die Demokratie befürwortet. Schließlich ist sie – durch die für sie elementare Freiheit ihrer Bürger – der bestmögliche Nährboden für die Entstehung von Interessengruppen gemeinwohlschädlichen Charakters. Im 10. Artikel geht er hierauf kurz ein, wobei er factions als „kleineres Übel“ der Unfreiheit der Menschen vorzieht.[4] Jedoch müsste er sich, weilte er noch unter den Lebenden, die Frage gefallen lassen, ob nicht ein besonnener Monarch ein besserer Herrscher wäre als ein Volk, bestehend aus Interessengruppen, welche nichts besseres zu tun haben, als das Gemeinwohl zu unterminieren. Sicherlich besteht in Monarchien stets die Gefahr eines – durch den Stil des jeweiligen Herrschers herbeigeführten - Wandels zur Tyrannei. Ob jedoch in einer von schädlichen Interessengruppen durchsetzten „freien“ Demokratie die Wahrscheinlichkeit der Machtergreifung durch eine zur Erwirkung des Gemeinwohls ungeeignete Regierung geringer ist als die Wahrscheinlichkeit einer sich aus der Erbfolge einer Monarchie ergebenden Tyrannei, konnte Madison seinerzeit wohl kaum quantitativ überprüfen. Dennoch entschied er sich, wie wir wissen, für die Demokratie.[5]
Sollte Madison stillschweigend annehmen, dass auch gemeinnützige Interessengruppen existieren bzw. existieren könnten, bleibt offen, weshalb diese wohlgesonnenen Kräfte verschwendet werden bzw. sich nicht von der Administration nutzbar gemacht werden sollen.
3. Weiterentwicklung des Verhältnisses zwischen Staat und Verbänden
Im Laufe der Zeit hat sich die arbeitsteilige Gesellschaft - insbesondere das ökonomische System – mehr und mehr ausdifferenziert. Diese Komplexitätssteigerung übertrug sich in der Folge auch auf den Prozess des Regierens. An komplexen Entscheidungen wirken Interessengruppen insofern mit, als das sie wertvolles Wissen beisteuern, ihre Standpunkte verdeutlichen und im Gegenzug eine Beeinflussung des jeweiligen Vorhabens zu ihren Gunsten ersuchen. Diesem Prozess des Gebens und Nehmens kann Tauschcharakter attestiert werden; das Verhältnis zwischen dem Lobbyisten (als Vertreter seiner Interessengruppe) und seinem Gegenüber auf der staatlichen Seite hat symbiotischen Charakter.[6]
In der empirischen Realität waren jedoch auch komplexere Kooperationen zu beobachten: in auf einzelne Politikfelder begrenzten, so genannten „Konzertierten Aktionen“ setzten sich Vertreter von Staat und verschiedenen Interessengruppen an einen „runden Tisch der Vernunft“[7], um gemeinsam Positionen abzustimmen, Aktivitäten auszuarbeiten und auch gemeinsam durchzuführen. Hierbei wurde also nicht nur bei der Ausarbeitung, sondern auch der Durchsetzung der jeweiligen Vorhaben von Seiten der organisierten Interessengruppen[8] mitgewirkt.
4. Theoretische Konzepte des Einflusses organisierter Interessen
4.1 Pluralismus
Der Einbezug von Interessengruppen im politischen Prozess war in der Vergangenheit Gegenstand intensiver Untersuchungen und engagiert geführter Theoriedebatten. Am Ursprung standen Theorien des Pluralismus. Mit Pluralismus ist allgemein Vielgliedrigkeit gemeint[9]. Schon die Federalists waren, trotz ihres den Interessengruppen gegenüber skeptischen Tenors, von der Notwendigkeit der Einbindung derselben in den politischen Prozess überzeugt:
“The regulation of these various and interfering interests forms the principal task of modern legislation, and involves the spirit of party and faction in the necessary and ordinary operations of the government.”[10]
Hans Kelsen, an politischer Theorie interessierter Jurist, entwickelte die Idee des Pluralismus weiter, indem er ihn in seine Definition des Staats einbaute. Nach Kelsen ist der Staat nichts anderes als
„die als Satzung verstandene Rechtsordnung, die im Falle einer demokratischen Ordnung die Interessenkonflikte der pluralistischen Gruppen in der Gesellschaft verfahrensmäßig regelt“[11].
Davon ausgehend, dass die Entscheidungsfindung durch Rechtsordnung (= den Staat) prozeduralisiert ist, stellt sich nun die Frage, wie detailliert diese Prozeduralisierung in der Verfassung und in den Gesetzen des jeweiligen Staates ausgestaltet sein sollte, und in welchem Maße den betroffenen Akteuren von Fall zu Fall die Mittel und Wege, welche zur individuellen Entscheidung führen, zur freien Disposition überlassen bleiben sollen. Zur Wahrung größtmöglicher bürgerlicher Freiheit und zur Vermeidung von Verschwendung durch eine übermäßig ausgeprägte Bürokratie scheint es jedenfalls ratsam, den kollektiven Entscheidungsprozess nur soweit zu prozeduralisieren, wie dies zum Selbsterhalt der Demokratie notwendig ist.[12]
4.2 Korporatismus und Neokorporatismus
Der Begriff des Neokorporatismus umschreibt die – im Gegensatz zu staatlich verordneten älteren Korporatismusansätzen - freiwillige Beteiligung einer begrenzten Anzahl an Verbänden am politischen Prozess mit dem Charakter eines runden Tisches der Vernunft (siehe Kap. 3). Dabei wurden je nach Theorievatiante unterschiedliche konstitutive Elemente identifiziert.[13] Nachdem führende Vertreter schon das Jahrhundert des Korporatismus[14] ausgerufen und im korporatistischen Arrangement „eine weitere Entwicklungsstufe des westlichen Kapitalismus“[15] vermutet hatten, normalisierte und relativierte sich diese Haltung in den folgenden Dekaden. Die zahlreichen Forschungsprojekte führten zwar zu vielen Detailergebnissen, letztendlich wurde dadurch aber das ursprüngliche Konzept verwässert. Nach Ulrich von Alemann beispielsweise ist Korporatismus „kein neues System, sondern nur eine Strategie, ein Instrument, manchmal auch nur eine kleine politische Taktik.“[16] Heute könnte man Korporatismus als „institutionalisierte und gleichberechtigte Beteiligung gesellschaftlicher Verbände an der Formulierung und Ausführung staatlicher Politik“[17] bezeichnen.
4.3 Politische Netzwerke
Nachdem sich der Korporatismusansatz als primäres Modell zur Erklärung der komplexen Beziehungsgeflechte zwischen staatlichen und gesellschaftlichen Akteuren aus vielerlei Gründen nicht halten konnte, bietet eventuell der Netzwerkansatz hilfreiche Analyseinstrumente. Netzwerke bezeichnen „ein Geflecht sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Beziehungen, das mehr oder weniger auf Kontinuität angelegt ist, auf Freiwilligkeit und auf Gegenseitigkeit beruht.“[18]
Hierbei soll sich „die empirische Vielfalt von Interessenvermittlungskonfigurationen durch die Variationen einiger zentraler Dimensionen beschreiben“[19] lassen. Akteure, Netzwerk-Funktionen, Netzwerk-Strukturen, Verfahrensregeln, Machtverteilung und Akteursstrategien zählen hierbei zu den bedeutenden Dimensionen.[20] Allerdings ist der Netzwerkansatz keine Fortsetzung der Pluralismus – und Korporatismustheorien; vielmehr stellt er ein Sammelsurium an Werkzeugen zur Analyse der Empirie bereit.[21]
5. Fazit
Nach allem bisher gesagten scheint die Einbindung organisierter Interessen in den politischen Prozess, wie auch immer sie ausgestaltet sein möge, aus mehreren Gründen ein unverzichtbares Element demokratischer politischer Systeme zu sein. Zum einen liefern Konsultationen wichtige Impulse zur Gestaltung von Gesetzesvorhaben, verhindern bzw. begrenzen an den Realitäten vorbeigehende Planungen und sorgen somit für eine „Erdung“ der Politiker, eine Bindung der Repräsentanten an die Repräsentierten. Dadurch wird die Effizienz des Entscheidungsfindungsprozesses gesteigert.
Zum anderen kann die Möglichkeit, sich außerhalb von Parteien für einzelne Interessen einzusetzen, für eine Akzeptanz des politischen Systems in den Köpfen der Repräsentierten sorgen. Partizipation in Interessengruppen kann in Zeiten, in denen gelegentlich über Politik- und Parteienverdrossenheit geklagt wird, eine Chance zur Steigerung des Ansehens unserer Demokratie in der bundesdeutschen Gesellschaft sein. Das würde zum Ziel des Selbsterhalts der Demokratie beitragen.
Literaturverzeichnis
Czada, R., Korporatismus, in: Schmidt, M. G. (Hrsg.), Die westlichen Länder. Lexikon der Politik Bd. 3, München 1992.
Hamilton, Alexander / Maidson, James / Jay, John, Die Federalist-Artikel. Politische Theorie und Verfassungskommentar der amerikanischen Gründerväter, hrsg. U. übers, v, Angela u. Willi Paul Adams, Paderborn 1994.
Lahusen, Christan/Jauß, Claudia, Lobbying als Beruf. Interessengruppen in der europäischen Union, Baden-Baden 2001.
Madison, James, Federalist No. 10. The Same Subject Continued: The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection, in: Hamilton, Alexander / Maidson, James / Jay, John, The Federalist Papers, http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_10.html, (19. 08. 2006).
Schmidt, Manfred G., Demokratietheorien, Opladen 21997.
Schubert, Klaus, Neo-Korporatismus – und was dann?, in: Woyke, Wichard (Hrsg.), Verbände. Eine Einführung, Schwalbach/Ts. 2005.
Sebaldt, Martin, Organisierter Pluralismus. Kräftefeld, Selbstverständnis und politische Arbeit deutscher Interessengruppen, Opladen 1997.
Schmitter, P. C., Still the Century of Corporatism?, in: Review of Politics, Jg. 36, Nr. 1 (1974), S. 85-131.
van Ooyen, Robert Chr., Der Staat der Moderne. Hans Kelsens Pluralismustheorie, Berlin 2003.
von Alemann, Ulrich, Vom Korporatismus zum Lobbyismus. Die Zukunft der Verbände zwischen Globalisierung, Europäisierung und Berlinisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 26-27 (2000).
von Beyme, Klaus, Interessengruppen in der Demokratie, München 51980.
[...]
[1] von Beyme, Klaus, Interessengruppen in der Demokratie, München 51980, S. 15.
[2] Vgl. Hamilton, Alexander / Maidson, James / Jay, John, Die Federalist-Artikel. Politische Theorie und Verfassungskommentar der amerikanischen Gründerväter, hrsg. U. übers, v, Angela u. Willi Paul Adams, Paderborn 1994, S. xxvii.
[3] Vgl. Madison, James, Federalist No. 10. The Same Subject Continued: The Union as a Safeguard Against Domestic Faction and Insurrection, in: Hamilton, Alexander / Maidson, James / Jay, John, The Federalist Papers, http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_10.html, (19. 08. 2006). Dies stellt eine am Sinn des Textes orientierte Übersetzung des Autors dar.
[4] Vgl. ebd.
[5] Die Wissenschaft stellte um das Jahr 1790 noch nicht die Vielfalt an statistischen Analyseverfahren bereit, wie dies heute der Fall ist. Insofern kann man Madison sogar – entgegen der Ansicht, die Federalists seien höchst pessimistisch – ein gewisses Maß an Optimismus attestieren.
[6] Vgl. Sebaldt, Martin, Organisierter Pluralismus. Kräftefeld, Selbstverständnis und politische Arbeit deutscher Interessengruppen, Opladen 1997, S. 241.
[7] Schubert, Klaus, Neo-Korporatismus – und was dann?, in: Woyke, Wichard (Hrsg.), Verbände. Eine Einführung, Schwalbach/Ts. 2005, S. 13 f.
[8] Zur Unterscheidung zwischen organisiertem und spontanem Gruppenpluralismus vgl. M. Sebaldt, a.a.O. (Anm. 5), S. 14 f.
[9] Vgl. Schmidt, Manfred G., Demokratietheorien, Opladen 21997, S. 152.
[10] Madison, James, a.a.O. (Anm. 3).
[11] van Ooyen, Robert Chr., Der Staat der Moderne. Hans Kelsens Pluralismustheorie, Berlin 2003, S. 26.
[12] Vgl. zum Für und Wider formalisierter Konsultationspraktiken (auf der Ebene der europäischen Union): Lahusen, Christan/Jauß, Claudia, Lobbying als Beruf. Interessengruppen in der europäischen Union, Baden-Baden 2001, S. 207 f.
[13] Vgl. Klaus Schubert, a.a.O. (Anm. 7), S. 12.
[14] Vgl. Schmitter, P. C., Still the Century of Corporatism?, in: Review of Politics, Jg. 36, Nr. 1 (1974), S. 85-131.
[15] Klaus Schubert, a.a.O. (Anm. 7), S.12.
[16] von Alemann, Ulrich, Vom Korporatismus zum Lobbyismus. Die Zukunft der Verbände zwischen Globalisierung, Europäisierung und Berlinisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 26-27 (2000), S. 3.
[17] Czada, R., Korporatismus, in: Schmidt, M. G. (Hrsg.), Die westlichen Länder. Lexikon der Politik Bd. 3, München 1992, S. 218.
[18] Klaus Schubert, a.a.O. (Anm. 7), S. 29.
[19] Ebd., S. 30.
[20] Vgl. Ebd., S. 30 ff.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Federalist Papers und warum sind sie wichtig?
Die Federalist Papers sind eine Sammlung von 85 Artikeln, die zwischen 1787 und 1789 in New Yorker Zeitungen veröffentlicht wurden. Ihr Ziel war es, die Öffentlichkeit von der Verfassung zu überzeugen. Die Artikel wurden von James Madison, John Jay und Alexander Hamilton unter dem Pseudonym "Publius" verfasst. Sie argumentierten für eine starke Bundesregierung innerhalb des föderalistischen Systems der USA.
Was versteht James Madison unter dem Begriff "faction" (Interessengruppe)?
James Madison definiert eine "faction" als eine Gruppe von Bürgern, ob Mehrheit oder Minderheit, die durch gemeinsame Interessen oder Leidenschaften vereint sind und den Rechten anderer Bürger oder dem Gemeinwohl zuwiderhandeln.
Wie bewerteten die Federalists Interessengruppen?
Die Federalists, insbesondere Madison, betrachteten Interessengruppen als potenziell schädlich für Demokratien. Er sah sie als eine "tödliche Krankheit", an der Demokratien scheitern können. Er diskutierte verschiedene Möglichkeiten, die von ihnen ausgehende Gefahr zu kontrollieren, entweder durch die Beseitigung der Ursachen oder die Kontrolle der Auswirkungen.
Warum befürwortete Madison die Demokratie, obwohl er Interessengruppen kritisch sah?
Madison zog die Demokratie vor, weil er die Freiheit ihrer Bürger als elementar ansah, obwohl sie den Nährboden für Interessengruppen böte. Er sah die Kontrolle der Auswirkungen von Interessengruppen als das "kleinere Übel" im Vergleich zur Unfreiheit der Menschen.
Welche theoretischen Konzepte werden zur Beschreibung und Erklärung des Einflusses organisierter Interessen vorgestellt?
Es werden drei theoretische Konzepte vorgestellt: Pluralismus, Korporatismus/Neokorporatismus und politische Netzwerke.
Was ist Pluralismus im Kontext des Einflusses von Interessengruppen?
Pluralismus bezieht sich auf die Vielgliedrigkeit und die Notwendigkeit der Einbindung von Interessengruppen in den politischen Prozess. Hans Kelsen definierte den Staat als eine Rechtsordnung, die die Interessenkonflikte der pluralistischen Gruppen in der Gesellschaft verfahrensmäßig regelt.
Was ist Korporatismus/Neokorporatismus?
Neokorporatismus beschreibt die freiwillige Beteiligung einer begrenzten Anzahl von Verbänden am politischen Prozess mit dem Charakter eines "runden Tisches der Vernunft", im Gegensatz zu staatlich verordneten älteren Korporatismusansätzen.
Was sind politische Netzwerke?
Politische Netzwerke bezeichnen ein Geflecht sozialer, wirtschaftlicher oder politischer Beziehungen, das auf Kontinuität, Freiwilligkeit und Gegenseitigkeit beruht. Der Netzwerkansatz bietet Analyseinstrumente, um die empirische Vielfalt von Interessenvermittlungskonfigurationen zu beschreiben.
Welche Rolle spielen Interessengruppen im politischen Prozess gemäß dem Text?
Der Text argumentiert, dass die Einbindung organisierter Interessen in den politischen Prozess ein unverzichtbares Element demokratischer politischer Systeme ist, da sie wichtige Impulse zur Gestaltung von Gesetzesvorhaben liefern, realitätsferne Planungen verhindern und die Akzeptanz des politischen Systems fördern.
Was ist das Fazit des Textes bezüglich der Einbindung organisierter Interessen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass die Einbindung organisierter Interessen in den politischen Prozess aus mehreren Gründen ein unverzichtbares Element demokratischer politischer Systeme ist. Sie liefern wichtige Impulse, verhindern unrealistische Planungen und fördern die Akzeptanz des politischen Systems.
- Quote paper
- Jan Ulrich de Groot-Rouenhoff (Author), 2006, Factions: Zweckmäßiger Umgang mit Interessengruppen im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110618