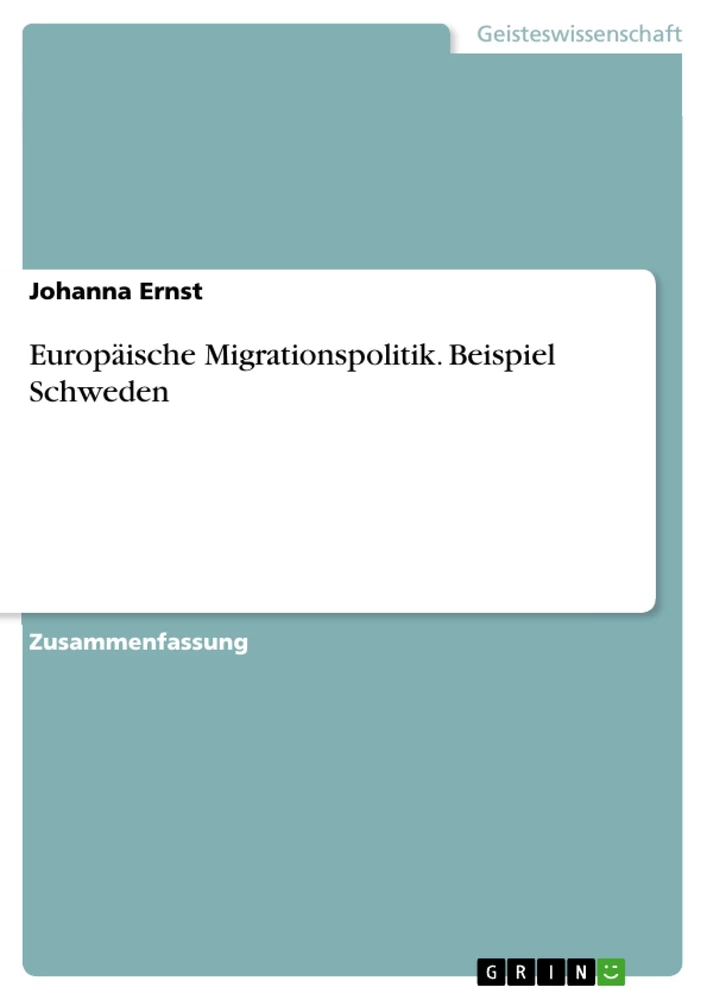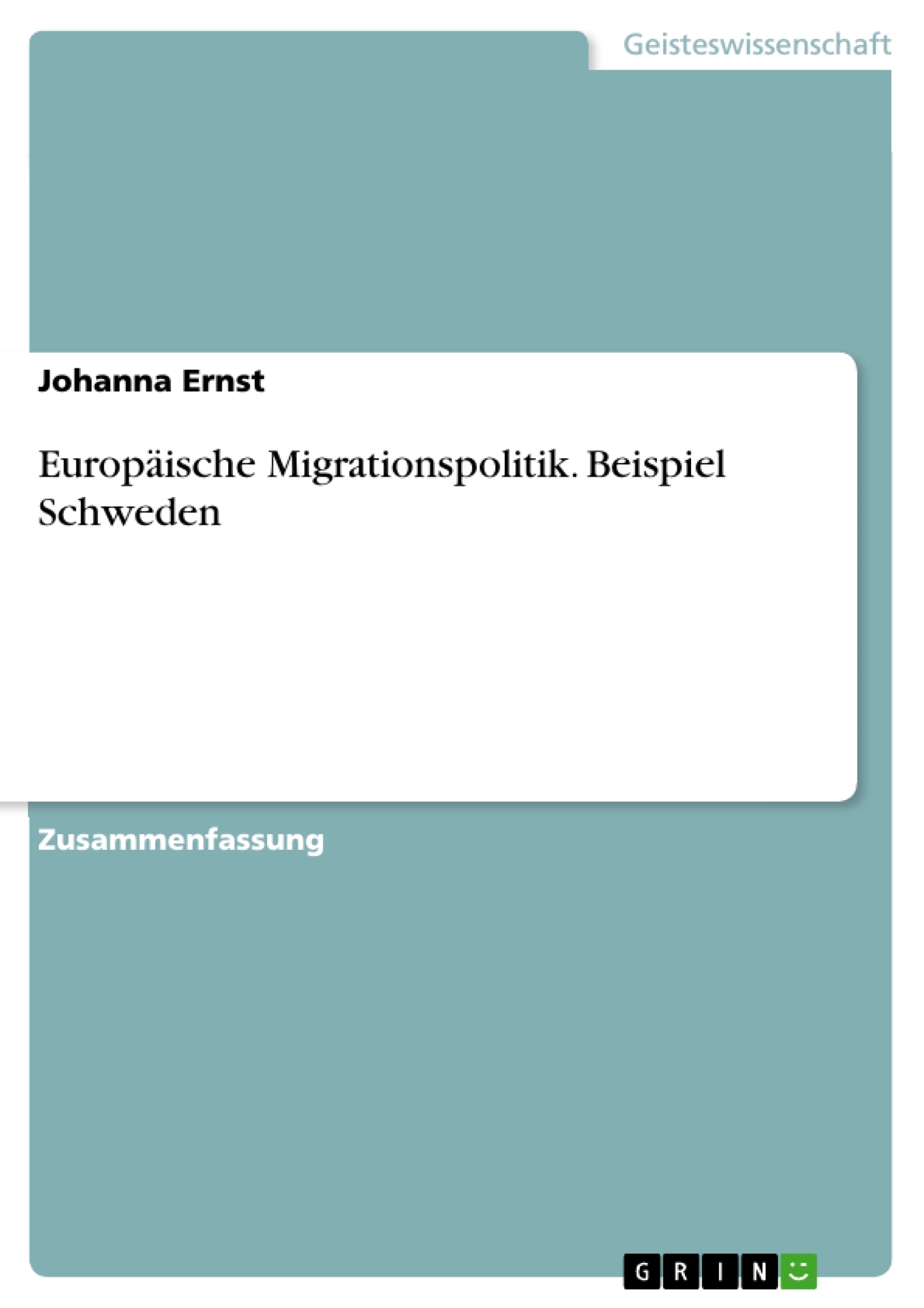Schweden gilt allgemein als ein multikulturelles Land dessen Migrationsströme über die vergangenen Jahrzehnte stetig zugenommen haben und das sich in den letzten 150 Jahren von einem Emigrations- zu einem Immigrationsland gewandelt hat.
Aktuell gilt Schweden als eines der Hauptzielländer für schutzsuchende Flüchtlinge und Asylbewerber in Europa. 2014 verzeichnetet das Land seinen bisherigen Höhepunkt an Asylanträgen, wobei die meisten Anträge von Personen aus Nordafrika und dem Nahen Osten gestellt wurden.
Eine Zusammenfassung über die Texte: Länderprofil Schweden: Focus Migration und Sund, Erik Magnus / Gärtner, Teresa: Schweden (in: Handbuch europäischer Migrationspolitiken)
von Johanna Ernst
Proseminar „Asyl und Flucht: Europäische Migrationspolitik im Vergleich“
1. Schwedens Migration und deren geschichtliche Entwicklung
Schweden gilt allgemein als ein multikulturelles Land dessen Migrationsströme über die vergangenen Jahrzehnte stetig zugenommen haben und das sich in den letzten 150 Jahren von einem Emigrations- zu einem Immigrationsland gewandelt hat.
Aktuell gilt Schweden als eines der Hauptzielländer für schutzsuchende Flüchtlinge und Asylbewerber in Europa. 2014 verzeichnetet das Land seinen bisherigen Höhepunkt an Asylanträgen, wobei die meisten Anträge von Personen aus Nordafrika und dem Nahen Osten gestellt wurden.
Bis zum zweiten Weltkrieg spielt das Thema Migration für Schweden jedoch eine untergeordnete Rolle und erst durch die gravierenden Folgen dieses Krieges erfährt das Land die ersten großen Einwanderungsströme. Nach dem Krieg entwickelt sich Schweden zur führenden Wirtschafts- und Industrienation des Nordens und beginnt in den sechziger Jahren mit einer aktiven Anwerbung von Arbeitsmigranten, deren Aufenthalt jedoch von Beginn an nicht als temporärer nach dem Vorbild der „Gastarbeiter“ gedacht war, denn stattdessen erwartet man eine baldige Integration der Arbeitsmigranten und deren Entwicklung zum Staatsbürger. In den siebziger Jahren wird diese aktive Anwerbung dann aufgrund einer stagnierenden schwedischen Wirtschaftsentwicklung gestoppt, die Wanderungsbewegung nach Schweden setzt sich jedoch durch den laufenden Familiennachzug der Arbeitsmigranten fort. Man möchte die Erfordernisse des Arbeitsmarktes fortan nicht über ausländische Arbeitskräfte sondern über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen selbst lösen. Außerdem steigt die Anzahl außereuropäischer Asylbewerber und Flüchtlinge weiter an, wobei die Immigration von Flüchtlingen nach Schweden Mitte der neunziger Jahre ihren bis dato Höhepunkt erreicht. Während zwischen 1995 und 2005 die Einwanderungszahlen stagnieren, erreicht das Einwanderungssaldo 2010 wieder Rekordniveau.
Im Zuge der EU-Erweiterung im Jahr 2004 führt Schweden im Gegensatz zu anderen Mitgliedsstaaten keine Beschränkung der Freizügigkeit für die neu dazukommenden Mitgliedstaaten ein. Die Aufnahme der Länder Bulgarien und Rumänien in die EU hat einen deutlichen Anstieg der Einwanderung aus diesen Ländern nach Schweden zur Folge. Schweden verzeichnete zwischen 2005 und 2010 einen stetigen Anstieg der Bildungsmigration. Der Anteil der Personen die nach Schweden als Arbeitsmigranten kommen und nicht Staatsangehörige eines EU Mitgliedstaats sind liegt in den Jahren ab 2012 jährlich zwischen 15 000 und 20 000 Personen.
Im Jahr 2014 erreicht das Einwanderungssaldo Schwedens seinen bisherigen Höhepunkt. Beachtlich ist, dass im selben Jahr auch das Abwanderungssaldo Werte erreichte die es seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr gegeben hatte. Die Tatsache, dass 63 % dieser abwandernden Personen zuvor nach Schweden eingewanderte Personen gewesen waren kann als Bestätigung dafür gesehen werden, dass Schweden mit seiner Migrationspolitik eine zirkuläre Migration zu fördern versucht. Diese wird im weiteren Verlauf noch einmal angesprochen.
In den letzten Jahren hat die Zahl der Einwanderer aus EU-Staaten die nicht dem Norden angehören oder aus Afrika und Asien stammen deutlich zugenommen.
Bei Personen die weder EU-Bürger noch Staatsangehörige des Nordischen Rats sind gilt die Familienzusammenführung in diesen Jahren als häufigster Grund für eine Einwanderung nach Schweden. 2014 wurden fast 60% der gestellten Asylanträge bewilligt. Vor allem Asylanträge aus Syrien werden zu diesen gezählt. Der Anteil minderjähriger Asylsuchender an allen Asylsuchenden ist in Schweden besonders hoch. Dies könnte an dem hohen Unterbringungs- und Versorgungsstandard sowie den guten Aussichten der Schutzgewährung in diesem Land liegen. Allgemein gilt Schweden als ein Staat mit hohen Wohlstandsniveau, geringer Arbeitslosigkeit und einem hohen Maß an sozialer Sicherheit. Diese Eigenschaften machen es attraktiv für Asylbewerber. Die Zahl der Migranten in Schweden, die sich dort ohne legale Aufenthaltserlaubnis befinden wird zwischen 10 000 und 35 000 Personen geschätzt. Darunter sind vor allem Personen die, aufgrund eines abgelehnten Asylantrags und der Angst sowie der Flucht vor der Abschiebung oder der Überstellung in ein anderes EU-Land nach dem Dublin Vertrag, untergetaucht sind. Ein- und Ausreisen von abgelehnten Asylbewerbern können wegen den durch das Schengener Abkommen fehlenden Grenzkontrollen kaum kontrolliert werden. Im Vergleich zu anderen EU Ländern ist die Zahl irregulärer Migranten in Schweden jedoch gering. Ein Leben in Illegalität ist in Schweden erschwert, da ohne eine persönliche Identifikationsnummer die alle Bürger und legalen Einwanderer in Schweden erhalten, keinerlei staatliche Leistungen in Anspruch genommen werden können, außerdem kein Bankkonto und kein Telefonanschluss beantragt werden kann.
Ein Leben auf der Straße ist aufgrund der kalten Temperaturen erschwert und durch den hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad können Asylsuchende in irregulärer Beschäftigung nur selten einen Job finden. Seit 2005 wird über das reformierte Asylgesetz versucht Personen bei denen der Ausweisungsbeschluss nicht vollzogen werden konnte, durch die Möglichkeit eines neuen Asylantrags, zu regularisieren. Ein seit 2013 neu in Kraft getretenes Gesetz ermöglicht Kindern irregulärer Migranten den Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem.
2. Schwedens Migrationspolitik
Schwedens Migrationspolitik kann unter dem Begriff der offenen Migrationspolitik zusammengefasst werden, welcher beinhaltet, dass diese Politik migrationspolitische Ziele wie den Schutz des Asylrechts, die Förderung einer nachfrageorientierten Arbeitsmigration und die Erleichterung grenzüberschreitender Migration forciert sowie die europäische und internationale Kooperation zur Erreichung dieser Ziele stärkt.
Schwedens Migrationspolitik zeichnet sich weiterhin durch den Aspekt der Gleichberechtigung aus. Beispielsweise hat jeder legale Migrant nach einjährigem Aufenthalt dieselben Zugangsmöglichkeiten zum Gesundheitswesen und zu sozial- und wohlfahrtsstaatlichen Leistungen wie schwedische Staatsangehörige. Weiterhin wird die Arbeitsmigration durch verschiedene Zugangserleichterungen zum Arbeitsmarkt gefördert und durch die Forcierung der zirkulären Migration mit Hilfe einiger gesetzlicher Regelungen die Mobilität nach und aus Schweden erleichtert. Ein 2014 vom Parlament bestätigte Gesetzesentwurf soll zirkuläre Migration in Schweden begünstigen. Schweden distanziert durch seine Regelungen von einer gesteuerten zirkulären Migration und lehnt eine festgelegte Aufenthaltszeit für die Migranten ab. Diese sollten die Entscheidung über das Verlassen von oder die Rückkehr nach Schweden eigenständig fallen können.
Die gesetzliche Grundlage der schwedischen Migrationspolitik bildet das Ausländergesetz und der dazugehörige Ausländererlass. Allgemein orientiert sich das schwedische Ausländergesetz an dem Bedarf Schutz und Sicherheit zu bieten. Die Abweisung von Personen, die nach den Regelungen der Genfer Flüchtlingskommission von Verfolgung bedroht sind, ist streng verboten.
Das schwedische Ausländergesetz wurde im Zuge der Umsetzung von EU-Richtlinien und Verordnungen bezüglich beispielsweise Asyl und Grenzschutz angepasst. Der Zuzug von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten ist aufgrund der aktuellen Regelungen nur geringfügig durch staatliche Stellen steuerbar und hängt grundsätzlich nur von der Nachfrage schwedischer Arbeitgeber und weniger von den Erfordernissen der nationalen Wirtschaftssituation ab. Für durch Arbeitgeber angeworbene Arbeitskräfte aus Drittstaaten wird eine vom Qualifikationsniveau des Arbeitnehmers unabhängige Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ausgestellt.
Die schwedische Arbeitsmigrationspolitik ist eng mit dem Asylsystem verzahnt. Beispielsweise haben Migranten bei Ablehnung ihres Asylantrags die Möglichkeit eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Erwerbstätigkeit zu beantragen, welche erteilt wird, wenn der Antragsteller zu diesem Zeitpunkt schon 4 Monate in Schweden gearbeitet hat und das Beschäftigungsverhältnis fortgesetzt wird.
Am nachfrageorientierten Ansatz der schwedischen Arbeitsmigrationspolitik wird oft Kritik geübt. Beispielsweise bestehe die Gefahr, dass unseriöse Arbeitgeber Schlupflöcher des Systems für ihre Zwecke missbrauchen. Diese können den Arbeitsmigranten zum Beispiel ohne Probleme zu niedrige Löhne zahlen, oder diese finanziell erpressen, da die immigrierten Personen dringend die an den Job gebundene Aufenthaltsgenehmigung benötigen. Die schwedische Migrationsbehörde versucht beispielsweise durch verstärkte Kontrollen der jeweiligen Betriebe diesem Problem entgegen zu arbeiten. Ein Indiz dafür, dass die vermehrten Kontrollen Wirkung zeigen, könnte der Rückgang an aus Drittstaaten stammenden Beschäftigten die in Tätigkeitsbereichen mit niedriger Qualifizierung arbeiten sein.
Eine Besonderheit der migrationspolitischen Situation Schwedens markiert das seit 1954 bestehende Bündnis zwischen Schweden, Norwegen, Dänemark und Island später auch Finnland, um einen gemeinsamen Arbeitsmarkt zu schaffen (Nordischer Rat). Staatsangehörige dieser Länder können zwischen den kooperierenden Staaten pendeln und überall ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis arbeiten.
Außerdem haben in Schweden sogenannte staatliche „Resettlement-Programme“ eine lange Tradition. Über durch die Regierung festgelegte Quoten wählen die Migrationsbehörde und das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) Flüchtlinge aus denen ein Aufenthaltsrecht gewährt wird. Die Flüchtlinge erhalten im Rahmen dieses Programms vor ihrer Ankunft Orientierungskurse über die Kultur und das Leben in Schweden und werden dann in einer bestimmten Gemeinde untergebracht.
3. Schwedens Integrationspolitik
Die Integrationspolitik Schwedens gilt allgemein als eine sehr erfolgreiche. Trotz der Hinwendung Schwedens in Richtung einer liberalen Marktwirtschaft, besticht der Staat weiterhin mit einem großen öffentlichen Sektor und einem ausgebauten sozialen Sicherungssystem an welchem schwedische Staatsbürger wie Migranten gleichermaßen beteiligt sind.
Im Schweden der sechziger und siebziger Jahre ist die Migrationspolitik stark vom sozialdemokratischen Denken geprägt. Dies spiegelt sich beispielsweise in dem im Jahr 1968 erlassenen Gleichheitsprinzip wieder, welches für Staatsbürger und immigrierte Personen den selben Lebensstandard vorsieht, wobei Einwanderer damals dazu aufgefordert sind ihre Kultur auch bei einem sesshaften Leben in Schweden aufrechtzuerhalten und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der schwedischen Bevölkerung und den ethnischen Minderheiten angestrebt wird. Außerdem versucht man Möglichkeiten für eine politische Beteiligung der Migranten zu schaffen. Durch verschiedene staatliche Subventionen versucht man außerdem den Migranten mehr öffentliches Gehör zu verschaffen und es werden Regelungen gegen Diskriminierung von Migranten in allen Gesellschaftsbereichen veranlasst. Der in den achtziger Jahren zunehmende Flüchtlingsstrom bringt Schweden in eine Lage, in der es nicht mehr möglich ist die großzügige und von Gleichberechtigung geprägte Einwanderungspolitik weiterzuführen. Eine verstärkte Zuwanderungskontrolle und eine Betonung gemeinsamer Werte zur Stärkung der gesellschaftlichen Einheit statt der Belobigung des Multikulturalismus sind die Folge.
Heutzutage sind eine gezielte Förderung von Aus- und Weiterbildung sowie eine aktive Arbeitsplatzvermittlung die zentralen Bauteile der schwedischen Integrationspolitik. Schwedens Regierung versucht in der Vergangenheit lange Zeit über seine „Ganz-Schweden Politik“ eine Verteilung der Asylbewerber über das ganze Land zu erzielen, um Konzentrationen von Asylbewerbern an bestimmten Orten zu vermeiden. Als problematisch erweist sich dieses Konzept jedoch aufgrund der geringen Anzahl an Arbeitsplätzen in beispielsweise überalterten Gemeinden mit einem hohen Abwanderungssaldo die als Aufnahmeorte für Asylbewerber eingesetzt wurden. Die Folge war, dass Asylbewerber von diesen Regionen in die Städte zogen, wo es mehr freie Stellen gab. Dort kam für sie jedoch nur Wohnraum in den Vororten, wodurch es zu einer immer stärkeren Segregation der Asylbewerber und großen sozialen Spannungen in diesen Orten kommt.
Heutzutage versucht die schwedische Regierung dieser Segregation entgegenzuwirken der strikte Verteilungsschlüssel für Asylbewerber wurde aufgehoben.
Das Staatsangehörigkeitsgesetz in Schweden erweist sich als relativ liberal und beruht auf Elementen des Abstammungs- als auch des Territorialprinzips. Für die Einbürgerung über das Territorialprinzip sind eine gewisse Anzahl an Aufenthaltsjahren in Schweden und eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung notwendig. Kenntnisse über Sprache und landesspezifisches Wissen sind für den Erhalt der Staatsbürgerschaft nicht entscheidend. Bei Flüchtlingen und staatenlose Personen wurde die Dauer des notwendigen Aufenthalts in Schweden um die Staatsbürgerschaft zu erhalten reduziert. Außerdem wird Mehrstaatlichkeit ausnahmslos akzeptiert. Die Regelungen für den Erhalt der schwedischen Staatsangehörigkeit durch die Geburt wurden ebenfalls gelockert.
4. Schwedens migrationspolitische Problemlagen
Die seit 2010 zunehmende Einwanderung verursacht für Schweden verschiedene Probleme. Schweden ist mit einer erhöhten Arbeitslosenquote unter den Migranten und Wohnungsknappheit für Zuwanderer konfrontiert. Begrenzter Wohnraum und begrenzte Kapazitäten des schwedischen Arbeitsmarktes führen unter den immigrierten Menschen zu einer Verschlechterung der Lebensverhältnisse und erzeugen Handlungsdruck innerhalb der Regierung. Die eher von Rezession gezeichnete schwedische Wirtschaft der neunziger Jahre bedingt eine zunehmende Arbeitslosigkeit von Migranten, da diese vorwiegend in konjunkturabhängigen Beschäftigungsfeldern mit niedrigen Qualifikationsstandards zu finden waren und für diese Schwierigkeiten bestanden ihre im Ausland erbrachten Ausbildungsleistungen in Schweden anerkennen zu lassen.
Die Aufnahme- und Unterbringungssysteme für Asylbewerber in Schweden geraten aufgrund der steigenden Anzahl an Anträgen immer mehr unter Druck. Dieses System stellt Asylbewerbern Wohnraum zur Verfügung und unterstützt sie bei der Deckung der Kosten für ihren Lebensunterhalt. Bei einem positiven Ausgang des Asylverfahrens werden die Personen sofort einer Gemeinde zugeteilt und in der schwedischen Landessprache sowie in schwedischer Gesellschaftskunde unterrichtet. Gemeinden sowie die leitende Migrationsbehörde Schwedens arbeiten bei der Verteilung der Asylbewerber zusammen. Dabei können Gemeinden zwar über die Frage der Aufnahme und der Anzahl an Aufnahmen entscheiden, jedoch kann die Migrationsbehörde bei mangelnden Plätzen für Asylbewerber unabhängig von den Gemeinden über den freien Wohnungsmarkt Wohnräume vermitteln. Bezüglich der Aufnahme von Asylbewerbern ist es für Schweden problematisch, dass reichere Gemeinden oft nicht gewillt sind Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
5. Aktuelle Entwicklungen
Der öffentliche Diskurs zur Migration zeichnet sich in Schweden durch eine hohe politische Korrektheit aus. Es besteht die Tendenz sich gegenüber den eher restriktiven Ansätzen angrenzender nordischer Staaten abzugrenzen und seine moralische Überlegenheit zu betonen.
Andererseits macht sich beispielsweise innerhalb der sozialen Medien Missgunst gegenüber schwedischen Politikern breit. Man kritisiert diese dafür, dass sie Probleme die mit einer zunehmenden Einwanderung entstehen ignorieren würden und Bedürfnisse schwedischer Arbeiter und Rentner vernachlässigten. Diese Unzufriedenheit kann als Auslöser dafür in Betracht gezogen werden, dass die rechtsradikalen „Schwedendemokraten“ immer mehr Wähler erhalten und ihnen eine immer größer werdende mediale Aufmerksamkeit und politische und gesellschaftliche Akzeptanz widerfährt, so dass man von einem zunehmenden Einfluss dieser Partei auf die zukünftige schwedische Politik ausgehen kann.
Im Herbst 2015 kam es in Schweden aufgrund stetig steigender Asylbewerber Zahlen und der zunehmenden Skepsis gegenüber Migration innerhalb der öffentlichen Meinung zu asylpolitischen Änderungen. Bestimmte Politiker verkünden, dass zukünftig ankommende Asylbewerber keine Garantie für eine Unterbringung in Schweden mehr erwarten könnten und diese rufen dazu auf die Weiterreise nach Schweden zu unterlassen. Weiterhin bittet die schwedische Regierung, aufgrund des großen Drucks, welches aktuell auf das schwedische Asylsystem einwirkt, die EU schutzbedürftige Personen in andere EU-Länder umzusiedeln. Die schwedische Minderheitsregierung sieht eine Verschärfung des Asylrechts vor bei der die bisherigen großzügigen schwedischen Standards schrittweise abgebaut werden sollen. Die Verschärfung beinhaltet ein strikteres Vorgehen gegen abgelehnte Asylbewerber und die Abkehr von dauerhaften Aufenthaltserlaubnissen hin zu temporären. Der Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik im Jahr 2015, welcher beispielsweise eine Zunahme der Grenzkontrollen und die Verpflichtung von Verkehrsunternehmen in Schweden und angrenzenden Ländern Identitätskontrollen ihrer Passagiere durchzuführen beinhaltet, nahm die Zahl an neu registrierten Asylbewerbern seither drastisch ab.
Literaturverzeichnis:
Hanewinkel, Vera / Oltmer, Jochen (2015): Länderprofil Schweden: Focus Migration, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMS) der Universität Bonn
Sund, Erik Magnus / Gärtner, Teresa (2013): Schweden (in: Handbuch europäischer Migrationspolitiken), Lit-Verlag, Berlin
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in den Texten "Länderprofil Schweden: Focus Migration" und "Schweden (in: Handbuch europäischer Migrationspolitiken)"?
Die Texte behandeln Schwedens Migrationsgeschichte, Migrationspolitik und Integrationspolitik, sowie aktuelle Problemlagen und Entwicklungen im Bereich der Migration.
Wie hat sich Schweden im Laufe der Zeit in Bezug auf Migration verändert?
Schweden hat sich in den letzten 150 Jahren von einem Auswanderungs- zu einem Einwanderungsland gewandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Land große Einwanderungsströme und gilt heute als eines der Hauptzielländer für Flüchtlinge und Asylbewerber in Europa.
Welche Faktoren haben die Migration nach Schweden beeinflusst?
Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsmarktanwerbung in den 1960er Jahren, Familiennachzug, EU-Erweiterungen und die Anziehungskraft des schwedischen Wohlfahrtsstaates haben die Migration nach Schweden beeinflusst.
Was kennzeichnet Schwedens Migrationspolitik?
Schwedens Migrationspolitik wird als "offene Migrationspolitik" bezeichnet, die den Schutz des Asylrechts, die Förderung von Arbeitsmigration, die Erleichterung grenzüberschreitender Migration und die internationale Kooperation umfasst. Gleichberechtigung und die Förderung zirkulärer Migration sind weitere Merkmale.
Wie ist das schwedische Ausländergesetz geregelt?
Das schwedische Ausländergesetz orientiert sich an dem Bedarf, Schutz und Sicherheit zu bieten. Die Abweisung von Personen, die von Verfolgung bedroht sind, ist streng verboten. Es wurde im Zuge der Umsetzung von EU-Richtlinien angepasst. Die Zuwanderung von Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten hängt hauptsächlich von der Nachfrage schwedischer Arbeitgeber ab.
Welche Kritik gibt es an der schwedischen Arbeitsmigrationspolitik?
Kritik wird am nachfrageorientierten Ansatz geübt, da unseriöse Arbeitgeber Schlupflöcher des Systems ausnutzen könnten, z. B. durch die Zahlung zu niedriger Löhne. Die schwedische Migrationsbehörde versucht, diesem Problem durch verstärkte Kontrollen entgegenzuwirken.
Was versteht man unter der "Ganz-Schweden Politik"?
Die "Ganz-Schweden Politik" war ein Versuch, Asylbewerber über das ganze Land zu verteilen, um Konzentrationen an bestimmten Orten zu vermeiden. Dieses Konzept erwies sich jedoch aufgrund der geringen Anzahl an Arbeitsplätzen in einigen Regionen als problematisch.
Wie ist das schwedische Staatsangehörigkeitsgesetz geregelt?
Das Staatsangehörigkeitsgesetz ist relativ liberal und beruht auf Elementen des Abstammungs- als auch des Territorialprinzips. Für die Einbürgerung sind eine bestimmte Anzahl an Aufenthaltsjahren und eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung notwendig. Kenntnisse über Sprache und landesspezifisches Wissen sind nicht entscheidend. Mehrstaatlichkeit wird akzeptiert.
Welche Problemlagen verursacht die Zuwanderung in Schweden?
Die Zuwanderung verursacht Probleme wie eine erhöhte Arbeitslosenquote unter Migranten, Wohnungsknappheit, Belastung der Aufnahme- und Unterbringungssysteme und Schwierigkeiten bei der Anerkennung ausländischer Ausbildungsleistungen.
Welche aktuellen Entwicklungen gibt es in der schwedischen Migrationspolitik?
Im Herbst 2015 kam es aufgrund steigender Asylbewerberzahlen und zunehmender Skepsis gegenüber Migration zu asylpolitischen Änderungen. Es gab eine Verschärfung des Asylrechts, die eine Abkehr von dauerhaften Aufenthaltserlaubnissen hin zu temporären beinhaltete. Die Zahl der neu registrierten Asylbewerber nahm seither drastisch ab.
- Quote paper
- Johanna Ernst (Author), 2018, Europäische Migrationspolitik. Beispiel Schweden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1105910