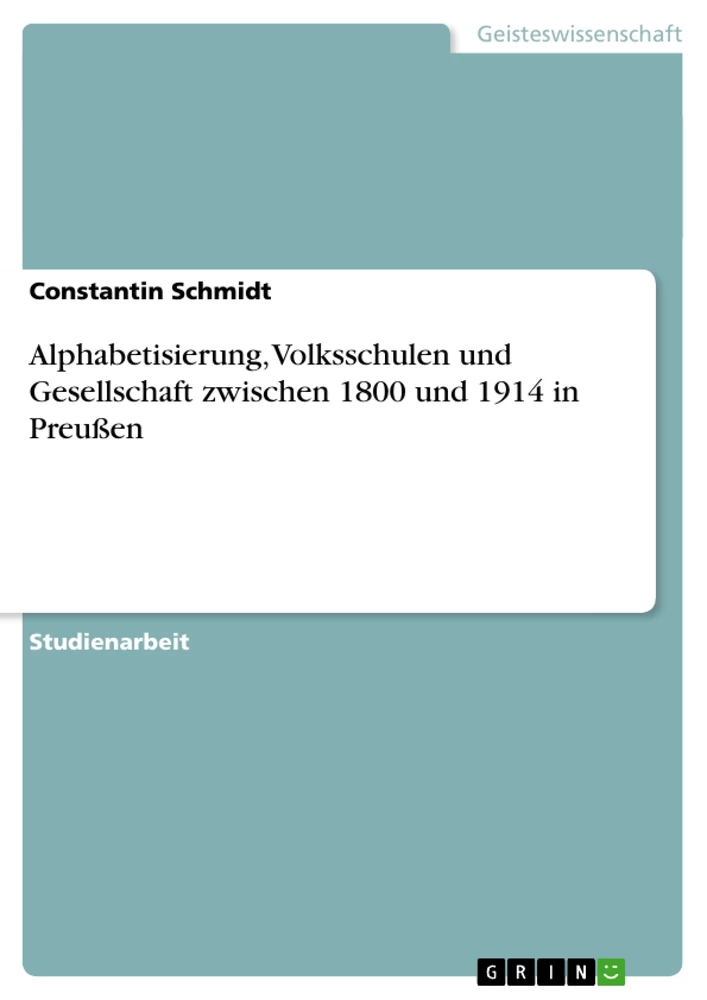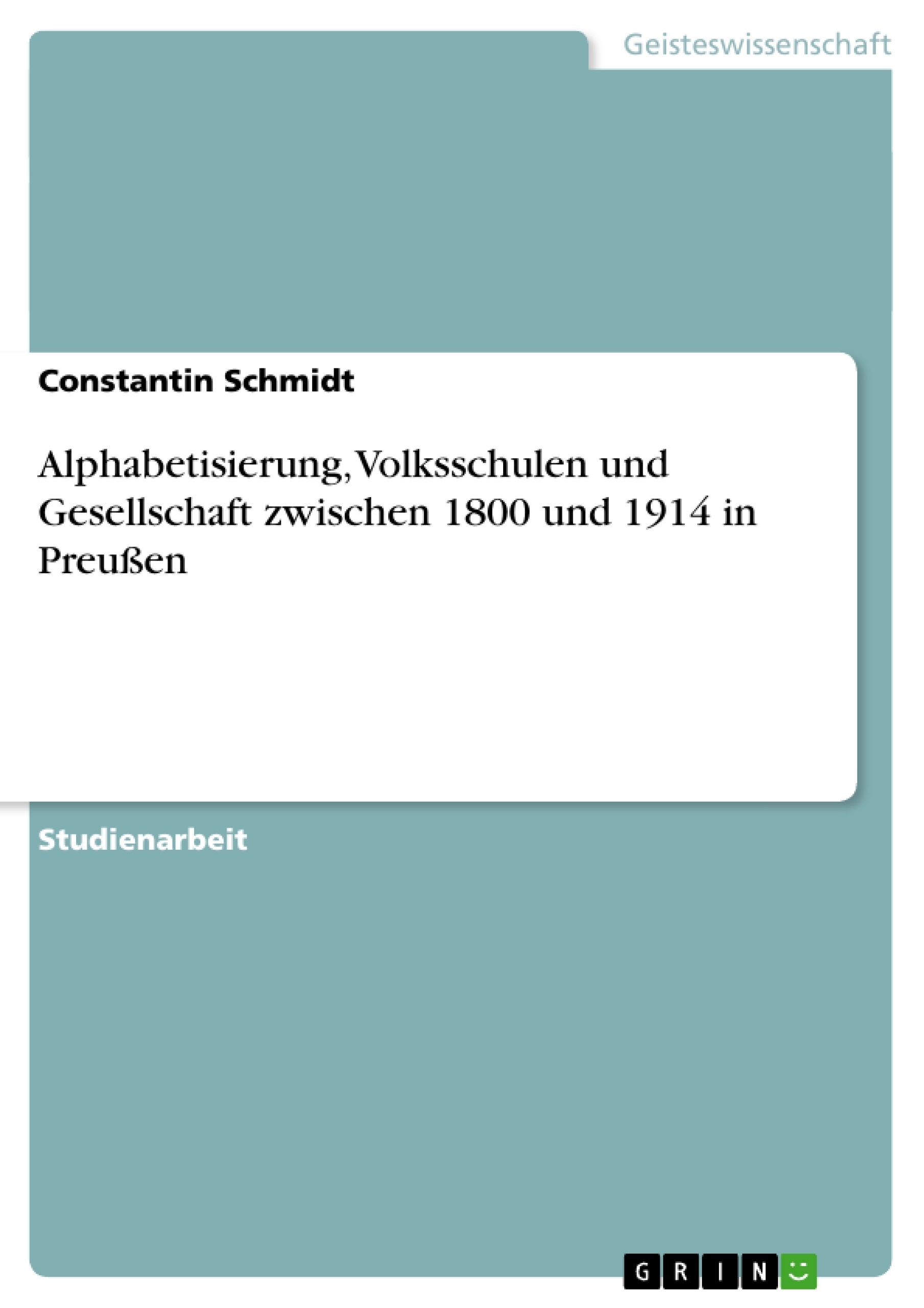Die Alphabetisierung hat zum Ziel, dass eine immer mehr Menschen in der Lage sind zu lesen und zu schreiben. Dies kann durch staatliche Interventionen wie zum Beispiel die Errichtung eines durchorganisierten Schulsystems erfolgen. Erst ab 1800 entstand ein Schulsystem, das jedem Menschen Zugang zu Bildung ermöglichte, auch wenn das System noch nach Ständen gegliedert war. Zuvor konnte nur eine kleine Elite in den Genuss von Bildung kommen. So gab es in der Antike in Griechenland erste Akademien für Kriegskunst, sowie Vorlesungen von Sophisten zu denen nur ein kleiner Kreis hauptsächlich die Söhne der Aristokraten - Zugang hatten. Durch städtische Latein-, Dom-und Klosterschulen im späten Mittelalter stieg die Alphabetisierungsrate auf 4 Prozent. Jedoch sind diese Schulsysteme nicht mit dem unsrigen Schulsystem, das seinen Ursprung in der Schulentwicklung des 19. Jahrhunderts hat, zu vergleichen.
Durch die stetige Verbesserungen des Schulsystems stieg die Alphabetisierungsrate von 15 Prozent um 1770 auf annähernd 100 Prozent um 1900. Der Anteil der Schrift- und Lesekundigen stieg während dieser 130 Jahre rasant an. Gründe für diese Literarisierung sind Aufklärung und die damit verbundenen Volksbildungsbewegungen, die zunehmende Durchsetzung einer ausnahmslosen Schulpflicht, sowie die vermehrte Verbreitung von Büchern und Schriften und die Verbesserung der Schulinfrastruktur.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2.1 Die Ausgangslage der Volksschule am Beginn des 19. Jahrhunderts
2.2 Pädagogische Ideen
2.3 Schulwirklichkeit
2.4 Die praktische Durchführung der Schulpflicht
2.5 Zwischenergebnis der Schulentwicklung und neue Bedingungen für die Volksschule um 1850
3.1 Einflussnahme des Staates auf die Schulen
3.2 Der rasante Aufbau und Ausbau der Schulinfrastruktur
4. Ergebnisse
5. Bibliographie
1. Einleitung
Die Alphabetisierung hat zum Ziel, dass eine immer mehr Menschen in der Lage sind zu lesen und zu schreiben. Dies kann durch staatliche Interventionen wie zum Beispiel die Errichtung eines durchorganisierten Schulsystems erfolgen. Erst ab 1800 entstand ein Schulsystem, das jedem Menschen Zugang zu Bildung ermöglichte, auch wenn das System noch nach Ständen gegliedert war. Zuvor konnte nur eine kleine Elite in den Genuss von Bildung kommen. So gab es in der Antike in Griechenland erste Akademien für Kriegskunst, sowie Vorlesungen von Sophisten zu denen nur ein kleiner Kreis - hauptsächlich die Söhne der Aristokraten - Zugang hatten. Durch städtische Latein-, Dom- und Klosterschulen im späten Mittelalter stieg die Alphabetisierungsrate auf 4 Prozent (vgl. Dülmen, 2003, S. 339ff). Jedoch sind diese Schulsysteme nicht mit dem unsrigen Schulsystem, das seinen Ursprung in der Schulentwicklung des 19. Jahrhunderts hat, zu vergleichen. Durch die stetige Verbesserungen des Schulsystems stieg die Alphabetisierungsrate von 15 Prozent um 1770 (vgl. Dülmen, 2003, S. 350) auf annähernd 100 Prozent um 1900. Der Anteil der Schrift- und Lesekundigen stieg während dieser 130 Jahre rasant an. Gründe für diese Literarisierung sind Aufklärung und die damit verbundenen Volksbildungsbewegungen, die zunehmende Durchsetzung einer ausnahmslosen Schulpflicht, sowie die vermehrte Verbreitung von Büchern und Schriften und die Verbesserung der Schulinfrastruktur.
Auch wenn dass Thema der Hausarbeit im 19. Jahrhundert zu verorten ist, ist es auch heute noch aktuell. So konnten 1990 ein Viertel der erwachsenen Menschen weder lesen noch schreiben (vgl. Block, 1995, S. 10). Hauptsächlich leben diese Menschen in Entwicklungsländern. Menschenrechtsorganisationen fordern daher effektivere Maßnahmen, um das vor 58 Jahren in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegte Recht auf Bildung einzulösen (vgl. Fritzsche, 2004, S. 211, Art 26 der Allgemeinen Menschenrechte). Ziel ist es eine hundertprozentige Alphabetisierung weltweit zu erreichen.
In der Geschichte anderer europäischer Staaten verlief die Alphabetisierung zum Teil anders, so war sie in Schweden außerinstitutionell organisiert und durch die Kirche initiiert. Die Familien mussten sich das Lesen und Schreiben selbst beibringen (vgl. Block, 1994, S. 41). Auch gab es Bemühungen innerhalb der Arbeiterbewegungen die
Alphabetisierungsrate zu erhöhen. In dieser Arbeit möchte ich mich aber hauptsächlich mit der institutionalisierten Alphabetisierung beschäftigen. Besonders möchte ich klären, welche Zusammenhänge zwischen der Alphabetisierung, dem Volksschulwesen und verschiedenen Bereichen der Gesellschaft bestehen. Dabei werde ich mich auf normative Quellen der Schulgesetzgebung beziehen. Die folgende Arbeit besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit den Vorrausetzungen für den rasanten Anstieg der Alphabetisierungsrate ab 1850, der Schulwirklichkeit und neuen pädagogischen Ideen am Anfang des 19. Jahrhunderts. Zusätzlich werde ich die Ambivalenz zwischen der humanistischen und utilitaristischen Bildung beschreiben. Der zweite Teil behandelt dann den Prozess des rasanten Ausbaus des Schulwesens und die Eingriffe des Staates in das Volkschulwesen durch Verwaltung und Standardisierung
2.1 Die Ausgangslage der Volksschule am Beginn des 19. Jahrhunderts
Im Jahre 1717 wurde in Preußen die Schulpflicht eingeführt. Unter Friedrich dem Großen (1712 - 1786) wurde 1763 die Schulpflicht im „General-Landschulreglement“ erneut festgeschrieben (vgl. Dülmen, 2003, S. 357). Er wollte als Förderer von Kunst und Wissenschaft das Schulwesen ausbauen, um dem Volk bessere Lese- und Schreibkenntnisse angedeihen zu lassen. Jedoch wurde auch eine direkte Einflussnahme auf breite Bevölkerungsschichten beabsichtigt, um so das Volk zu disziplinieren und brauchbare und treue Untertanen zu gewinnen (vgl. Raphael, 2000, S. 103). Dadurch konnte die allgemeine „Glückseligkeit“ durch den absolutistischen Wohlfahrtsstaat befördert werden. Während dieser Zeit war das Volksschulsystem noch nicht flächendeckend eingeführt worden, so dass es ein Gefälle zwischen Land- und Stadtschulen1 gab. Die städtischen Gymnasien wurden finanziell besser ausgestattet als die
Volksschulen, da besonders die höheren Schulen die Aufgabe hatten Nachwuchs für die
„geistige Elite“, wie Pfarrer, Juristen, Mediziner aus zubilden. Der preußische Haushalt sah kaum Investitionen in den Landschulneubau vor. Auch Schulgeld trug nicht zur Hebung der Qualität von Volkschulen bei. Zudem war es zu hoch, so dass man sich 1730 über die Höhe des Schulgeldes beschwerte (vgl. Schenda, 1988, S. 43) und deshalb seine Kinder nicht zur Schule schickte, sondern auf den Feldern oder im Handwerksbetrieben der Eltern arbeiten ließ. In den Paragraphen 29ff des Zwölften Teils des Preußischen Allgemeinen Landrechtes (ALR T12) von 1794 wird die Finanzierung der Volkschulen festgeschrieben (vgl. Giese, 1961, S. 61, §§29ff ALR T12). Danach seien „[. . .] sämtliche Hausväter jedes Ortes, ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, und ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses [. . .]“ (Giese, 1961, S. 62, §29 ALR T12) für die Bezahlung des Lehrers „[. . .] in Gelde oder in Naturalien [. . .]“ (Giese, 1961, S. 62, §31 ALR T12) und für den Unterhalt des Schulhauses zuständig. Dies bedeutet, dass die Gemeinde für die jeweilige Schule zahlt. Neben diesen „Rahmenbestimmungen“ gab es vermutlich noch detailliertere Bestimmungen, die sich von Region zu Region unterschieden, und dem Volk weitere Leistungen und Abgaben aufbürdeten, sodass es zu unterschiedlichen Schulgeldern
kam und dadurch regionale Qualitätsunterschiede existierten. Auf Grund der geringen Wirtschaftskraft der hauptsächlich landwirtschaftlich geprägten Gemeinden kann man davon ausgehen, dass die Qualität der Dorfschulen nicht gerade gut war. In den Städten konnten auf Grund von Handwerk und Handel von der Bevölkerung höhere Beiträge verlangt werden, sodass man sich dort auch „vornehme“ städtische Gymnasien leisten konnte. Manche Dorfschulen befanden sich wegen der mangelnden Schulfinanzierung in einem miserablen, wenn nicht gar baufälligem Zustand (vgl. Schiffler, 1991, S. 135). Oftmals mussten Scheunen, alte Dorfhäuser, Armenhäuser oder Gemeindeschmieden als Schulhaus herhalten (vgl. Kuhlemann, 1993, S. 55).
Und auch die Qualifikation der Lehrer war oft sehr zweifelhaft. Jedoch konnte man in Folge der niedrigen Finanzierungsdichte der Schulen keine professionellen Lehrer bezahlen oder einen Anreiz setzen, sich zum Lehrer ausbilden zu lassen. Die Lehrer hatten kaum eine geeignete Ausbildung erfahren, sie hätten sich nach der Aussage eines Zeitgenossen aus der Klasse der Invaliden, Flickschneider, Nachtwächter und Hirten rekrutiert (vgl. Schmitt, 1999, S. 43). Eine ausreichende Schulverwaltung, die kontrollierte, ob geeignete „Lehrer“ unterrichteten, gab es noch nicht.
Durch Umfragebögen, die Schulinspektoren und Superintendanten ausfüllen sollten, wollte sich das 1817 gegründete Kultusministerium (vgl. Schmitt, 1999, S. 41) über den Bestand und das Inventar der Schulen im Regierungsbezirk Potsdam (das ist der westlichste Teil der Provinz Brandenburg) unterrichten lassen. Die Ministerialbürokratie benötigte 3 Jahre, um alle Fragebögen zurück zu erhalten (vgl. Schmitt, 1999, S. 44). Daran wird ersichtlich, dass die Schulverwaltung bei so langen Rücklaufzeiten weder effektiv arbeitete, noch flächendeckend organisiert war. Bedingt wurde diese ineffektive Verwaltung aber auch dadurch, dass das ALR keine zentralisierte, hierarchisch gegliederte Schulverwaltung vorsah. So waren sowohl die Kirchen, als auch der Staat für die Schulverwaltung zuständig. Der Gerichtsobrigkeit und nicht irgendeiner Schulverwaltung kam in der Regel die Bestellung der Schullehrer zu (vgl. Giese, 1961, S. 62, §22 ALR T12). Der Kirche wurde dabei ein Prüfungsrecht eingeräumt (vgl. Giese, 1961, S. 62, §24 ALR T12), so dass nur Lehrer, die ein Zeugnis über ihre „Tüchtigkeit“ oder sich „zur Prüfung vorgestellt“ hatten (vgl. Giese, 1961, 62, § 25 ALR T12), eingestellt werden durften. Daneben wurden kaum Rahmenlehrpläne erlassen, so dass selbst Gymnasien keine allgemein verbindlichen Lehrpläne hatten. Es wurden höchstens Empfehlungen herausgegeben (vgl. Giese, 1961, S. 17). Inwieweit sich jedoch an die Gesetze und Verordnungen gehalten wurde, ist fraglich, da „Mündlichkeit und Herkommen den Stil des Verwaltens bestimmten“ (Raphael, 2000, S. 96). Außerdem gab es in unteren Verwaltungsschichten Beamte, die weder lesen noch schreiben konnten. Deshalb ist es schwierig Aussagen darüber zu treffen, ob sich überhaupt wortlautgemäß an die Gesetze gehalten wurde und somit eher nach „Herkommen“ - also so wie es schon immer gemacht wurde – „verwaltet“ wurde. Zusätzlich hatte die Kirche einen größeren Einfluss in der Schulverwaltung, als die Gesetze es der Kirche gestatteten. Der Zustand der Schulen und Lehrer war unvorteilhaft, die Verwaltung funktionierte eher schlecht als recht. Von der "verwalteten Schule" war man noch sehr weit entfernt (vgl. Giese, 1961, S. 17).
Die skizzierten Zustände führten dazu, dass die Schüler mit oder ohne Schule genauso dumm blieben ([Rochow] http://www.preussen- chronik.de), dennoch stieg die Alphabetisierungsrate nach buchwissenschaftlichen Befunden langsam an, sodass um 1800 bereits 25 Prozent der über Sechsjährigen lesen und schreiben konnten; bis 1830 waren es schon 40 Prozent (vgl. Block, 1995, S. 25). Dennoch waren Reformen nötig.
2.2 Pädagogische Ideen
Die pädagogischen Ideen der Neuzeit gaben der neuhumanistischen Bildungsreform Humboldts 1809 den theoretischen Unterbau, jedoch wurden nicht alle Ideen in dem Maße erfüllt, wie es sich die Theoretiker erhofften. Campe war einer der Ersten, der ein bedeutendes erziehungsphilosophisches Werk herausgab (vgl. Dülmen, 2003, 353). Diese„ Allgemeine Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesen “ bestand zu einen großen Teil aus Kommentaren zu den bedeutenden Werken Lockes und Rousseaus (vgl. Benner, 2003, S. 74). Nach Kemper sah Rousseau den Zweck der Erziehung darin, dass Kinder grundsätzlich für alles offen seien und nicht auf einen von Erwachsenen vorgegebenen Status hin finalisiert werden sollten. Heute meint man, Rousseau habe die Kindheit entdeckt, also, dass die Kindheit nicht mit Maßstäben von Erwachsenen betrachtet werden könne (vgl. Benner, 2003, S. 41). Locke vertrat andererseits die Meinung, dass lernende Kinder wie Wachs geformt werden müssten. Durch diese Art der Erziehung sah er die Möglichkeit die Wohlfahrt der Nation zu befördern (vgl. Benner, 2003, S. 32). Er legte damit die Grundlage eines standesspezifischen Schulwesens, das sich durch eine strikte
undurchlässige Dreiteilung in Bauern-, Bürger- und Gelehrtenschule auszeichnete. Es war nach Nützlichkeitskriterien hierarchisiert: Bauern sollten etwas über Lesen, Schreiben und Rechnen, sowie Religion erfahren, Bürger erhielten zusätzlich Wissen über Naturgeschichte und Mechanik. Ganz oben standen die Gelehrtenschulen, dort wurden auch Latein und Griechisch unterrichtet. Die gesamte Bildung wurde im Rahmen des aufklärerischen Nützlichkeitsprinzips beschränkt (vgl. Benner, 2003, S. 65). Wie Rousseau und Locke vertrat Pestalozzi sein eigenes Pädagogisches Programm, dass sich aber stark von Lockes Ideen unterschied. Er wollte den Menschen zur Selbsthilfe mit "Liebe, Herz, und Hand" erziehen. Er ging davon aus, dass die natürlichen Wachstumsgesetze des menschlichen Geistes denen der physischen Natur ähneln, in der Hinsicht, dass sich natürliche Prozesse ohne Einschränkung entfalten könnten (vgl. http://www.didaktik.uni- jena.de).
Doch leider konnten sich die Rousseauschen und die Pestalozzianischen Ideen nur langsam durchsetzen, jedoch gab es bereits Reformschulen. Basedow zum Beispiel gründete 1774 als einer der ersten Reformer sein Philantropin in Dessau (vgl. Benner, 2003, S. 109), das auf den Ideen Rousseaus fußte. Basedow sah einen Edukator für seine Schule vor. Er sollte sich um die sittliche Bildung der Schüler kümmern, und so die Schüler in klassenübergreifender Kommunikation und Interaktion schulen (vgl. Benner, 2003, S. 97). Als zweite Innovation kann man ihm anrechnen, dass er fröhliche Elemente mit in die Schule brachte, es gab Feste, sowie Spiele und Spaziergänge. Außerdem verwendete er in seiner Schule ein von ihm selbst erstelltes Lehrbuch, das Elementarwerk, welches das visuelle Lernen durch Bilder ermöglichte. Es beinhaltete Abbildungen aus den Bereichen der Tier- und Pflanzenwelt, dem Alltag, aber auch komplexe Themen wie Geselligkeit, Wohltätigkeit, Vernunft und Irrtümer (vgl. Benner, 2003, S. 102). Daneben legte seine Schule, anders als die Gymnasien, wert auf moderne Sprachen wie Französisch (vgl. Benner, 2003, S. 123ff). Dennoch waren diese Einrichtung, sowie Rousseaus und Pestalozzis Prinzipien noch nicht Schulwirklichkeit, sie lieferten jedoch einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Entwicklung im Schulwesen. Sie waren die „ideelle“ Reform vor der „materiellen“ Reform Humboldts.
Als Ursache für die Humboldtsche Reform gilt die Niederlage in Jena Auerstedt und der Tilsiter Frieden 1806/07. Der Staat sollte durch die Preußischen Reformen modernisiert werden. Die Preußischen Reformen waren eine Revolution von oben (vgl.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Der Text befasst sich mit der Alphabetisierung und der Entwicklung des Volksschulwesens in Deutschland im 19. Jahrhundert, insbesondere in Preußen. Er untersucht die Ausgangslage der Volksschule, pädagogische Ideen und die Schulwirklichkeit zu Beginn des Jahrhunderts, sowie die Rolle des Staates beim Ausbau der Schulinfrastruktur.
Was waren die Hauptprobleme der Volksschule am Anfang des 19. Jahrhunderts?
Die Volksschulen waren oft schlecht finanziert und ausgestattet, insbesondere im ländlichen Raum. Die Lehrer waren häufig unqualifiziert und schlecht bezahlt. Es gab keine effektive Schulverwaltung und die Schulpflicht wurde nicht konsequent durchgesetzt.
Welche pädagogischen Ideen beeinflussten die Schulreformen?
Pädagogische Ideen von Rousseau, Locke und Pestalozzi beeinflussten die Schulreformen. Rousseau betonte die natürliche Entwicklung des Kindes, Locke die Formbarkeit des Kindes durch Erziehung und Pestalozzi die Selbsthilfe durch "Liebe, Herz und Hand". Reformpädagogen wie Basedow versuchten diese Ideen in ihren Schulen umzusetzen.
Welche Rolle spielte der Staat bei der Entwicklung des Schulwesens?
Der Staat, insbesondere Preußen, spielte eine zunehmend wichtige Rolle bei der Entwicklung des Schulwesens. Durch Gesetze und Verordnungen versuchte der Staat das Schulwesen zu standardisieren und zu verbessern. Die Preußischen Reformen nach der Niederlage in Jena Auerstedt sollten den Staat modernisieren, was auch das Schulwesen betraf.
Wie war die Alphabetisierungsrate zu Beginn des 19. Jahrhunderts und wie hat sie sich entwickelt?
Um 1800 konnten etwa 25% der über Sechsjährigen lesen und schreiben. Bis 1830 stieg diese Rate auf etwa 40%. Die Alphabetisierungsrate stieg im Laufe des 19. Jahrhunderts deutlich an, unter anderem aufgrund der Schulpflicht, der Volksbildungsbewegungen und der verbesserten Schulinfrastruktur.
Welche Gesetze und Verordnungen waren für die Finanzierung der Volksschulen relevant?
Das Preußische Allgemeine Landrecht (ALR) von 1794 regelte die Finanzierung der Volksschulen. Demnach waren alle Hausväter eines Ortes, unabhängig von Konfession und Kinderzahl, für die Bezahlung des Lehrers und den Unterhalt des Schulhauses zuständig.
Wer war für die Schulverwaltung zuständig?
Sowohl die Kirche als auch der Staat waren für die Schulverwaltung zuständig. Die Gerichtsobrigkeit bestellte in der Regel die Schullehrer, während die Kirche ein Prüfungsrecht hatte.
Welche Bedeutung hatte die Humboldtsche Bildungsreform?
Die Humboldtsche Bildungsreform von 1809 war ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des preußischen Schulwesens. Sie basierte auf neuhumanistischen Ideen und sollte den Staat durch Bildung stärken.
Welche Kritikpunkte gab es am Schulsystem des 19. Jahrhunderts?
Trotz der Fortschritte gab es Kritik am Schulsystem, insbesondere an der mangelnden Qualität der Ausbildung in ländlichen Regionen und an der unzureichenden Finanzierung der Schulen. Auch die Qualifikation der Lehrer wurde kritisiert.
- Quote paper
- Constantin Schmidt (Author), 2006, Alphabetisierung, Volksschulen und Gesellschaft zwischen 1800 und 1914 in Preußen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110569