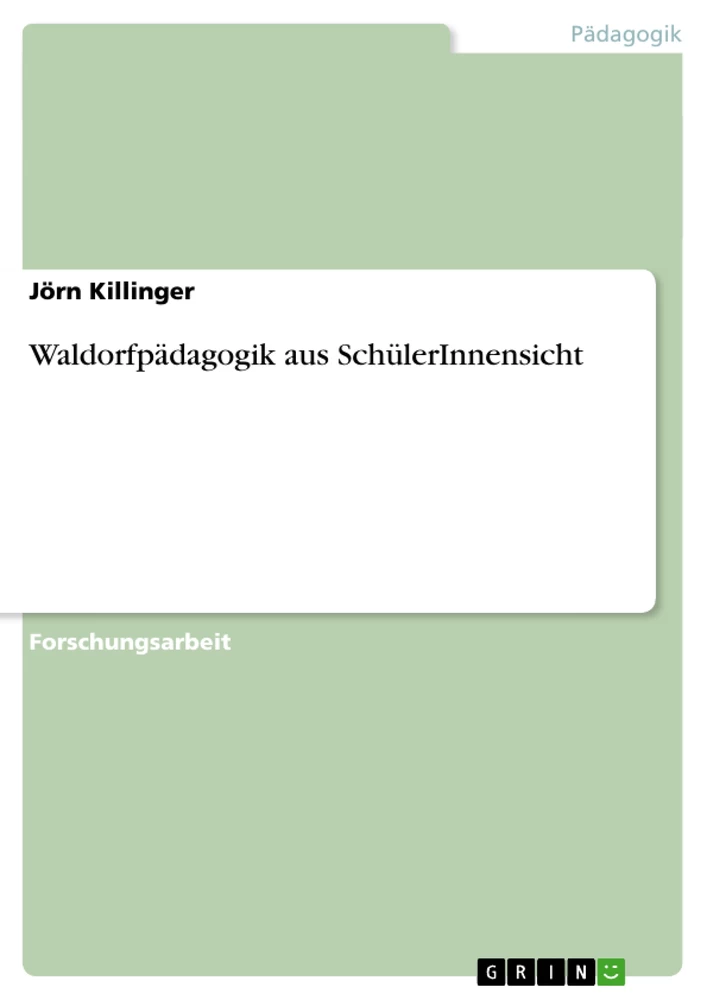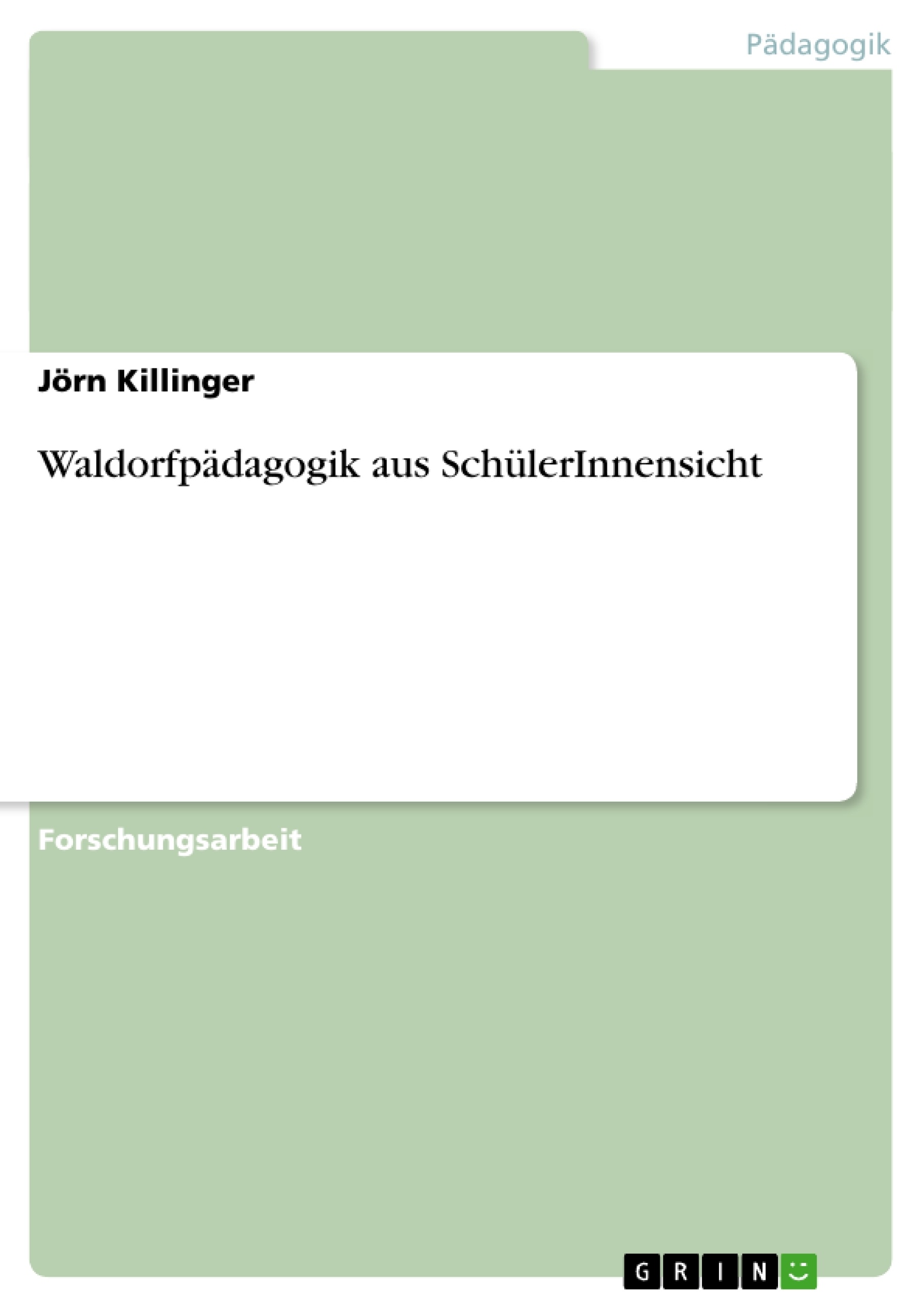„Judenfeindlich, dogmatisch, altmodisch: Die Waldorfschulen geraten unter Beschuss. Was ist dran an den Vorwürfen, und wie gut sind Rudolf Steiners Schulen heute?“
Unter diesem Titel war am 17. August 2000 in der „Zeit“ ein Streitgespräch zwischen dem Anthroposophen Walter Hiller und dem Pädagogen Klaus Prange (Universität Tübingen) zu lesen.
Waldorfpädagogik ist ein Thema, dass sowohl in den Medien als auch in der akademischen Diskussion seit Jahren aktuell ist und nichts an Brisanz verloren hat. Diese Auseinandersetzung wird hauptsächlich unter pädagogisch-theoretischer Perspektive geführt. Seltener zu finden sind Arbeiten, die sich auf die Praxis beziehen; diese beschäftigen sich mit der Sichtweise der Lehrenden. Diejenige der „Betroffenen“ – der SchülerInnen selbst - scheint kaum Aufmerksamkeit zu finden.
Die Perspektive derer, die die Waldorfschule fast fertig durchlaufen und seit der ersten Klasse von innen her erlebt haben, was Waldorfpädagogik ist, weckt unser besonderes Interesse und ist deswegen Thema dieser Arbeit.
Wir arbeiten mit der Methode des qualitativen Interviews und stellen die zunächst vor. Im folgenden gehen wir kurz allgemein auf Rudolf Steiner und die Waldorfschulen ein und fassen anschließend einige der Aspekte zusammen, die immer wieder Anlass für Kritik geben. Der Leitfaden, der unsere Interviews strukturiert, lehnt sich an diese Punkte an. Tabellen, die den Verlauf der einzelnen Interviews darstellen, sowie die Interpretation schließen die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Das Qualitative Interview
2.1 Allgemeine Charakterisierung
2.1.1 Methodologische Aspekte
2.1.2 Methodisch-technische Aspekte
2.2 Formen des Qualitativen Interviews
2.2.1 Das Narrative Interview
2.2.2 Das Problemzentrierte Interview
2.2.3 Weitere Interviewformen
2.3 Die Auswahl der zu Befragenden
2.4 Die Datenerhebung und Datenaufzeichnung
2.5 Der Leitfaden
2.6 Die Interviewsituation
2.7 Die Auswertung und Analyse
3 Steiner und die Waldorfschulen
3.1 Historischer Kontext
3.2 Die Anthroposophie
3.2.1 Religiöse Elemente
3.2.2 Menschliche Entwicklung
3.2.3 Die Temperamentenlehre
3.3 Die Waldorfpädagogik
3.3.1 Kunst als Prinzip
3.3.2 Der Aufbau des Unterrichts
3.3.3 Der Klassenlehrer
4 Kritische Aspekte der Waldorfpädagogik
4.1 Anthroposophische Medienkritik
4.2 Der Umgang mit Religion
4.3 Traditionelle Rollenklischees
4.4 Leistungsaspekt und Qualität der Berufs- bzw. Studiumsvorbereitung
5 Vorüberlegungen zur Auswahl der InterviewpartnerInnen und Durchführung der Interviews
6 Leitfaden
7 Einzelverlaufstabellen
7.1 Einzelverlaufstabelle - Transkription
7.2 Einzelverlaufstabelle - Transkription
8 Interpretation
9 Resumée
10 Literaturverzeichnis
11 Anhang
1 Einleitung
„Judenfeindlich, dogmatisch, altmodisch: Die Waldorfschulen geraten unter Beschuss. Was ist dran an den Vorwürfen, und wie gut sind Rudolf Steiners Schulen heute?“
Unter diesem Titel war am 17. August 2000 in der „Zeit“ (S. 29) ein Streitgespräch zwischen dem Anthroposophen Walter Hiller und dem Pädagogen Klaus Prange (Universität Tübingen) zu lesen.
Waldorfpädagogik ist ein Thema, dass sowohl in den Medien als auch in der akademischen Diskussion seit Jahren aktuell ist und nichts an Brisanz verloren hat. Diese Auseinandersetzung wird hauptsächlich unter pädagogisch-theoretischer Perspektive geführt. Seltener zu finden sind Arbeiten, die sich auf die Praxis beziehen; diese beschäftigen sich mit der Sichtweise der Lehrenden. Diejenige der „Betroffenen“ – der SchülerInnen selbst - scheint kaum Aufmerksamkeit zu finden.
Die Perspektive derer, die die Waldorfschule fast fertig durchlaufen und seit der ersten Klasse von innen her erlebt haben, was Waldorfpädagogik ist, weckt unser besonderes Interesse und ist deswegen Thema dieser Arbeit.
Wir arbeiten mit der Methode des qualitativen Interviews und stellen die zunächst vor. Im folgenden gehen wir kurz allgemein auf Rudolf Steiner und die Waldorfschulen ein und fassen anschließend einige der Aspekte zusammen, die immer wieder Anlass für Kritik geben. Der Leitfaden, der unsere Interviews strukturiert, lehnt sich an diese Punkte an. Tabellen, die den Verlauf der einzelnen Interviews darstellen, sowie die Interpretation schließen die Arbeit ab.
2 Das Qualitative Interview
Die qualitative Sozialforschung ist eine komplexe Art der Forschung bei der das Verständnis im Vordergrund steht. Um Situationen und Ereignisse besser zu verstehen, bedient sich die qualitative Sozialforschung verschiedener Methoden. Hierzu gehören unter anderen die Gruppendiskussion, die Inhaltsanalyse, die teilnehmende Beobachtung, die Biografieforschung und das qualitative Interview. In der Praxis werden meist mehrere Methoden kombiniert um eine Forschungsfrage umfassend zu bearbeiten. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit ist dies jedoch aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Deshalb werden wir uns im Folgenden auf das qualitative Interview beschränken.
In diesem ersten Teil der Forschungsarbeit soll das qualitative Interview als Methode qualitativer Sozialforschung beschrieben werden. Zunächst wird eine allgemeine Charakterisierung dieser Art des Interviews vorgenommen, wofür methodologische und methodisch-technische Aspekte aufgeführt und erklärt werden. Danach werden die verschiedenen Formen des qualitativen Interviews behandelt. Anschließend wird die Auswahl der zu Befragenden und die Datenerhebung und –aufzeichnung erläutert. Der nächste Punkt wird dann die sinnvolle Erstellung eines Leitfadens bilden, wonach die Interviewsituation thematisiert wird. Abschließend wird die Auswertung und Analyse der gewonnenen Informationen behandelt.
2.1 Allgemeine Charakterisierung
Im Lexikon wird ein Interview mit einer „Befragung“ verglichen und bedeutet soviel wie eine „Unterredung (von Reportern) mit (führenden) Persönlichkeiten über Tagesfragen usw.“. (Duden, 1991, S.363) Diese Alltagsdefinition trifft für unseren Gebrauch des Interviews zwar nicht ganz zu, aber sie kann als Basis für eine erste Charakterisierung des qualitativen Interviews dienen. Das Wort „Befragung“ verweist auf den mündlich-persönlichen Charakter eines Interviews und deutet auf eine gewisse Asymmetrie hin: Eine Person stellt Fragen, die von einer anderen Person beantwortet werden. Nach Lamnek (1989) werden zusätzlich folgende Punkte als kennzeichnend für ein qualitatives Interview herausgestellt: die Nicht-Standardisierung des Interviews, die Offenheit der Fragen, der neutral bis weiche Interviewstil, die vermittelnde sowie ermittelnde Intention und die Beschränkung auf eine Einzelbefragung.
Aus dieser ersten Charakterisierung ergeben sich mehrere Aspekte methodologischer, als auch methodisch-technischer Art, die allen Formen qualitativer Interviews gemeinsam sind. Diese werden im Folgenden näher erläutert.
2.1.1 Methodologische Aspekte
Unter methodologischen Aspekten versteht man die Grundprinzipien einer Methode. Beim qualitativen Interview stellen sich sieben Grundprinzipien als wichtig heraus.
Das qualitative Interview unterscheidet sich vom quantitativen Interview hauptsächlich im Grad der Standardisierung. Die quantitative Befragung könnte auch als mündlicher Fragebogen beschrieben werden für den es detaillierte Anweisungen jeglicher Art gibt, z. B. wird dem Befragten ein vorgefertigtes Antwortschema bereitgestellt um unerwartete Antworten auszuschließen. Das qualitative Interview hingegen wird nicht durch solche Vorgaben eingeschränkt, sondern beruht auf dem (1) Prinzip der Offenheit. Das heißt, dass der Forscher sich zurückhalten sollte, sich dem Befragten anpassen muss und die Strukturierung des Interviews dem Befragten überlassen. Direkt mit der Offenheit verknüpft, ist das (2) Prinzip der Flexibilität, welches besagt, dass der Forscher auf die individuellen Bedürfnisse des Befragten und die unterschiedlichen Situationen variabel eingehen muss. Damit eng verbunden ist das (3) Prinzip der Prozesshaftigkeit. Nur durch den Prozess werden Deutungs- und Handlungsmuster des Befragten ans Licht gebracht, mit denen weitergearbeitet werden kann.
Ein zweiter Unterschied zum quantitativen Interview ist die Situation in der geforscht wird. In der empirischen Forschung wird die Situation weitgehend kontrolliert um Störfaktoren auszuschalten. Im Gegensatz dazu wird beim qualitativen Interview so weit wie möglich versucht die Natürlichkeit der Situation nicht zu stören. Dieses (4) Prinzip der alltäglichen Situation wird durch das (5) Prinzip der Kommunikativität erreicht. Der Forscher kommt nur durch den persönlichen Dialog zu Ergebnissen. Dieser Dialog wird der Ebene (Sprachniveau, soziale Schicht) des Befragten angepasst.
Ein weiterer Unterschied zur quantitativen Befragung liegt in der Wirklichkeitsdefinition des Befragten. Beim quantitativen Interview wird die Wirklichkeitsdefinition, oder die Weltauffassungen, dem Befragten vom Forscher indirekt vorgegeben. Der Befragte muss sich den Annahmen des Forschers irgendwie anpassen, auch wenn diese Annahmen nicht geteilt werden. Beim qualitativen Interview hat der Befragte die Gelegenheit seine eigenen Auffassungen und „Wirklichkeiten“ mit einzubringen. Der Begriff (6) Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen beschreibt diesen wichtigen Unterschied. Da diese Wirklichkeitsdefinitionen aber nicht automatisch erkennbar sind, müssen sie vom Befragten auch erklärt werden. Der Interviewer muss also Aussagen hinterfragen können, was in der Empirie nicht möglich ist. Dieses sogenannte (7) Prinzip der Explikation bedeutet, dass die Aufforderung zum Nachfragen gegeben ist und Aussagen näher erläutert werden können. (Lamnek, 1989)
2.1.2 Methodisch-technische Aspekte
Unter den methodisch-technischen Aspekten werden die Bedingungen zusammengefasst, welche für den erfolgreichen Ablauf eines qualitativen Interviews von Bedeutung sind. Diese Bedingungen ergeben sich aus den eben erwähnten methodologischen Aspekten.
Da das qualitative Interview auf Offenheit und Flexibilität beruht, müssen die Fragen diese Prinzipien wiederspiegeln. Die Fragen dürfen also nicht geschlossen sein, d.h. die Antworten dürfen kein vorgefertigtes Schema besitzen. Der Interviewer kann sich zwar an einem Leitfaden orientieren, muss diesen aber flexibel handhaben. Er darf nicht auf bestimmte Fragen oder eine bestimmte Reihenfolge von Fragen beharren. Er muss Ausschweifungen und auch Ausweichungen des Befragten akzeptieren und diese auch positiv werten. Eine solche Offenheit erfordert eine hohe Kompetenz des Interviewers.
Eine weitere Bedingung für einen ungestörten Ablauf ist eine natürliche, alltägliche Umgebung, die Vertrauen und ein Gefühl des Alltäglichen erweckt. Nur so können Informationen erhalten werden, die zum wirklichen Verständnis eines Problems führen. Der Forscher muss also eine Atmosphäre schaffen, welche entspannt und freundschaftlich ist. Eine solche Atmosphäre lässt sich am einfachsten im Alltagsmilieu des Befragten herstellen.
Da ein qualitatives Interview zeitlich nicht begrenzt ist und in dieser Zeit viele Informationen auf den Forscher zukommen, sollte das gesamte Interview auf Tonband oder Video aufgezeichnet werden. Diese Informationen können dann nach dem Interview in Ruhe analysiert und ausgewertet werden. (Lamnek, 1989)
2.2 Formen des Qualitativen Interviews
Das qualitative Interview wird von verschiedensten Forschern für verschiedenste Arten der Forschung verwendet. Das hat zur Folge, dass sich im Laufe der Zeit mehrere Formen des qualitativen Interviews entwickelt haben. Diese Formen besitzen Gemeinsamkeiten, welche im voranstehenden Kapital behandelt wurden, aber auch deutliche Unterschiede. In diesem Teil der Arbeit wird eine dieser Formen, das problemzentrierte Interview, herausgegriffen und erklärt. Um die Eigenschaften des problemzentrierten Interviews darzustellen, werden auch andere Formen des qualitativen Interviews zum Vergleich herangezogen.
2.2.1 Das Narrative Interview
Eine wichtige Form des qualitativen Interviews ist das narrative Interview. Es wurde vom Soziologen Fritz Schütze in den 70er Jahren entwickelt. Bei einem solchen Interview wird den Erzählungen des Befragten einen hohen Stellenwert beigemessen. Die „eigenerlebten Erfahrungen“ sollen, so Schütze, das Material für diese Erzählungen bilden. Diese Erzählungen besitzen zwei Vorteile gegenüber anderen Interviewformen:
(1) Durch die Erzählung wird die Handlungsstruktur des Befragten einfacher dargestellt. Bei einer solchen Art der Befragung kommt der Befragte in einen sogenannten Zugzwang der Detaillierung. Der Erzähler muss seine Geschichte logisch aufbauen und mit genügend Details ausstatten damit sie für den Zuhörer verständlich wird.
(2) Zusätzlich wird bei einer Erzählung rückblickend analysiert und interpretiert, was sie für die Lebenslauf- und Biografieforschung besonders eignet. Handlungen und Teilerzählungen müssen in die Erzählung als ganzes eingebettet werden und subjektive Ansichten erklärt werden.
Durch diese Eigenschaften ermöglicht das narrative Interview eine realistische, logische Erklärung von Handlungen. (Lamnek, 1989)
Die Orientierung an Erzählungen bringt eine sehr offene Gesprächsführung mit sich, wobei die Fragen des Interviewers im Hintergrund stehen und der Erzählfluss das Interview leitet. Für ein solches Interview werden keine theoretischen Konzepte im Voraus erarbeitet. Diese werden im nachhinein auf den Ergebnissen des Interviews aufgebaut. (Lamnek, 1989)
2.2.2 Das Problemzentrierte Interview
1985 entwickelte Witzel das problemzentrierte Interview als Teil einer problemzentrierten Forschungstechnik, bei der das qualitative Interview mit einer Fallanalyse, einer biografischen Methode und einer Gruppendiskussion kombiniert wird. Für die Durchführung dieser Interviewart wird auf die Orientierung an einem bestimmten gesellschaftlichen Problem geachtet. Anzumerken ist auch, dass die Methode sehr flexibel ist, um sich dem Befragten anzupassen, d.h. dass für das problemzentrierte Interview der Prozess unentbehrlich ist. (Flick, 1995)
Diese Methode lebt im Gegensatz zum narrativen Interview von der Frage-Antwort-Asymmetrie. Diese Fragen werden, anders als beim narrativen Interview, im Voraus in einem Leitfaden zusammengestellt, welcher dann die Struktur des Interviews bis zum bestimmten Grad vorgibt. Er darf und soll jedoch flexibel sein. Ein problemzentriertes Interview ist also ein halb-standardisiertes Interview.
Witzels Methode unterscheidet sich von anderen Interviewformen auch darin, dass dem eigentlichen Interview Vor- und Nacharbeiten angehängt werden. Die Verwendung eines Kurzfragebogens zur Erfassung von demografischen Daten kann die eigentliche Interviewphase entlasten. Die Entwicklung eines Leitfadens ist als Gedächtnisstütze gedacht, was gerade einem unerfahrenen Interviewer die Arbeit erleichtert. Die Aufzeichnung des Interviews auf Tonband oder Video stammt auch von Witzel. Zusätzlich wird vom Interviewer ein Postskript erstellt, um wichtige (nonverbale) Informationen, die nicht im Tonband erscheinen, festzuhalten. (Flick, 1995)
Insgesamt ist zu erkennen, dass sich das problemzentrierte Interview in der Vorarbeit vom narrativen Interview abhebt. Beim problemzentrierten Interview beschäftigt sich der Forscher schon vor dem Interview mit der Problematik und entwickelt daraus seinen Leitfaden. Diese Vorbereitung ist der Vorbereitung auf ein quantitatives Interview sehr ähnlich, da hierfür z. B. Literaturrecherchen durchgenommen werden. (Lamnek, 1989, 74)
Das problemzentrierte Interview wird in vier Phasen aufgeteilt:
1. Gesprächseinstieg: Hierfür eignet sich eine allgemeine Frage, die das Thema einleitet und den Befragten zum Erzählen auffordert. (Lamnek, 1989)
2. Allgemeine Sondierung: Durch Nachfragen werden zusätzliche Informationen ermittelt. (Flick, 1995)
3. Spezifische Sondierung: Durch Zusammenfassungen und Interpretationen des Interviewers wird das Verständnis erhöht und Widersprüche beseitigt. (Flick, 1995)
4. Ad-hoc-Fragen: Abschließend können direkte Fragen gestellt werden um nicht bearbeitete Themenbereiche anzusprechen. (Lamnek, 1989)
Diese Aufteilung stört die Offenheit des Interviews nicht, führt aber zu einer Situation in der bereits angesprochene Themen vom Forscher erneut aufgegriffen werden können. Es besteht auch die Möglichkeit Widersprüchlichkeiten oder Unklarheiten zu beseitigen.
2.2.3 Weitere Interviewformen
2.2.3.1 Das fokussierte Interview
Eine weitere Form des qualitativen Interviews, welche wie das problemzentrierte Interview auch halb-standardisiert ist, ist das fokussierte Interview. Merton und Kendall haben diese Form in den 40er Jahren entwickelt um die Wirkung von Medien zu erforschen. Wie beim problemzentrierten Interview wird auch hier ein Leitfaden zur Orientierung verwendet, jedoch ist die zu analysierende Situation eine andere. Die zu Befragenden werden alle einem Reiz (bei Merton und Kendall z. B. ein Film oder eine Radiosendung) ausgesetzt und anschließend zu diesem Reiz befragt. (Flick, 1995)
2.2.3.2 Das Tiefen- oder Intensivinterview
Das Tiefen- oder Intensivinterview wird hauptsächlich in der Psychoanalyse verwendet. Es unterscheidet sich von den bisher behandelten Interviewformen in dem die Deutung von Handlungen nicht allein beim Befragten liegt, sondern zum grossteil vom Interviewer übernommen wird. Das führt dazu, dass Motive und Einstellungen erklärt werden können, welche dem Befragten gar nicht bewusst sind. Diese Deutung wird aber auch in einer Art Alltagsgespräch vorgenommen. (Lamnek, 1989)
2.2.3.3 Das rezeptive Interview
Das von Kleining (1988) vorgestellte rezeptive Interview ist von allen Formen das offenste und zugleich asymmetrischste. Bei dieser Interviewform wird, wie beim narrativen Interview, keine vorzeitige Beschäftigung mit einem Problem geleistet. Der Interviewer soll sich so weit wie möglich auf das Zuhören beschränken und den Befragten durch „nonverbale, zustimmende und ermunternde Reaktion“ (Lamnek, 1989) zum weitererzählen anregen. Durch die Einhaltung dieser Kriterien eignet sich das rezeptive Interview besonders für die Entdeckung neuer Gebiete. (Lamnek, 1989)
2.3 Die Auswahl der zu Befragenden
Nachdem die Form des Interviews feststeht, werden die zu Befragenden ausgewählt. Dieser Schritt ist für das Ausmaß an Ergebnissen entscheidend. Bei einem qualitativen Interview ist das Ziel, im Gegensatz zum quantitativen Interview, nicht die Verallgemeinerung der Ergebnisse. Also besitzt die Repräsentativität auch keinen sehr hohen Stellenwert. Hier geht es eher darum „typische Fälle“ zu untersuchen. Man versucht also nach den eigenen Fragen und Theorien einige „Typologien“ auszuwählen. Diese Art des „theoretical sampling“ stellt den Forscher aber vor die Fragen: Was ist denn ein typischer Fall? Ist meine Idee eines typischen Falls auch realistisch?
Erst nachdem diese Fragen geklärt wurden, kann der Forscher mit der eigentlichen Wahl beginnen. Am einfachsten ist es natürlich immer Personen auszuwählen, welche zum Bekanntenkreis des Forschers gehören. Hier ergibt sich jedoch das Problem, dass gerade diese Personen für ein qualitatives Interview ungeeignet sind. Da oft persönliche Meinungen und intimer Gesprächsstoff das Interview prägen, ist es schwierig diese von einer Person zu erwarten, dessen Bekanntenkreis der Forscher kennt. Andererseits ist es nicht leicht fremde Menschen zu einem Interview zu bewegen. Um dieses Problem zu umgehen, kann der Mittelweg des Vermittlers hilfreich sein. Dabei vermittelt eine bekannte Person eine unbekannte an den Forscher. Dadurch wird Vertrauen erweckt, jedoch gleichzeitig eine gewisse Distanz eingehalten. (Lamnek, 1989)
2.4 Die Datenerhebung und Datenaufzeichnung
Die Datenerhebung bei einem qualitativen Interview erfolgt in einer vom Befragten ausgewählten Umgebung. D.h. also, dass die Umgebung eine vertraute ist in der er sich wohl fühlt und möglichst viele verwertbare Informationen liefert. Um den Informationsfluss zusätzlich anzuregen, sollte der Befragte vom Interviewer wie ein Experte behandelt werden, dessen Interview sehr wichtig und interessant für die Forschung ist. Der Forscher muss also flexibel sein, besonders was die Sprache betrifft. In einem qualitativen Interview wird das Sprachniveau des Befragten zur Verständigung benutzt.
Die gewonnenen Daten müssen aber auch aufgezeichnet werden um eine spätere Interpretation und Kontrolle zu ermöglichen. Häufig wird ein qualitatives Interview auf Tonband aufgezeichnet, wobei eine Videoaufzeichnung weitere nicht-verbale Informationen liefern kann. Bei dem Einsatz von Tonband kann ein sogenanntes Postskriptum erstellt werden um diese nonverbalen Informationen festzuhalten. Die Verwendung solcher Aufzeichnungsgeräte ist für den Befragten sehr oft ungewohnt, weshalb sie nur mit dessen Einverständnis benutzt werden dürfen. Der Interviewer sollte auch versuchen das Aufzeichnungsgerät möglichst unauffällig im Hintergrund zu behalten, damit es im Laufe des Interviews in Vergessenheit gerät. (Lamnek, 1989)
2.5 Der Leitfaden
Für die Durchführung eines qualitativen Interviews kann sich ein Leitfaden als nützliche Orientierungshilfe erweisen. Ein Leitfaden besteht aus vorab formulierten Fragen, die dem Interviewer als Gedächtnisstütze dienen. Anhand eines Leitfadens kann der Interviewer kontrollieren ob er die wichtigsten Bereiche im Interview abgedeckt hat und kann sich, wenn nötig, an der Gliederung des Leitfadens festhalten. Der Leitfaden soll jedoch nur als Hilfestellung dienen und nicht endgültig oder unveränderlich sein. Er muss also flexibel gehandhabt werden und im Idealfall wird er auch vergessen. Gerade bei einem problemzentrierten Interview sollte ein Leitfaden entwickelt werden um sich an die Problembereiche und dazugehörigen Fragen zu gewöhnen. (Kaufmann, 1999)
Bei der Erstellung eines Leitfadens sollten möglichst präzise Fragen formuliert werden und in eine logische Reihenfolge gebracht werden. Gedankensprünge sollten vermieden werden, da diese den zu Befragenden verunsichern können. Die ersten Fragen können für den Erfolg des Interviews maßgebend sein. Diese sollten kurz gehalten werden um „das Eis zu brechen“ und Vertrauen zu schaffen. Darauf folgen offenere Fragen, die tiefer liegende Einstellungen erforschen. Um einen solchen Leitfaden zu erstellen, sollten zunächst alle möglichen Fragen notiert werden. Anschließend werden sie dann sortiert. Zentrale Fragen werden herausgestellt und nebensächliche entfernt. Durch diese intensive Beschäftigung mit den Fragen kommt der Interviewer zu einer Präzision seiner Befragung. (Kaufmann, 1999)
2.6 Die Interviewsituation
Nachdem die zu Befragenden ausgewählt wurden, die Datenerhebung und -aufzeichnung geklärt wurde und ein Leitfaden entwickelt wurde, kann mit der eigentlichen Arbeit des Interviewing begonnen werden. Ein qualitatives Interview zu führen ist nicht einfach und kann für den Interviewer sehr anstrengend sein. Deshalb gibt es einige Überlegungen, die versuchen diesen Prozess zu erleichtern und möglichst produktiv zu gestalten.
Zunächst sollte dem Interviewer bewusst werden, dass das Ziel eines qualitativen Interviews, nämlich möglichst authentische Informationen zu sammeln, nur durch eine Art Alltagsgespräch erreicht werden kann. Die beiden Gesprächspartner sollen also weitgehend gleichberechtigt sein. Eine hierarchische Gesprächsführung ruft keine tiefergehenden Antworten hervor. Um diese „Hierarchie zu durchbrechen“ (Kaufmann, 1999) sollte durch den Interviewstil klar werden, dass der Befragte ein geschätzter Experte ist und wichtige Informationen liefern kann. Der Interviewer sollte sich also schon im Voraus klar machen wie er seinem Gesprächspartner dieses Gefühl vermittelt. (Kaufmann, 1999)
Eine zweite Überlegung betrifft die Fragen des Interviewers. Nur durch die richtige Frage im richtigen Moment kann das gewünschte Ergebnis erreicht werden. Natürlich ist es bei einem längeren qualitativen Interview aber nicht immer möglich dies zu tun. Um die richtige Frage stellen zu können muss der Interviewer genau wissen was bereits schon gesagt wurden, ob dieses im Widerspruch zu dem steht was eben gesagt wurde, ob sich vielleicht mehr hinter dem verbirgt was geäußert wurde. Kurz: der Interviewer darf den Überblick nicht verlieren. Falls er tatsächlich in die Situation kommt „hängen zu bleiben“, sollte er darauf vorbereitet sein. Er kann z. B. an dieser Stelle zu einer kurzen Pause überleiten, in der er besprochenes wiederholen kann und die Möglichkeit hat sich neu zu orientieren. (Hierfür kann sich der Leitfaden als besonders wichtig erweisen.) Er sollte sich nur vor dem Interview darüber Gedanken machen wie er eine solche Pause geschickt einleitet und auch wie er danach wieder das Interview einleitet. (Kaufmann, 1999)
Andere Überlegungen betreffen die Art und Weise wie sich der Interviewer seinem Gesprächspartner gegenüber verhält. Für den Befragten muss offenkundig sein, dass der Interviewer ihn sympathisch findet und ihm deshalb seine gesamte Aufmerksamkeit widmet. Für den Interviewer bedeutet dies am Anfang des Interviews meist Interesse auch vortäuschen zu können. Im Laufe des Interviews sollte sich dieses vorgetäuschte Interesse jedoch in echtes Interesse umwandeln. Der Interviewer sollte zu dem auch Engagement auf dem jeweiligen Gebiet zeigen. Er kann, und soll, also eigene Meinungen und Reaktionen mit in das Gespräch einfließen lassen. Dadurch kann der Befragte den Interviewer einschätzen, was für Vertrauen sehr wichtig ist.
In diesem Zusammenhang ist auch die Taktik beim qualitativen Interview zu berücksichtigen. Der Interviewer muss sich nicht unbedingt dem Befragten so zeigen wie er wirklich ist. Verstellungen können hier manchmal positive Auswirkungen haben, solange sie die Aussagen der Befragten nicht verändern, sondern nur ausführlichere Antworten hervorrufen. Z.B. kann der Interviewer vorgeben der gleichen Gruppe anzugehören wie der Befragte um dadurch näheres Vertrauen zu schaffen. Der Einsatz solcher Taktiken ist aber mit Vorsicht zu genießen. Insgesamt sollte der Interviewer im darüber Klaren sein wie er sich der anderen Person zeigt. (Kaufmann, 1999)
2.7 Die Auswertung und Analyse
Die Auswertung und Analyse der beim qualitativen Interview gewonnenen Daten ist der Schritt bei dem der Unterschied zum quantitativen Interview am deutlichsten wird. Hier werden Informationen nicht nur gezählt und notiert, sondern vor den verschiedenen Hintergründen der Befragten interpretiert. Bei dieser Art der Auswertung und Analyse verläuft die Arbeit in vier Phasen:
1. Phase: Die Transkription
Um überhaupt eine Interpretation zu ermöglichen, muss das meist sehr umfangreiche Material transkribiert werden, d. h. in eine schriftliche Form gebracht werden. Um alltagssprachliche Gesten wie Lachen, Pausen oder Räuspern in die Transkription einfließen zu lassen, müssen dafür Regeln erstellt werden. Nachdem das gesamte Material in eine lesbare Form gebracht wurde, sollte es noch mal mit der Originalaufnahme verglichen werden um Hörfehler zu verbessern. Dabei können demografische Daten (im Fragebogen erhoben) dem Transkript beigeführt werden.
2. Phase: Die Einzelanalyse
Nachdem alle Interviews transkribiert wurden, beginnt die Analyse der einzelnen Interviews. Hierbei werden alle Nebensächlichkeiten aus dem Transkript entfernt. Anschließend werden die zentralen Aussagen der einzelnen Interviews hervorgehoben. Durch dieses Kürzen und Hervorheben entsteht eine gekürzte Transkription, die dann analysiert wird. Das Ergebnis dieser Analyse ist eine Charakterisierung der einzelnen Interviews.
3. Phase: Die Generalisierende Analyse
In diesem Schritt werden die einzelnen Analysen betrachtet und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. Grundtendenzen und verschiedene Typen von Befragten können hier erläutert werden.
4. Phase: Die Kontrollphase
Bei diesem letzten Schritt werden die vollständigen Transkriptionen sowie die Originalaufnahmen noch mal herangezogen, damit Fehler bei der Interpretation verbessert werden können. Wenn im Team gearbeitet wird, dient der gegenseitige Austausch zur ständigen Kontrolle. (Lamnek, 1989)
3 Steiner und die Waldorfschulen
Nachdem wir uns mit der methodologischen und methodischen Theorie dieser Arbeit beschäftigt haben, soll nun der thematische Hintergrund dargestellt werden, bzw. wir versuchen die Frage ‘Was ist Waldorfpädagogik?’ zu beantworten.
3.1 Historischer Kontext
Richtet man den Blick auf die Geschichte, so lässt sich feststellen, dass die erste ‘Freie Waldorfschule’ im Jahre 1919 gegründet wurde, also zu einem Zeitpunkt, als theoretische und praktische Reformpädagogik eine zentrale Stellung in der deutschen Pädagogik darstellten.
(Politik-)Geschichtlich fällt dieses Datum in die Nachkriegszeit des ersten Weltkrieges, also in eine Phase der gesellschaftlichen und sozialen Neuordnung, was in Hinblick auf drei Aspekte von besonderem Interesse ist:
1. Die Schulgründung geschah auf Initiative eines Unternehmers, nämlich Emil Molt, Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Sie ist also keine private Eliteschule, sondern (ursprünglich) für Kinder der Betriebsangehörigen gedacht; eine in gewissem Sinne sozialistische Komponente lässt sich also nicht leugnen.
2. Der Einfluss der Idee der Rätedemokratie (die in dieser Zeit eine viel diskutierte und kurzfristig ja auch angewandte Staatsform darstellte) ist bis heute erkennbar, denn die beteiligten Individuen (von den Schülern abgesehen) - also Eltern und Lehrer stellen in den organisatorischen Gremien gleichberechtigte Partner dar, denen nicht hierarchisch ein Direktorium übergeordnet ist. Des weiteren erhält jeder Lehrer das gleiche Gehalt und die gleichen Sozialzulagen.
3. In der Eröffnungsrede am 7. September 1919 stellt sich ihr geistiger Vater, Rudolf Steiner, bewusst gegen den (spätestens seit der Industrialisierung) immer stärker werdenden Materialismus und stellt seine Schule gegen „Konsum“ und gegen die „Technisierung des Menschen“ (Steiner, 1919).
3.2 Die Anthroposophie
Was die Waldorfpädagogik relativ klar von anderen reformpädagogischen Richtungen unterscheidet, ist laut Ullrich (1986), dass sie eben nicht aus reformpädagogischer Bestrebung heraus entstand, und sie auch während und nach ihrer Etablierung nicht den Austausch mit anderen pädagogischen Strömungen suchte. Vielmehr entstand sie aus einer Weltanschauung heraus, und auch nur innerhalb derselben (begrenzte) Entwicklung stattfand: die Anthroposophie.
Wenn wir nun versuchen Anthroposophie (in ihrem Bezug zur Waldorfschule) zu umreißen, dann muss darauf hingewiesen werden, dass dies hier nur ansatzweise geschehen kann. Denn die bereits erwähnte, diesbezüglich zentrale Person, Rudolf Steiner, befasste sich sein gesamtes Leben mit dieser ‘Geisteswissenschaft’ (nach der Gründung der ‘Anthroposophischen Gesellschaft’ 1902 explizit, davor schuf er innerhalb seiner philosophischen Studien und seiner Arbeiten als Vorsitzender der ‘Theosophischen Gesellschaft’ - deren Vorläufer - ihre Grundlagen), stellt aber nicht direkt den Zusammenhang zwischen seiner Pädagogik und der Anthroposophie dar.
Das Verständnis erhellt sich ein wenig, wenn man von der herkömmlichen wissenschaftlichen Bedeutung des Begriffs ‘Geisteswissenschaft’ (Steiner verwendet diesen Ausdruck synonym zu Anthroposophie) absieht und in kritischen Schriften nach Erklärung sucht. So beschreibt sie z.B. Beckmannshagen (1984, S.23) als „hellseherisch gewonnene Anthropologie„, die mit Begriffen des Okkultismus und der Geheimwissenschaften„ arbeitet.
Sie stellt also keine pädagogischen Methoden zur Verfügung, so der Waldorflehrer Lindenberg, sondern „eine Methode des Erkennens, eine Art Dinge, Verhältnisse und Menschen aufzufassen„ (1975, S.161). Durch die Auseinandersetzung mit der anthroposophischen Erkenntnistheorie gelange der Mensch zu der von Steiner immer wieder postulierten ‘wahren Menschenerkenntnis’. Oder anders ausgedrückt: Anthroposophie soll die Intuition der WaldorfpädagogInnen so weit geschult haben, dass dieser den jeweiligen Lebensplan bzw. die geistigen Anlagen seiner Zöglinge erfassen kann (Seitz & Hallwachs, 1996).
3.2.1 Religiöse Elemente
Auch wenn er Anthroposophie nicht als Religion verstanden wissen will (es gibt allerdings eine anthroposophische Abspaltung von der Kirche namens ‘Christengemeinde’), so beruft sich Steiner doch immer wieder auf das Christentum (vgl. 4.2).
Darüber hinaus fließen Elemente fernöstlicher Kulturen, welche wohl an Steiner während seiner Mitgliedschaft in der Theosophischen Gesellschaft gelangten (Wehr, 1994), in sie mit ein. Zentral sind hier die Begriffe ‘Reinkarnation’ und ‘Karma’. Wie oben schon angedeutet, ist es also das Karma, das der Erzieher erahnen soll, um eben den Lebensplan des Kindes zu erfassen.
3.2.2 Menschliche Entwicklung
Das der 7-Jahresrhytmus für den menschlichen Organismus von Bedeutung ist lässt sich naturwissenschaftlich leicht nachweisen. Steiner geht jedoch weiter und ordnet die Ontologie vollständig in diesen Zyklus ein:
Mit der Geburt kommt der ‘physische Leib’ zur Welt. In dieser Phase bestimmt das körperliche Wachstum einerseits, und „Nachahmung und Vorbild“ (Steiner, 1907, S.22) andererseits die kindliche Entwicklung.
Mit dem Zahnwechsel, um das siebte Lebensjahr herum, findet die Geburt des ‘Ätherleibes’ statt; ab jetzt kommt es zur Herausbildung „der Neigungen, Gewohnheiten, des Charakters, der Elemente (vgl. 3.3.3).
Das Ende der Geschlechtsreife (ca. 14-16 Jahre) markiert die Geburt des ‘Astralleibes’. Der junge Mensch erlangt nun die Fähigkeit zu Kritik- und Urteilsbildung.
Im vierten Jahrsiebt erhält der nun erwachsene Mensch sein eigenes ‘Ich’; davor war er noch mehr oder weniger durch Karma und andere Menschen fremdbestimmt (Kowal-Summek, 1993).
3.2.3 Die Temperamentenlehre
Einen weiteren zentralen Punkt im anthroposophischen Menschenbild stellt die Temperamentenlehre (Kowal-Summek, 1993) dar, mit der sozusagen der persönlichkeitspsychologische Hintergrund geliefert wird. Auch hier greift Steiner auf Bekanntes zurück: Ihr Ursprung lässt sich bereits in der klassischen Antike finden, nämlich bei dem griechischen Arzt Hippocrates (um 440 v. Chr.); auch im Mittelalter und schließlich sogar in der akademischen Psychologie des 19. Jh. war sie das bedeutendste System zur Erklärung der menschlichen Persönlichkeit (danach verlor sie allerdings immer mehr an Bedeutung, da ihr Kritiker einerseits fehlende wissenschaftliche Nachweisbarkeit und andererseits ein deterministisches und unvollständiges Menschenbild vorwerfen).
Im Prinzip lässt sich die Temperamentenlehre recht kurz beschreiben; sie geht davon aus, dass bei jedem Menschen einer der vier Körpersäfte Blut, Schleim, gelbe oder schwarze Galle vorherrscht und damit dessen Temperament und (weitestgehend) dessen Charakter bestimmt.
Somit werden folgende vier Typen unterschieden:
-Sanguiniker (innerlich wenig stark, leicht abzulenken, oberflächlich, ...)
-Phlegmatiker (innerlich wenig stark, ruhig bis faul, neigt zur Unbeweglichkeit, ...)
-Melancholiker (innerlich stark, tiefsinnig, Neigung zum Grübeln, ...)
-Choleriker (innerlich stark, leicht erregbar, jähzornig, ...)
3.3 Die Waldorfpädagogik
Die in der Literatur immer wieder auftauchende Besonderheiten der Waldorfpädagogik sind folgende:
- Erste Gesamtschule Deutschlands
- 12 Schuljahre für alle
- Klassenlehrerprinzip (vgl. 3.3.4)
- Koedukation (vgl. 4.3)
- Epochenunterricht (vgl. 3.3.2)
- Keine Schulbücher (vgl. 3.3.1.2. / 4.1)
- Keine Zensuren / kein Sitzenbleiben (vgl. 4.4)
- Große Klassen (bis ca. 40 Schüler)
- Fremdsprachen ab erster Klasse
- Monatsfeier, Jahresfeste, Klassenspiele
- Ungewöhnliche Schularchitektur (vgl. 3.3.1.1)
3.3.1 Kunst als Prinzip
In der (anthroposophischen) Waldorfliteratur wird immer wieder die Bedeutung des ‘Künstlerischen’ betont. Ähnlich wie in der Kunsterziehungsbewegung um 1900 ist dies nicht nur bezogen auf gesonderte Fächer, sondern als umfassendes Erziehungsprinzip anzusehen (Lindenberg, 1975), sowohl ‘aktiv’ von den Schülern ausgehend (vgl. 3.3.1.2), als auch ‘passiv’ auf sie einwirkend (vgl. 3.3.1.1).
3.3.1.1 Kunst und Natur zur Anregung der Sinne
Entsprechend der Interpretation Steiners die Sinne als ‚Tor zur Welt‘ anzusehen, spielen diese, ähnlich wie in der Montessoripädagogik, eine große Rolle; insofern werden Naturmaterialien und natürliche ‚Urformen‘ immer wieder in den Unterricht integriert, da dadurch Gelerntes einen persönlicheren und mit Empfindungen verbundenen Bezug zum Kind gewinnen würde.
Auch die äußere und innere Erscheinung der Waldorfschulen, also Architektur, Raumgestaltung und Farbgebung lassen die große Bedeutung erahnen, die Steiner dem Unterrichtsrahmen zukommen lässt: (Möglichst) keine rechten Winkel, geschwungene und ‚lebendige‘ Formen, jedes Klassenzimmer in einer bestimmten (nach Anthroposophischer Auffassung der Entwicklung entsprechenden) Farbe, etc. .
3.3.1.2 Künstlerisches Lernen und Arbeiten
Besonders, wenn es um das Lernen und Arbeiten des Kindes geht spielt das ‚Künstlerische‘, oder wie in weiterem Sinne auch gesagt werden könnte die Eigenaktivität / das Handwerkliche, eine große Rolle. Das beste Beispiel stellt wohl die Lehrmittelgestaltung dar: Es existieren praktisch keine vorgefertigten Unterrichtsmaterialien, vielmehr liegt sie einerseits in der Hand des Klassenlehrers der vorträgt (ohne dabei selbst Medien – von der Tafel abgesehen – zu benutzen, man könnte fast behaupten, dass er selber das Medium ist), groß angelegte Tafelbilder entwirft, etc., andererseits bei den Schülern selbst, die die Tafelbilder übernehmen und weiter ausführen, ihr Klassenzimmer selbst gestalten (z.B. dem Epochenunterricht entsprechend, zur deutlicheren Veranschaulichung des dort behandelten Themas (vgl. 3.3.2) und oft mit Hilfe von Rhythmus und Musik lernen (Seitz & Hallwachs 1996)
Schließlich ist aber auch eine große Zahl an ‚rein‘ künstlerischen-handwerklichen Fächern zu finden: Handarbeiten, Werken in den unteren Klassen und z.B. Buchbinden, Schnitzen in höheren Klassen und Musik und Eurythmie während der gesamten Schulzeit.
3.3.1.3 Eurythmieunterricht
Eine Art ‚Krönung‘ der künstlerischen Waldorf-Erziehung stellt die Eurythmie dar, daher sei sie an dieser Stelle noch extra erwähnt. Man könnte sie als eine Mischung aus Gymnastik, Tanz und Ausdruck beschreiben, die das Ziel hat Sprache und Ton durch menschliche Bewegung sichtbar zu machen.
In der Kindheit stellt sie eher eine Spielform dar, bei der das Kind einfach nur Lust an Ausdruck durch Bewegung empfinden möge, mit der Zeit soll aber auch Geschicklichkeit und später, wenn z.B. eine Gruppendarbietung für eine Schulaufführung eingeübt wird, soziale Fertigkeiten erlernt werden.
3.3.2 Der Aufbau des Unterrichts
Nur wenige Fächer werden dem Stundenplan der Regelschule entsprechend unterrichtet, nämlich nur jene, die einer gewissen Regelmäßigkeit bedürfen wie Fremdsprachen, handwerkliche Fächer und z.B. Religion.
Der Großteil des Lernstoffes wird durch den sogenannten ‚Epochenunterricht‘ vermittelt. Das bedeutet, dass bestimmte (Sub-) Fächer in einer Art Blockunterricht behandelt werden, also über einen bestimmten Zeitraum (ca. sechs Wochen) gibt es einen speziellen Themenschwerpunkt wie Schreiben, Rechnen, Geschichte aber auch Tierkunde oder Gartenbau (Seitz & Hallwachs, 1996).
Begründet wird der Epochenunterricht aus zwei Aspekten:
1. Die Wissens- bzw. Fertigkeitsvermittlung soll interdisziplinär erfolgen, wodurch sowohl der Transfer zwischen den einzelnen Fächern verbessert würde, als auch Schüler, die mit bestimmten Disziplinen Probleme haben, vor einseitigen Misserfolgserlebnissen bewahrt würden.
2. Während der Epoche ist eine starke Konzentrierung auf das behandelte Thema möglich und an deren Ende könne das Gelernte ins „unbewusste Gedächtnis“ absinken, wo es „verarbeitet wird und nach einer Zeitspanne von mehreren Wochen plötzlich als Wissen und Fähigkeit dem Schüler zur Verfügung steht“ (Seitz & Hallwachs, 1996, S.151).
Es existiert allerdings kein festgelegter Fächerkanon für Waldorfschulen, Steiners Vorgaben dienen lediglich als Orientierungspunkte, denn auch er widerspricht sich selbst immer wieder (z.B. bei der Frage ‚ab welcher Klasse Latein / Griechisch?‘ und ‚Latein oder Griechisch zuerst?‘) (Kowal-Summek, 1993).
3.3.3 Der Klassenlehrer
Da der Klassenlehrer in der Waldorfpädagogik eine so zentrale Rolle spielt, wollen wir ihm an dieser Stelle einen eigenen Topos widmen.
Im Gegensatz zur Regelschule beschränkt sich die Zeitspanne als Klassenlehrer für eine bestimmte Jahrgangsstufe nicht auf zwei Jahre, sondern in der Waldorfschule begleitet er sie die ersten acht Jahre ihrer Schullaufbahn.
Diese Besonderheit können wir in Zusammenhang mit zentralen Punkten der Anthroposophie sehen. Denn diese Phase entspricht ja der Zeit der Herausbildung des Ätherleibes (vgl. 3.1.2), in der das Kind beginnt Gewohnheiten zu entwickeln und so Beständigkeit benötigt, die es von der „geliebten Autorität des Erziehers“ erhält (Seitz & Hallwachs, 1996, S.115).
Aber auch Steiners geforderte ‘wahre Menschenerkenntnis‘ (vgl. 3.2) ist in dieser Idee wieder anzutreffen; wobei der Lehrer diese eben nicht nur vor seinem Berufsantritt im Allgemeinen gefunden haben sollte, sondern die er auch im Laufe der Zeit über den einzelnen Schüler gewinnen soll (Lindenberg, 1975). Als Hilfe hierbei dient ihm die schon in 3.1.3 beschriebene anthroposophische Temperamentenlehre. Der Klassenlehrer sollte möglichst bald das jeweilige Temperament der Kinder erkennen; nach dem homöopathischen Grundsatz ‚gleiches mit gleichem zu behandeln‘ versucht er danach sein Verhalten individuell auf das Kind anzupassen und gestaltet die Sitzordnung im Klassenzimmer in der Art, dass jeweils gleiche Temperamente nebeneinander sitzen (Seitz & Hallwachs 1996).
4 Kritische Aspekte der Waldorfpädagogik
Aus den unterschiedlichsten Richtungen und den verschiedensten Motiven heraus ist in den letzten Jahren reichlich Kritik an den Konzepten der Waldorfpädagogik geäußert worden. Neben persönlichen „Abrechnungen“ ehemaliger WaldorfschülerInnen oder -lehrerInnen (vgl. z.B. Kayser & Wagemann, 1991; Rudolph, 1987) ist es vor allem die Erziehungswissenschaft, die der Pädagogik Steiners eine Reihe von Vorwürfen zu machen hat (z.B. Prange, 1985; Ullrich, 1986). Massiv angegriffen wurde die Waldorfpädagogik aber auch nicht zuletzt von den großen Kirchen; hier reicht die Bandbreite der Argumentation von eher moderaten Einschätzungen bis hin zu umfassenden „Warnschriften“ und „Kriegserklärungen“. WaldorflehrerInnen und AnthroposophInnen haben ihrerseits nicht nur den eigenen Blick auf die Dinge dargelegt, sondern vereinzelt auch Stellung zu konkreten Schriften genommen; so beginnt sich allmählich ein Dialog anzukündigen (vgl. z.B. Altehage et al., 1992).
Es geht uns nun weder darum, die Kontroverse um die (konfessionellen vs. anthroposophischen) Auslegungen des Christentums im Einzelnen nachzuzeichnen, noch die Frage eines besser oder schlechter pädagogischer Eigenheiten der Waldorfschule gegenüber der „Regelschule“ zu entscheiden.
Wir möchten aber einige der in kritischen Schriften genannten Aspekte aufgreifen und sie von einer anderen Seite her beleuchten: aus der Perspektive derer nämlich, die jahrelang diese Schule „von innen“ erlebt haben und nun, fast am Ende ihrer Waldorfzeit, zurückblicken können. Wie sehen SchülerInnen der Oberstufe, die elf, zwölf Jahre mit und in der Waldorfschule gelebt haben, ihre Schule? Welche Vorteile und welche Nachteile sehen sie für sich in ihrer (bzw. ihrer Eltern) Wahl dieser Schule? Verkürzt gesprochen also: Wie war / ist es, WaldorfschülerIn zu sein?
Im folgenden möchten wir die von uns gewählten Aspekte, anhand derer wir den Leitfaden für unsere Interviews formulieren, vor dem Hintergrund der entsprechenden Literatur kurz darstellen. Es handelt sich ganz allgemein um Themen, mit denen an Waldorfschulen anders umgegangen wird als an Regelschulen, und die uns insofern für unsere Fragestellung besonders interessant erscheinen.
4.1 Anthroposophische Medienkritik
Wie bereits geschildert (vgl. 3.3.1.2), gibt es in Waldorfschulen nur wenig vorgefertigtes Unterrichtsmaterial; selbst die „klassischen“ Medien - Bücher- werden nur sparsam eingesetzt (vgl. Seitz & Hallwachs, 2000).
Die schärfere Kritik allerdings trifft die neueren technischen Errungenschaften. Aus anthroposophischer Sicht führt bspw. Fernsehen zu Passivität statt Aktivität, zur Bindung an die materielle Welt statt in höhere (Patzlaff, 1988). Durch das Fernsehen, aber auch durch die unkritische Nutzung anderer Medien, würden unbewusst Botschaften unter Umgehung des Ichs aufgenommen, und gerade bei Kindern in dem Alter, in dem sich ein eigenes kritisches Urteilsvermögen und Wertesystem erst noch ausbilden muss, könnten so größte Schäden in der geistig-seelischen Entwicklung hervorgerufen werden. Zudem überwältige und betäube die Informationsüberflutung, wie sie heute durch die technische Erschlossenheit theoretisch aller Bereiche der Welt gegeben ist, die Wahrnehmung, und führe, da eine Verarbeitung damit nicht möglich ist, zu Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit (Patzlaff, 1988; Seitz & Hallwachs, 2000).
Aus diesen Gründen wird in Waldorfschulen ein weitgehender Medienverzicht praktiziert, wenigstens bis zur Pubertät finden Medien (außer wie gesagt vereinzelt Bücher) keine Verwendung im Unterricht, und auch die Eltern der SchülerInnen werden aufgefordert, Fernsehen, Kassettenrecorder etc. aus dem Umfeld ihrer Kinder fernzuhalten bzw. zu entfernen. Dieser bewusste Verzicht setzt außerdem, so die anthroposophische Erläuterung, Kräfte zur Eigenaktivität frei (Altehage et al., 1992).
Wie in den Jahren nach der Pubertät der Einsatz von Medien gehandhabt wird, hängt stark von der Prägung der jeweiligen Schule ab, hier existiert ein breites Spektrum von puritanischer Ablehnung bis zu liberalen Kollegien, für die die Verwendung von Overheadfolien, Videoaufzeichnungen oder PCs selbstverständlich ist (vgl. Barz, 1996).
4.2 Der Umgang mit Religion
Einer der zentralsten Punkte in der Diskussion um die Waldorfschule ist ihr Umgang mit Religion. Kritik seitens der Kirchen bezieht sich, wie oben bereits angedeutet, hier vor allem auf die steiner´sche bzw. anthroposophische Art der Auslegung christlicher Glaubensinhalte. So geht es um Kernpunkte wie das Verständnis von Gnade und Erlösung (Selbstvervollkommnung vs. göttliche Erlösung), die Offenbarungsfrage (wissen vs. glauben) oder die Frage nach dem, was nach diesem Leben kommt (Lehre von Reinkarnation und Karma vs. Auferstehungslehre) (Barz, 1996).
Beiden, der kirchlichen Apologetik ebenso wie jener der Anthroposophie, so betont Weibring zu recht, ist mit Skepsis zu begegnen, da hinter beiden der absolute Anspruch einer zu glaubenden Heilsbotschaft steht, welcher nicht zuletzt die Erhaltung der eigenen Macht sichern soll.
Pädagogisch aber viel relevanter als diese Streitigkeiten erscheint die Tatsache, dass an Waldorfschulen Religion eine so große Rolle spielt wie wohl an kaum einer anderen Schule. Religion wird, ähnlich wie die Kunst, an Waldorfschulen nicht nur als Fach verstanden, sondern darüber hinaus als umfassendes Erziehungsprinzip. Steiners Absicht war eine allgemein -menschliche Erziehung für das Religiöse, das allen Unterricht durchdringen soll (Altehage et al., 1992; Willmann, 1998).
Und wirklich erkennt man, wirft man einen Blick auf den Schulalltag, deutlich diesen „roten Faden“: Das beginnt mit den sogenannten “Morgensprüchen“, und geht weiter mit der Wahl des Erzählstoffes im Hauptunterricht, der u. a. reichlich Raum für christliche Legenden und Geschichten des Alten Testaments vorsieht, und der Eurythmie (vgl. 3.3.1.3), die neben ihren symboldidaktischen Eigenschaften in manchen ihrer Inhalte selbst eine religiöse und spirituelle Dimension hat und damit zu einer Art Propädeutik für religiöses Lernen und Verstehen wird (Willmann,1998). Nicht zu vergessen ist auch das Feiern des christlichen Jahreskreises - nicht nur die „normalen“, auch unbekanntere Feste, so bspw. die Michaelszeit, werden intensiv begangen (vgl. u. a. Barz, 1996; Weibring, 1998).
Neben dieser religiösen „Grundlage“ gibt es den Religionsunterricht im engeren Sinne an der Waldorfschule in vier verschiedenen Ausprägungen: Die evangelische und die katholische Kirche sowie die Christengemeinschaft erteilen ihren konfessionellen Religionsunterricht. Daneben gibt es den sogenannten „freien christlichen Religionsunterricht“, auf den wir im folgenden noch ausführlicher eingehen werden.
In diesem Zusammenhang ist es noch wichtig zu erwähnen, dass es an der Waldorfschule keine Möglichkeit der Abmeldung vom Religionsunterricht gibt. Anthroposophisch wird hier mit dem Verweis auf eine „wirkliche“ Religionsfreiheit argumentiert, welche nur dann gegeben sei, wenn sie auch die Möglichkeit, religiös zu werden, einschließe. Dazu aber dürfe eine frühe Pflege der religiösen Anlagen nicht versäumt werden (vgl. Carlgren, 1972).
Als besonders interessant erscheint uns der „freie Religionsunterricht“, da dieser schon aufgrund seiner Stellung gegenüber den anderen Religionsunterrichtsformen eine Sonderrolle einnimmt - zwar steht auch er eigentlich außerhalb des allgemeinen Lehrplans (Carlgren, 1972), wird aber von WaldorflehrerInnen gegeben und ist schon dadurch stärker mit dem Schulganzen verflochten als dies bei den anderen Formen der Fall ist, deren Lehrkräfte einen exterritorialen Status haben (Weibring, 1998; Willmann, 1998).
Auffallend sind zudem die Differenzen zwischen Schilderungen, die die Motive seiner Einführung betreffen. Meistens geht die Darstellung in die Richtung, dass der freie christliche Religionsunterricht für die konfessionslosen Kinder der Waldorf - Arbeiterschaft eingerichtet worden wäre. Vielmehr aber ist davon auszugehen, dass es eine anthroposophische Initiative war, die diesen Religionsunterricht hauptsächlich für Kinder anthroposophischer Eltern forderte.
Bemerkenswerterweise sprach Steiner selbst von diesem auch nur als „freien Religionsunterricht“ oder „anthroposophischen Unterricht“, die heute gebräuchliche Bezeichnung kam erst später auf und wird erst seit etwa 1983 als feststehender Terminus geführt (Willmann, 1998).
Ziel dieses Unterrichts, so wird auch interessierten Eltern erklärt, eine christlich-konfessionslose Grundlage zu vermitteln, um damit den SchülerInnen spätere einsichtsvolle Stellungnahmen zu religiösen Fragen zu ermöglichen (Carlgren, 1972). Wie dies inhaltlich zu füllen ist, dazu hat Steiner teils detaillierte, teils skizzenhafte Anregungen gegeben; ein Blick in den Lehrplan zeigt in etwa folgendes:
In den ersten vier Klassen sollen Erzählungen religiöses Empfinden wecken und pflegen gegenüber dem Vatergott, dem Göttlichen in der Natur und hohen menschlichen Eigenschaften. Bis zur achten Klasse stellen sodann die Evangelien sowie Biographien historischer Persönlichkeiten vorbildlichen Lebenswandel vor die Augen der SchülerInnen. In den letzten Jahren folgen kirchen- und religionsgeschichtliche Schilderungen, wobei auch Raum für die Darstellung nicht-christlicher Religionen gegeben ist .
Einmal pro Woche besteht außerdem das Angebot zur Teilnahme an einer von Steiner eingesetzten religiösen Handlung, zu der auch die Eltern der SchülerInnen des freien christlichen Religionsunterricht willkommen sind (vgl. Carlgren, 1972; Richter, 1995).
Auch wenn die Intention, eine ungebundene Auffassung des Christentums vermitteln zu wollen, respektiert werden muss, so bleibt das Fundament für diese „Freiheit“ und partiell auch die Inhalte doch anthroposophisch - und dies ist nach der Umbenennung des Unterrichts (s.o.), der übrigens von der Anthroposophischen Gesellschaft verantwortet wird, nicht mehr deutlich.
Eine klarere Bezeichnung dieses Unterrichts, den - nach einer Umfrage des Bunds der freien Waldorfschulen von 1989 - mehr als ein Drittel der WaldorfschülerInnen besuchen, wäre also nicht nur aus Gründen der sachlichen Korrektheit, sondern auch zugunsten von mehr Transparenz angemessen (Willmann, 1998).
Offen bleibt insgesamt die vielfach aufgeworfene Frage, ob die Waldorfschule durch ihren Umgang mit Religion bzw. anthroposophisch gefärbten religiösen Inhalten eine Weltanschauungsschule ist, in deren Pädagogik sich Indoktrination verbirgt, oder aber, wie schon von Steiner immer wieder betont wurde, eine reine “Methodenschule“, in der die Schülerinnen zwar in den Genuss der anthroposophisch gestützten Methodik kämen, von Anthroposophie an sich aber unberührt blieben (vgl. z.B. Altehage et al., 1992; Weibring, 1998).
Fähigkeiten zu wecken, indem die Persönlichkeit des Erwachsenen als Suchender erlebt wird, statt Überzeugungen zu überliefern (Altehage et al., 1992) - ob dieses hohe Ziel erreicht wird oder in gewisser Hinsicht doch Anthroposophie vermittelt wird, lässt sich wahrscheinlich letztlich nicht pauschal, sondern nur von Situation zu Situation, Mensch zu Mensch entscheiden und nachfragen.
4.3 Traditionelle Rollenklischees
Der Umgang mit Rollenklischees und gesellschaftlichen Stereotypen zeigt sich an Waldorfschulen als in manchen Punkten problematisch (Weibring, 1998).
Zunächst mutet es seltsam an, dass das überbrachte Ideal der intakten Kleinfamilie mit einer voll verfügbaren Person (sprich die Mutter) bei der Anmeldung eines Kindes an eine Waldorfschule - die ja nicht zuletzt auch von einem großen Eltern- resp. Mütterengagement lebt - immer noch häufig erwartet wird.
Als ein weiteres wäre die Frage nach der Koedukation zu nennen. (vgl. 3.3)
Hält man sich den geschichtlich-gesellschaftlichen Hintergrund zu der Zeit vor Augen, als Steiner 1919 seine erste Waldorfschule gründete, so kann man nicht umhin, ihm volle Anerkennung zu zollen für seine Forderung und Verwirklichung der gemeinsamen Erziehung von Mädchen und Jungen, die in seiner Schule sogar zusammen Handarbeits- und Sportunterricht hatten/ haben. Heute allerdings stellt sich die Frage, ob - in Anbetracht der Erkenntnisse der Geschlechtererziehung - eine solche Praxis nicht überholt ist. Sicherlich ist man auch an Regelschulen in diesem Punkt noch nicht viel weiter, aber dort beginnt ein Nachdenken, während sich Waldorfschulen - nicht nur in diesem Punkt - den pädagogischen Erkenntnissen der letzten achtzig Jahre weitgehend verschließen und die Geschlechterfrage weiterhin ideologisch untermauern.
Dieser Punkt schließlich, nämlich das Aufrechterhalten geschlechtsspezifischer Rollenklischees im Unterricht und Schulleben der Waldorfschule, verdient besondere Aufmerksamkeit. Ohne auf einzelne Beispiele eingehen zu können, seien doch einige Bereiche genannt, in denen Mädchen und Jungen auf sehr unterschiedliche Vorbilder und damit Möglichkeiten zur Identifikation treffen:
Religiöse Inhalte wie beispielsweise das Vaterprinzip, das der Freie Christliche Religionsunterricht vermittelt, ohne weibliche Bilder daneben zu stellen, vor allem aber auch die zahlreichen Theaterstücke, die an Waldorfschulen von den SchülerInnen aufgeführt werden, sowie die sogenannten „Weihnachtsspiele“ (Paradiesspiel, Christgeburtsspiel und Dreikönigsspiel), die alljährlich von der LehrerInnenschaft aufgeführt werden, sollen hiermit angesprochen sein. In den Rollenverteilungen solcher Stücke fällt einerseits die Polarisierung („Hure vs. Heilige“), andrerseits die Marginalisierung des Weiblichen auf: Mädchen haben oft unzeitgemäße oder negativ besetzte Rollen, oder spielen unbedeutende Nebenrollen. Dagegen wird das Männliche in einer größeren Variationsbreite dargestellt und bietet den Jungen attraktivere Identifikationsmöglichkeiten.
Was die ehemalige Waldorfschülerin Charlotte Rudolph über die Beliebtheit der grimm´schen Märchen an der Schule zu sagen hat, trifft somit auch für viele andere verwendete Texte, die im christlichen Traditionsgut verankert sind, zu:
„Erstens sind sie streng patriarchalisch (...) die positiv geschilderten Frauen überwiegen demütig, schön, fleißig und hilflos, die Männer sind stark, mutig, tapfer, aktiv, redlich und intelligent. darauf können die später erzählten Legenden, Mythen und Sagen aufbauen und diese (bis dahin hoffentlich als “gut“ verinnerlichten) Eigenschaften als Entwicklungsgeschichte der ganzen Menschen weiterleben lassen.“ (Rudolph, 1987, S.144f)
In Frage zu stellen ist nicht, dass man auch auf solche Quellen und Texte zurückgreift, aber wie die Verwendung solchen Materials aussieht, also konkret in welchen Umfang solche Texte gebraucht werden, ob dabei die Stereotype problematisiert oder evtl. angepasst werden, ob im gleichen Maße „moderne“ Texte verwendet und Stücke zur Aufführung gebracht werden und nicht zuletzt, was das unausgesprochene Interesse hinter dem Gebrauch von Stücken mit stereotypen Rollenmustern ist: Dienen sie einem besseren Geschichts-verständnis, oder findet durch die dahintersteckende Moral subtile Sozialisierung statt?
4.4 Leistungsaspekt und Qualität der Berufs- bzw. Studiumsvorbereitung
Oft gestellt wird die Frage nach der Leistung an einer Schule, die ohne das System von Notenbeurteilung und Sitzenbleiben arbeitet. (vgl. 3.3)
Noten werden von Waldorfseite beurteilt als „pädagogisch gesehen systemimmanenter Defekt im heutigen Bildungswesen“ (AG freie Schulen, S.200).Die Wortbeurteilungen, die in Waldorfschulen an die Stelle der Noten treten, sowie die Zeugnissprüche, würden, so die anthroposophische Sicht, die Leistung(-sbereitschaft) nach dem jeweiligen Entwicklungsstand fordern und fördern; dem Druck, der dann mit der Abiturvorbereitung systemfremd von außen kommt, seien WaldorfschülerInnen entsprechend durch ihr gesundes Selbstbewusstsein und ihre kreativen Fähigkeiten gewachsen. Es bestünde also kein Anlass zu Prüfungssorgen, wenn regelmäßig mitgearbeitet wurde und der/die SchülerIn sich keiner Selbsttäuschung hingegeben habe (Altehage et al., 1992; Seitz&Hallwachs, 2000). Manche Berichte ehemaliger WaldorfschülerInnen oder -lehrerInnen lesen sich etwas anders; hier ist durchaus von der fehlenden Vorbereitung darauf, die eigenen Leistungen richtig einzuschätzen, sowie von plötzlich hereinbrechenden „Stress“ in der letzten Klasse die Rede (vgl. Weibring, 1998).
Auch die fehlende Differenzierung während der Schulzeit wird sehr unterschiedlich betrachtet: Anthroposophen sehen hier weniger Nachteile als vielmehr den Vorteil, Lernen als sozialen Prozess erleben und begreifen zu lernen (Altehage et al., 1992), während andere Schwierigkeiten in dieser Praxis sehen, zumal bei kognitiv begabteren Kindern (vgl. Weibring, 1998).
Die praktische Vorbereitung auf eine spätere Berufsentscheidung bzw. -ausbildung scheint durch das breite Angebot an Praktika, die in den Lehrplan eingebunden sind bzw. den SchülerInnen der Oberstufe ermöglicht werden, recht gut; an einigen Schulen existiert darüber hinaus eine spezielle Oberstufendifferenzierung (z. B. Richtung Abitur, Fachabitur oder Gesellenprüfung) und/ oder das Angebot einer handwerklichen Ausbildung während der Schulzeit (Seitz&Hallwachs, 2000).
5 Vorüberlegungen zur Auswahl der InterviewpartnerInnen und Durchführung der Interviews
Bei der Suche nach InterviewpartnerInnen für unsere Untersuchung war es uns zunächst wichtig, SchülerInnen zu befragen, welche schon einen Großteil ihrer Waldorfschulzeit hinter sich liegen, aber noch nicht die 13. Klasse besucht haben. Diese hat durch die Abiturvorbereitung einen ganz anderen Charakter als die ihr vorangehenden Jahre, und das, so war unsere Vermutung, könnte eventuell den Blick auf die gesamte Schulzeit verzerren.
Von den theoretischen Überlegungen zur Rolle des Religionsunterrichts sowie zur Frage der Geschlechterrollen ausgehend wählten wir ein Mädchen und einen Jungen aus, welche beide am freien christlichen Religionsunterrichts teilgenommen hatten. Beide waren seit der 1. Klasse auf Waldorfschulen gewesen, die eine in städtischer, der andere in ländlicher Umgebung. Entscheidend war hier für uns weniger der Stadt – Land Unterschied, sondern vielmehr ging es uns generell darum mit SchülerInnen zweier verschiedener Schulen zu sprechen. Denn aus der theoretischen Beschäftigung mit dem Thema deutlich geworden war, wie stark sich die Schulen voneinander unterscheiden können - etwa in puncto Umgang mit Medien oder anderen praxisrelevanten Fragen, deren Beantwortung mit der Ausrichtung der Schule (sehr anthroposophisch bis sehr liberal) zusammenhängt.
Die Interviews wurden gegen Ende des Schuljahrs bei den SchülerInnen zuhause geführt.
6 Leitfaden
Der folgende Leitfaden sollte in seiner teilstrukturierten Form eine grundlegende Orientierung für das Führen der Interviews geben, aber dabei zugleich noch ausreichend Offenheit für den Gesprächsverlauf erlauben.
So entsprechen die einzelnen Abschnitte des Leitfadens den Themenschwerpunkten, die sich aus den theoretischen Überlegungen ergeben haben; die Einzelfragen/punkte haben wir dabei den Kriterien der Gesprächsführung gemäß (Eisbrecherfragen, etc.) umgeordnet bzw. ergänzt.
- Vorstellungen, welcher Abschluss?
- ... und danach (Traumberuf)?
(wenn ja:) - wie daraufgekommen?
- schon mal ‚reingeschnuppert’?
(generell:) - Angebot an der Schule (Berufsberatung / Praktika)
- Praktika irgendwie ausgewertet?
- (z.B. Zeugnis)
- wie sehen Zeugnisse bei euch aus?
- persönl. Zufriedenheit mit dieser Form?
- Wie werden bei euch an der Schule MEDIEN benutzt?
(Wo (Fächer)?, Welche?, Wie oft?)
- Wie nutzt du MEDIEN ansonsten?
(Freunde, zu Hause, Freizeit)
- Hat sich das im Laufe der Zeit geändert? / Wie war das in den unteren Klassen?
- Hinweis auf andere Waldorfschulen
- Gänzlich „andere“ Fächer z. B. EURYTHMIE?
- was ist das eigentlich?
- wie sieht Unterricht aus?
- Aber zusätzlich habt ihr schon noch SPORT?
- was macht ihr denn da?
- gerne teilgenommen / Alternativen?
- JUNGEN / MÄDCHEN?
- Findet in anderen Fächern Trennung statt? (z.B. Handarbeiten)
- Schuljahresende
gehört, viel THEATER in der Waldorfschule =>„Jahresabschlussaufführung“?
- generelle Erfahrungen mit Theater ? (welche Rollen / Zufriedenheit)
- sonstige Feierlichkeiten zum Schuljahresende / -anfang?
( bei mir gab es immer Schluss- / Anfangsgottesdienst)
- generell: Religiöse Feste / Zeremonien ( „Sonntagshandlungen“)
- Warum warst du im freien Religionsunterricht? (Eltern, Freunde)?
- Wie sieht der eigentlich aus?
- Ist was hängengeblieben?
- Inwieweit hat dich der FU angesprochen - inhaltlich / persönlich?
- Was bedeutet für dich Religion?
persönlich (nicht gesellschaftlich)?
(Weltbild - Jenseits - Gottesbild)
( In diesem Kontext: Thema Beten)
- Schule- da gibt‘s die MORGENSPRÜCHE
(Was bedeuten die für dich / Wie wirken die auf dich?)
- Fällt dir noch irgendwas ein? (Irgendwas vergessen vorhin?)
- Herzlichen Dank
7 Einzelverlaufstabellen
7.1 Einzelverlaufstabelle - Transkription 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7.2 Einzelverlaufstabelle - Transkription 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8 Interpretation
Beide InterviewpartnerInnen schätzen das waldorfpädagogische Prinzip der Notengebung. An den Verbalbeurteilungen werde der eigene Stand gut erkennbar, und letztlich entsprächen diese eigentlich Ziffernnoten.
Dabei beeinflusst die schulische Leistung, wie sie sich im Zeugnis wiederspiegelt, bemerkenswerterweise nicht die soziale Rolle in der Klasse.
Der fehlende Notendruck wird zwar überwiegend als positiv bewertet, kritisiert wird aber, dass es dadurch auch an einer frühzeitigen Abiturvorbereitung mangelt. Beide sprechen von dem Stress, den dies im Abiturvorbereitungsjahr zur Folge hat. EineR der InterviewpartnerInnen redet in diesem Zusammenhang sogar von großer Angst, die Prüfungen überhaupt zu bestehen.
Dass sie das Abitur machen wollen, steht aber für beide fest. Motivation dafür scheinen vor allem relativ klare Studien/Berufswünsche zu sein, welche, so erklären beide, allerdings nicht von der Schule beeinflusst worden wären. Dass es Möglichkeiten zur beruflichen Orientierung und zu außerschulischen Erfahrungen z.B. in Form der Praktika gab, betrachten aber beide als sehr gut und berichten auch von MitschülerInnen, welche dadurch Impulse für ihre Berufswahl gewonnen haben.
Zum Thema Medieneinsatz haben wir beim Durcharbeiten der Transkription bemerkt, dass unsere Fragestellungen eindeutiger hätten sein können, und dass durch die Unklarheit des Begriffs Medien beide InterviewpartnerInnen zunächst einmal mehr die theoretische, also inhaltliche Beschäftigung mit Medien schilderten.
Im folgenden wurde aber auch deutlich, dass Medien zur Wissensvermittlung, wie bspw. Video, kaum benutzt werden, und auch Bücher nur selten zum Einsatz kommen. An deren Stelle treten zahlreiche Kopien, selbständiges Mitschreiben und das häufige Diktieren von Texten. Dieser Unterrichtsstil wird ambivalent beurteilt:
Einerseits wird diese andere Art, sich Stoff zu erarbeiten, als positiv und vor allem in den unteren Klassen hilfreich erachtet. Andrerseits wird aber auch deutlich, dass insbesondere in den oberen Klassen der Einsatz von mehr Büchern sinnvoll wäre. Das würde zum einen Zeit sparen und zum anderen Unsicherheiten vermeiden, die durch die unzureichende Fixierung des Lehrstoffs entstehen.
Was den privaten Medienkonsum - hier gingen unsere InterviewpartnerInnen vor allem auf das Thema Fernsehen ein - anbetrifft, halten sich beide für „normal“, machen aber den Eindruck eines sehr reflektierten Medienkonsums, was ja nicht unbedingt der „Norm“ im Sinne von Durchschnitt entspricht. Wir vermuten, dass diese Selbstverständnis mit ihrer eigenen Geschichte und den daraus erwachsenen Werten zusammenhängt. Beide berichten nämlich, dass sie schon als Kind sehr selten fernsehen durften, und erachten dies sowohl für sich selbst als auch allgemein für sehr positiv und gut, denn frühzeitiger, unkontrollierter Fernsehkonsum, so betonen sie übereinstimmend, störe die kindliche Entwicklung.
Wie erwartet werden Mädchen und Jungen an den Schulen unserer InterviewpartnerInnen in allen Fächern gemeinsam unterrichtet. Dies wird von ihr allerdings ganz anders wahrgenommen und bewertet als von ihm. Wir finden diesen Befund sehr interessant (vgl. dazu Einzelverlaufstabellen und Transkription); er ist aber nicht als waldorfspezifisch zu sehen - vielmehr entspricht er einfach allgemein dem, was zum Thema Koedukation diskutiert wird.
Eine Besonderheit der Waldorfschule ist es allerdings, auch im Sportunterricht Mädchen und Jungen nicht generell zu trennen. Die bemerkenswerten geschlechtsrollenspezifischen Unterschiede in den diesbezüglichen Äußerungen stellen wir deswegen kurz einander gegenüber:
Unserem Interviewpartner stellt sich die Situation - da er ja auch nicht negativ davon betroffen ist - nicht wirklich als problematisch dar. Sie hingegen nimmt die unterschiedliche Atmosphäre in gemischtem bzw. getrenntem Unterricht deutlich wahr und kommt zu dem Schluss, dass die getrennte Form ihr lieber ist.
An dieser Stelle ist also weiterhin die Frage, ob die scheinbare Gleichberechtigung in Form der Koedukation wirklich beiden Geschlechtern die gleichen Chancen einräumt oder ob nicht ein getrennter Unterricht gerade in Sport den Mädchen gerechter werden würde.
Geschlechtsrollenspezifische Aspekte beim Thema Theater, insbesondere bei der Rollenverteilung, konnten wir nicht ausmachen, unsere Fragen zu diesem Bereich fanden aber große Resonanz. Beide InterviewpartnerInnen zeigte sich sehr begeistert davon, an der Schule so viele Möglichkeiten zu haben, auf der Bühne etwas darzustellen. Sie werteten es als wichtige Erfahrung, die nicht nur viel Spaß, sondern auch eine Menge für die persönliche Entwicklung sowie die soziale Atmosphäre in der Klasse bringt.
Das Thema Eurythmie ist für beide InterviewpartnerInnen ein schwieriges, da sie deren Sinn nicht nachvollziehen können. Während er aber dennoch dem Ganzen eine positive Bedeutung für sich geben kann, indem er es als entspannendes Pendant zum ansonsten gleichförmigen Restunterricht betrachtet, ist ihr der Rahmen zu eng. Sie wünscht sich eher eine offenere, auch individuellere Alternative und schlägt z.B. Tanz vor.
Das Thema Umgang mit Religion bereitete uns im Vorfeld, sowie auch im Gespräch und in der Interpretation gewisse Schwierigkeiten. Da dieses aber ein zentraler Kritikpunkt und für uns eine spannende Frage ist, wollten wir es dennoch nicht außer Acht zu lassen. Unser Interesse galt, wie bereits geschildert (vgl. Kap. 4.2.) , der Frage nach dem "religiösen roten Faden" und inwieweit insbesondere der Freie christliche Religionsunterricht, aber auch die Pädagogik der Schule an sich Anthroposophie vermittelt. Der Lehrplan des freien christlichen Religionsunterrichts entspricht nach den Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen dem, was wir theoretisch dargestellt haben, und scheint sich auch, wie bereits erwähnt, inhaltlich kaum vom christengemeinschaftlichen Unterricht zu unterscheiden. Zur Frage, inwieweit hier anthroposophische Inhalte transportiert werden, nimmt eineR unserer InterviewpartnerInnen interessanterweise ohne spezifisches Nachfragen eine defensive Haltung ein und betont, dass Anthroposophie an der Schule nicht Lehrstoff ist. Dass die "Idee von Religion" an der Schule vorhanden ist, bestätigen beide, aber während dies ihn relativ unberührt lässt, fasst sie von sich aus die Elemente des "Roten Fadens" unter dem Stichwort "Rituale" zusammen. Sie unterstreicht deren scheinbar inhaltsunabhängige Wichtigkeit für sich, aber auch für Kinder allgemein.
Beide InterviewpartnerInnen fühlen sich in religiösen Fragen nicht von der Schule beeinflusst. Die eigene Religiosität scheint für ihn im Moment kaum eine relevante Frage zu sein; sie wirkt bei diesem Thema um einiges reflektierter sowie auch emotional betroffener, hält dies aber bemerkenswerterweise für vollkommen normal.
Über unsere in der Theorie beschriebenen Themenschwerpunkte hinausgehend ist uns noch einiges aufgefallen.
Zum einen erwähnt unser Interviewpartner wie viel Wert auf Sprache gelegt wird und welche Vorbehalte die Waldorfpädagogik gegen das Fußballspielen hegt. Auf den Hintergrund zum anthroposophischen Umgang mit diesen Themen waren wir beim Lesen der Theorie gestoßen, hatten diese aber nicht in den Bereich unserer Fragestellungen aufgenommen. Insofern bemerkenswert fanden wir es, in spontanen Äußerungen mitgeteilt bekommen zu haben, inwieweit die der anthroposophischen Theorie entsprechenden Botschaften aufgenommen worden sind.
Zum anderen schildert unsere Interviewpartnerin, das organisatorische Chaos an ihrer Schule, welches ihrer Meinung nach durch das Fehlen der klassischen hierarchischen Schulstruktur entsteht.
Von sich aus haben auch beide InterviewpartnerInnen sich als WaldorfschülerInnen immer wieder mit den von ihnen sogenannten "normalen StaatsschülerInnen" verglichen. Sie sind sich der verschiedenen Vorurteile über WaldorfschülerInnen bewusst und wollen sich ins rechte Licht rücken. Einerseits betonen sie ihre Ebenbürtigkeit in puncto Leistung, andrerseits unterstreichen sie aber auch, dass sie doch etwas Besonderes sind, gerade in der individuellen Entwicklung.
9 Resumée
Es ist dieses besondere Selbstverständnis und die im ganzen sehr positive Einschätzung ihrer Schulen, die hervorsticht, betrachtet man insgesamt die Gespräche mit unseren InterviewpartnerInnen.
Dabei wurde dennoch auch Kritik an einzelnen Punkten der Waldorfpädagogik laut. Als wichtige Themen bleiben hier unter anderem der Wunsch nach mehr Lehrmedien, die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Eurythmie oder das Empfinden mangelnder Schulorganisation festzuhalten. Auch bleibt die Frage offen, ob es für die Waldorfschulen noch sinnvoll ist, sich aus der Debatte um die Koedukation auszuklammern und diese einfach unhinterfragt weiter zu praktizieren.
Somit greifen die Aussagen unserer InterviewpartnerInnen Argumente beider Seiten der Diskussion um die Waldorfpädagogik auf, bestätigen aber keine der beiden vollständig.
Bedenkenswert ist also, von welchen Elementen ihrer Pädagogik sich die Waldorfschulen trennen müssten, um das Wertvolle und Besondere ihrer „Erziehungskunst“ voll zur Geltung zu bringen. Oder um es in den wunderbar konkreten Worten unserer Interviewpartnerin zu sagen:
„Ich find schon, dass irgendwie Waldorfschulen ’ne sehr gute Sache ist, aber es muss auch schon noch ziemlich viel geändert werden, damit es wirklich gut ist.“
10 Literaturverzeichnis
Altehage, G., Hörtreiter, F., Kniebe, G., Leber, S., Ravagli, L., Sandkühler, B. & Winter, U. (1992). Im Vorfeld des Dialogs. Erwiderung der Waldorfschulen auf kritische Darstellungen von kirchlicher Seite über Anthroposophie und Waldorfpädagogik. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Barz, H. (1996). Kindgemäßes Lernen. Was die Waldorfschule anders macht. Freiburg: Herder Spektrum.
Beckmannshagen, F.(1984). Rudolf Steiner und die Waldorfschulen. Wuppertal: Paul-Hans Sievers Verl.-Ges.
Carlgren, F. (1972). Erziehung zur Freiheit. Die Pädagogik Rudolf Steiners. Bilder und Berichte aus der internationalen Waldorfschulbewegung. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Duden. Band 1. Die Deutsche Rechtschreibung. (1991). Mannheim: Dudenverlag.
Flick, Uwe. (1995). Qualitative Forschung. Theorien, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Hamburg: Rowohlt.
Kaufmann, Jean-Claude. (1999). Das Verstehende Interview. Theorie und Praxis. Konstanz: UVK, Univ.-Verl. .
Kowal-Summnek, L. (1993). Die Pädagogik Rudolf Steiners im Spiegel der Kritik. Pfaffenweiler: Centaurus Verl.-Ges.
Lamnek, Siegfried. (1989). Qualitative Sozialforschung. Band 2. Methoden und Techniken. Weinheim: Beltz/ Psychologie Verlags Union.
Lindenberg, C. (1975). Waldorfschulen: angstfrei lernen, selbstbewusst handeln. Reinbeck: Rowohlt.
Patzlaff, R. (1988). Medienmagie und die Herrschaft über die Sinne. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Richter, T. (1995). Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Rudolf-Steiner-Verlag (Hrsg.) (1984, Original von Steiner, R., 1907.). Die Erziehung des Kindes vom Standpunkt der Geisteswissenschaft. Dornach: Rudolf-Steiner-Verlag.
Seitz, M. & Hallwachs, U. (1996). Montessori oder Waldorf? Ein Orientierungsbuch für Eltern und Pädagogen. München: Kösel Verlag.
Ullrich,H . (1986). Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Weinheim: Juventa.
Wehr, G. (1994). Rudolf Steiner zur Einführung. Hamburg: Junius.
Weibring, J. (1998). Die Waldorfschule und ihr religiöser Meister. Waldorfpädagogik aus feministischer und religionskritischer Perspektive. Oberhausen: Athena Verlag.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die einen Titel, ein Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt insbesondere das Thema Waldorfpädagogik und qualitative Interviews.
Was sind die Hauptthemen, die im Inhaltsverzeichnis aufgeführt sind?
Die Hauptthemen umfassen: Qualitative Interviews, Rudolf Steiner und die Waldorfschulen, kritische Aspekte der Waldorfpädagogik, Vorüberlegungen zur Auswahl der Interviewpartner und Durchführung der Interviews, ein Leitfaden, Einzelverlaufstabellen, Interpretation, Resümee und Literaturverzeichnis.
Welche verschiedenen Formen des qualitativen Interviews werden besprochen?
Das Dokument beschreibt verschiedene Formen des qualitativen Interviews, darunter das narrative Interview, das problemzentrierte Interview, das fokussierte Interview, das Tiefen- oder Intensivinterview und das rezeptive Interview.
Was sind die methodologischen Aspekte des qualitativen Interviews?
Die methodologischen Aspekte umfassen: das Prinzip der Offenheit, das Prinzip der Flexibilität, das Prinzip der Prozesshaftigkeit, das Prinzip der alltäglichen Situation, das Prinzip der Kommunikativität, das Prinzip der Relevanzsysteme der Betroffenen und das Prinzip der Explikation.
Was sind die methodisch-technischen Aspekte des qualitativen Interviews?
Die methodisch-technischen Aspekte umfassen: offene Fragen, natürliche Umgebung und die Aufzeichnung des Interviews.
Wer war Rudolf Steiner und was ist Anthroposophie?
Rudolf Steiner war der Begründer der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik. Anthroposophie wird hier beschrieben als eine Art „hellseherisch gewonnene Anthropologie", die mit Begriffen des Okkultismus und der Geheimwissenschaften“ arbeitet.
Was sind die zentralen Prinzipien der Waldorfpädagogik?
Zu den zentralen Prinzipien gehören Kunst als Prinzip, ein besonderer Aufbau des Unterrichts (Epochenunterricht) und die zentrale Rolle des Klassenlehrers.
Welche Kritik wird an der Waldorfpädagogik geübt?
Kritische Aspekte umfassen anthroposophische Medienkritik, der Umgang mit Religion (insbesondere die Auslegung christlicher Glaubensinhalte), traditionelle Rollenklischees und Fragen zum Leistungsaspekt sowie der Qualität der Berufs- bzw. Studiumsvorbereitung.
Was ist der "freie christliche Religionsunterricht" und warum ist er umstritten?
Der "freie christliche Religionsunterricht" ist eine besondere Form des Religionsunterrichts an Waldorfschulen, der von Waldorflehrern gegeben wird. Er ist umstritten, weil er zwar eine christlich-konfessionslose Grundlage vermitteln soll, sein Fundament und teilweise auch die Inhalte aber anthroposophisch geprägt sind.
Welche Rolle spielt der Klassenlehrer in der Waldorfpädagogik?
Der Klassenlehrer spielt eine zentrale Rolle, da er die Schüler die ersten acht Jahre ihrer Schullaufbahn begleitet.
Wie wird die Leistung der Schüler an Waldorfschulen bewertet?
An Waldorfschulen gibt es keine Noten. Stattdessen werden Wortbeurteilungen und Zeugnissprüche verwendet.
Wie werden Medien in Waldorfschulen eingesetzt?
In Waldorfschulen wird ein weitgehender Medienverzicht praktiziert, insbesondere bis zur Pubertät.
- Quote paper
- Jörn Killinger (Author), 2000, Waldorfpädagogik aus SchülerInnensicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110565