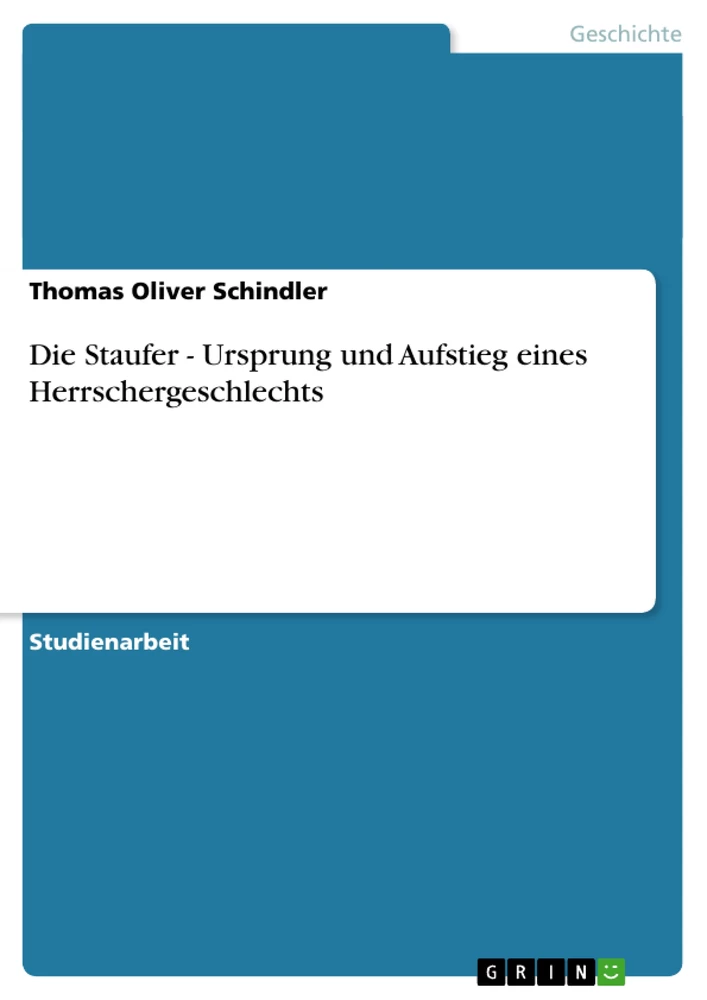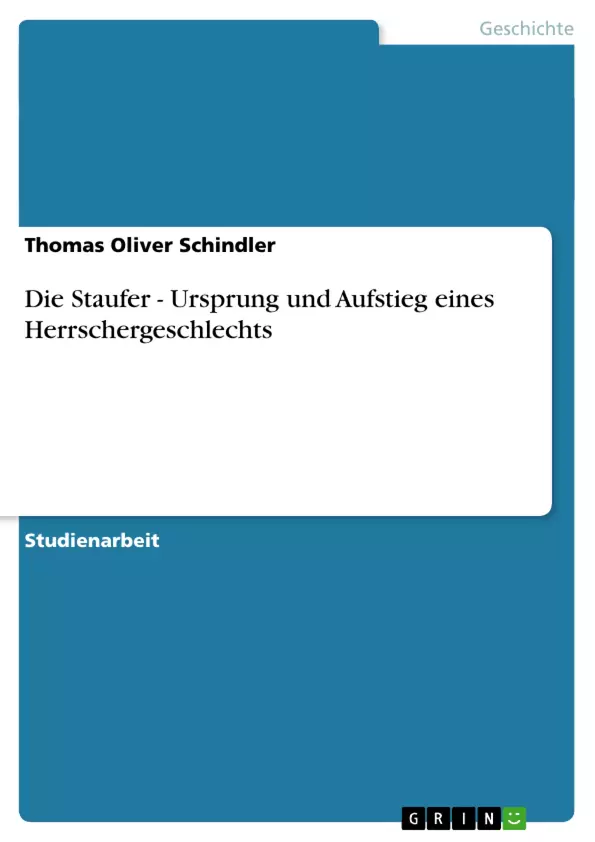„Es sind in der Tat eindrucksvolle Spuren, die dieses begabteste unter den deutschen Herrschergeschlechtern, wo immer seine Häupter und seine Anhänger in Erscheinung getreten sind, hinterlassen hat“.
Dieses Zitat Josef Fleckensteins Festtagsrede läßt wohl kaum Zweifel am Forschungsbedarf in diesem Bereich. Das Thema in dieser Arbeit wird sein, festzustellen, wie die Staufer zum „begabtesten unter den deutschen Herrschergeschlechtern“ wurden, also Augenmerk auf ihren Ursprung und Aufstieg zu legen.
Ein Zeitgenosse staufischer Kultur war der Chronist und Bischof Otto von Freising, der als wichtiges „staufisches Zentrum der Historiographie“ gilt. Er wurde etwa um 1111 als Halbbruder der Staufer Konrad und Friedrich, als Sohn der Tochter Heinrichs IV. in ihrer zweiten Ehe mit Leopold IV. geboren. Er studierte auf der Universität in Paris, war später Zisterziensermönch, danach Abt, wurde 1138 zum Bistum in Freising berufen und starb 1158 . „Otto war als philosophisch durchgebildeter Gelehrter, ruhiger Beobachter, praktisch an der Zeitgeschichte beteiligter Reichsbischof und nächster Verwandter der Staufer in seltenem Maße zur Geschichtsschreibung befähigt“ .
Die Quellenbasis wird sich deshalb hauptsächlich auf Otto von Freisings „Gesta Frederici“ stützen, wobei sein früheres Werk die „Chronica“ als faktischer Rückhalt dienen soll. Denn trotz des selben Autors unterscheiden sich die Quellen in einem wichtigen Punkt: in ihrer Intention. In seiner Chronik versucht Otto die Fakten unverfälscht und chronologisch vor dem Hintergrund des allgemein erwarteten Weltendes darzustellen. Nicht so pessimistisch, gar fröhlich und heilsgeschichtlich erfahren dieselben Einzelberichte in den Gesta Umfärbungen, Verdrehungen, Weglassungen, Über- und Untertreibungen. So kann ein kritischer Quellenumgang nur mit Hilfe beider Werke gewährleistet werden.
Trotzdem wird sich die Arbeit auch in ihrem chronologischen Verlauf und den Aufzählungen kongruent zu denen der Gesta verhalten, um den Aufstieg der Staufer vom Ursprung über die Herzogserhebung bis zur Designation Barbarossas durch König Konrad III. zu dokumentieren. Nach eigenem Verständnis und um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen endet der Aufstieg, kurz vor dem Höhepunkt, der Amtszeit Freidrich I. Barbarossas.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprung der Staufer, Herzogserhebung und Salierzeit
- Woher weiß man von den Staufern?
- Hausgut und Familienbesitz
- Der Sachsenaufstand: Die Ursache der Herzogserhebung der Staufer
- Die Herzogserhebung der Staufer durch Heinrich IV.
- Die Staufer als schwäbisches Herzogsgeschlecht während der Salierzeit
- Die Staufer und Lothar III.
- Die Wahl Lothars
- Das staufische Gegenkönigtum
- Der erste staufische König Konrad III.
- Die Wahl Konrads
- Regierungsjahre Konrads
- Konrads Tod und Friedrich III. / I. Barbarossa
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ursprung und Aufstieg des Staufergeschlechts bis zum Beginn der Regierungszeit Friedrich Barbarossas. Das Ziel ist es, die Entwicklung der Staufer von ihren unbekannten Anfängen bis zu ihrer Etablierung als bedeutendes deutsches Herrschergeschlecht nachzuvollziehen.
- Die unklaren Ursprünge der Stauferfamilie und die Schwierigkeit, ihre frühe Geschichte zu rekonstruieren.
- Die Rolle der Staufer während der Salierzeit und ihre allmähliche Erhebung zur Macht.
- Der Sachsenaufstand und seine Bedeutung für die Herzogserhebung der Staufer.
- Die Bedeutung von Otto von Freising als Quelle und die Herausforderungen des kritischen Umgangs mit seinen Werken ("Gesta Frederici" und "Chronica").
- Die Wahl Konrads III. zum König und die politischen Konstellationen dieser Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die bedeutende historische Hinterlassenschaft der Staufer und verweist auf Josef Fleckensteins Einschätzung des Geschlechts als das „begabteste unter den deutschen Herrschergeschlechtern“. Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung des Ursprungs und Aufstiegs der Staufer bis zum Beginn der Herrschaft Friedrich Barbarossas. Die methodische Herangehensweise wird skizziert, wobei die „Gesta Frederici“ von Otto von Freising als zentrale Quelle hervorgehoben wird, ergänzt durch dessen „Chronica“ und weitere Quellen, um einen kritischen Umgang mit der Quellenlage zu gewährleisten. Die Verwendung von sowohl älterer als auch neuerer Sekundärliteratur wird ebenfalls erläutert.
Ursprung der Staufer, Herzogserhebung und Salierzeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der ungeklärten Herkunft der Staufer. Es wird die Schwierigkeit, zuverlässige Informationen über die Familie vor der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts zu finden, deutlich gemacht. Die Quellenlage ist spärlich und beruht auf fragmentarischen Informationen, vor allem aus dem Kontext des Eheprozesses Friedrich Barbarossas. Das Kapitel analysiert unterschiedliche Perspektiven in der Forschung, insbesondere die Ansichten von Odilo Engels und Johannes Lehmann bezüglich der frühen Genealogie der Staufer. Die Herzogserhebung Friedrichs I. durch Heinrich IV. wird als entscheidender Wendepunkt im Aufstieg des Geschlechts dargestellt, der den Grundstein für ihren späteren Aufstieg legte.
Die Staufer und Lothar III.: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Staufer während der Regierungszeit Lothars III. Es diskutiert die Wahl Lothars zum König und den damit verbundenen Konflikt, in dem die Staufer eine bedeutende Rolle spielen, z.B. durch die Bildung eines staufischen Gegenkönigtums. Die Analyse konzentriert sich auf die politischen Intrigen und Machtkämpfe dieser Zeit und die strategischen Entscheidungen der Staufer im Kampf um den Thron.
Der erste staufische König Konrad III.: Dieses Kapitel widmet sich der Regierungszeit Konrads III., dem ersten staufischen König. Es untersucht die Wahl Konrads und analysiert seine Regierungsjahre, die von diversen politischen Herausforderungen und Konflikten geprägt waren. Das Kapitel beleuchtet die politischen Manöver und Entscheidungen Konrads, die den späteren Aufstieg der Staufer maßgeblich beeinflussten. Der Tod Konrads und die damit verbundene Thronfolge Friedrichs I. Barbarossas bilden den Schlusspunkt des Kapitels und markieren den Höhepunkt des Aufstiegs des Staufergeschlechts.
Schlüsselwörter
Staufer, Ursprung, Aufstieg, Salierzeit, Lothar III., Konrad III., Friedrich I. Barbarossa, Herzogserhebung, Otto von Freising, Gesta Frederici, Chronica, Quellenkritik, Genealogie, Politik, mittelalterliche Geschichte, Deutsches Kaiserreich.
Häufig gestellte Fragen zum Aufsatz: Ursprung und Aufstieg der Staufer
Was ist der Gegenstand dieses Aufsatzes?
Der Aufsatz untersucht den Ursprung und Aufstieg des Staufergeschlechts bis zum Beginn der Regierungszeit Friedrich Barbarossas. Er verfolgt die Entwicklung der Staufer von ihren unbekannten Anfängen bis zu ihrer Etablierung als bedeutendes deutsches Herrschergeschlecht.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind die unklaren Ursprünge der Stauferfamilie, ihre Rolle während der Salierzeit, der Sachsenaufstand und dessen Bedeutung für die Herzogserhebung, die kritische Auseinandersetzung mit den Quellen (vor allem Otto von Freising), die Wahl Konrads III. und die politischen Konstellationen dieser Zeit.
Welche Quellen werden verwendet?
Die "Gesta Frederici" und die "Chronica" von Otto von Freising bilden die zentralen Quellen. Der Aufsatz betont einen kritischen Umgang mit diesen und weiteren Quellen. Zusätzlich wird sowohl ältere als auch neuere Sekundärliteratur herangezogen.
Wie ist der Aufsatz strukturiert?
Der Aufsatz gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Ursprung der Staufer, ihrer Rolle während der Salierzeit und unter Lothar III., ein Kapitel über Konrad III. und eine abschließende Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Übersicht über die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte sind ebenfalls enthalten.
Welche Schwierigkeiten birgt die Erforschung des Stauferursprungs?
Die Erforschung des Stauferursprungs ist schwierig, da die Quellenlage vor der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts spärlich und fragmentarisch ist. Die Informationen basieren oft auf indirekten Hinweisen, z.B. aus dem Kontext des Eheprozesses Friedrich Barbarossas. Unterschiedliche Perspektiven in der Forschung werden diskutiert (z.B. Odilo Engels und Johannes Lehmann).
Welche Rolle spielte der Sachsenaufstand?
Der Sachsenaufstand wird als eine entscheidende Ursache für die Herzogserhebung der Staufer durch Heinrich IV. dargestellt. Dieser Wendepunkt legte den Grundstein für den späteren Aufstieg des Geschlechts.
Welche Bedeutung hat Otto von Freising für den Aufsatz?
Otto von Freising und seine Werke ("Gesta Frederici" und "Chronica") sind zentrale Quellen für den Aufsatz. Die Arbeit betont jedoch die Notwendigkeit eines kritischen Umgangs mit diesen Quellen.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse des Aufsatzes?
Der Aufsatz zeichnet den Weg des Staufergeschlechts vom unbekannten Ursprung bis zum Beginn der Herrschaft Friedrich Barbarossas nach. Er beleuchtet die politischen Intrigen, strategischen Entscheidungen und die Herausforderungen, die die Staufer auf ihrem Weg zur Macht bewältigen mussten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Aufsatzinhalt?
Schlüsselwörter sind: Staufer, Ursprung, Aufstieg, Salierzeit, Lothar III., Konrad III., Friedrich I. Barbarossa, Herzogserhebung, Otto von Freising, Gesta Frederici, Chronica, Quellenkritik, Genealogie, Politik, mittelalterliche Geschichte, Deutsches Kaiserreich.
- Citar trabajo
- Thomas Oliver Schindler (Autor), 2002, Die Staufer - Ursprung und Aufstieg eines Herrschergeschlechts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11046