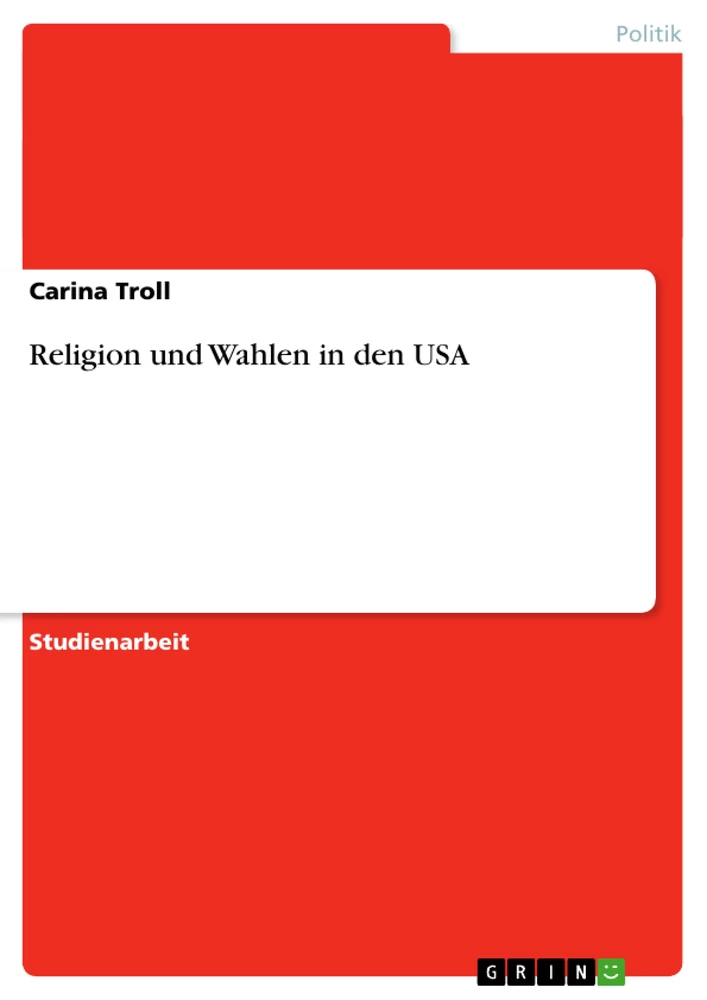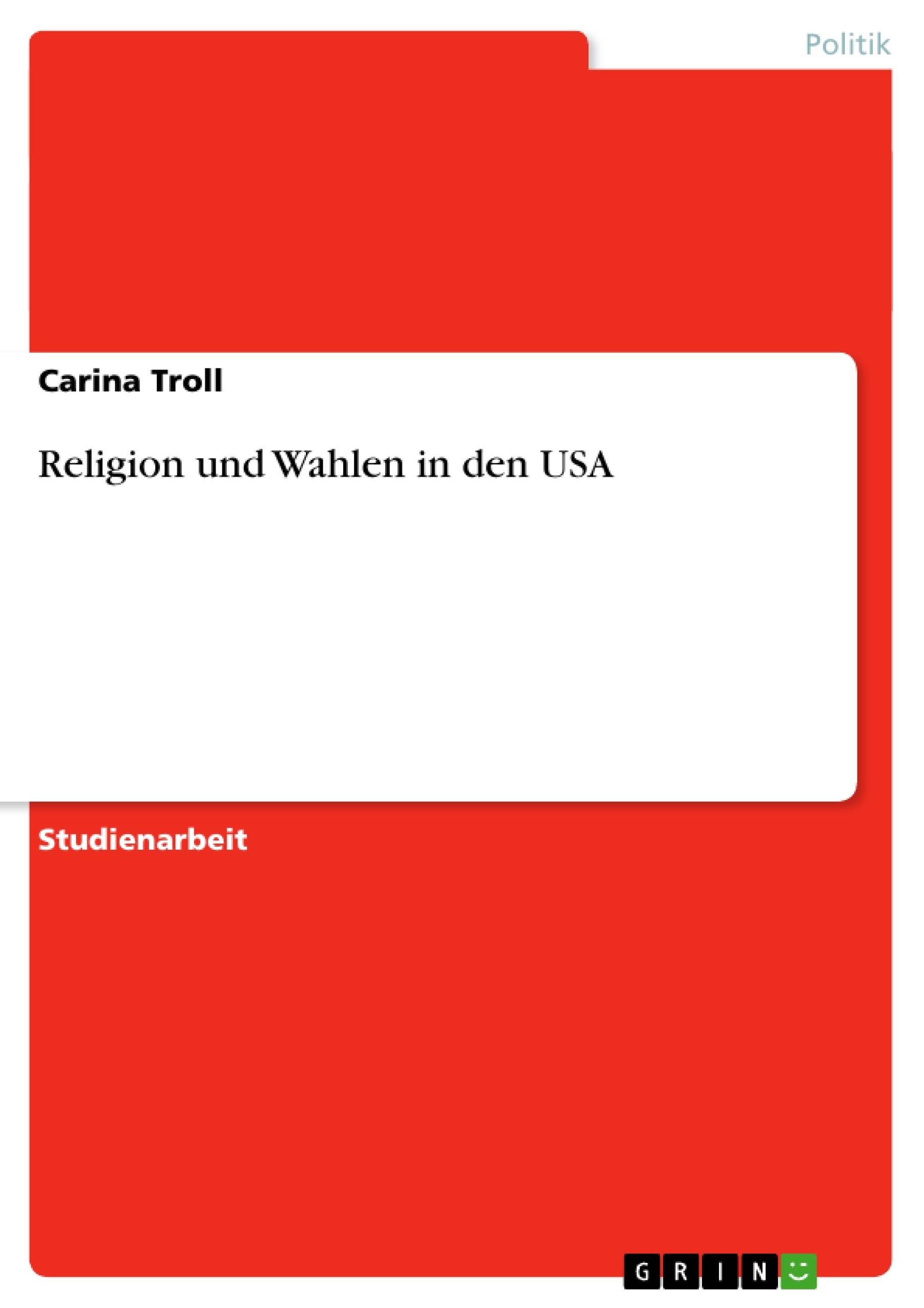Was wäre, wenn die tiefsten Überzeugungen eines Landes nicht nur seine Bürger, sondern auch seine Politik prägen? Tauchen Sie ein in eine fesselnde Analyse des Zusammenspiels von Religion und Politik in den USA, am Beispiel der Präsidentschaftswahl 2004. Diese aufschlussreiche Studie beleuchtet, wie George W. Bush und John F. Kerry, zwei Männer unterschiedlicher Konfessionen und politischer Lager, versuchten, die religiösen Wähler für sich zu gewinnen. Entdecken Sie, wie sie Glaubenssätze, zivilreligiöse Symbole und moralische Werte in ihren Wahlkampagnen einsetzten, um eine Verbindung zu den Herzen und Köpfen der amerikanischen Bevölkerung herzustellen. Von den konservativen Evangelikalen bis zu den liberalen Protestanten, von den Afroamerikanischen Kirchen bis zur katholischen Wählerschaft – dieses Buch enthüllt die komplexen Dynamiken, die die religiöse Landschaft der USA ausmachen und wie diese die politische Entscheidungsfindung beeinflussen. Untersuchen Sie, wie die Kandidaten ihre persönliche Religiosität zur Schau stellten, um Vertrauen zu gewinnen, und wie sie sich zu Schlüsselthemen wie gleichgeschlechtlicher Ehe, Abtreibung und Stammzellenforschung positionierten. Wurden ihre Botschaften von den Wählern als authentisch wahrgenommen, oder gab es Widersprüche zwischen ihrem Glauben und ihren politischen Handlungen? Erfahren Sie, welchen Einfluss die "Christian Right" und andere religiöse Gruppen auf die Politik der Republikaner ausübten und wie die amerikanische Zivilreligion als Kitt für eine Nation unterschiedlicher Glaubensrichtungen diente. Schliesslich wird analysiert, inwiefern die religiösen Strategien der Kandidaten den Wahlausgang beeinflussten und welche Lehren daraus für zukünftige Wahlkämpfe gezogen werden können. Eine unentbehrliche Lektüre für alle, die verstehen wollen, wie Glaube und Politik in den USA untrennbar miteinander verbunden sind und wie diese Verbindung die Welt beeinflusst. Dieses Buch bietet tiefgreifende Einblicke in die amerikanische Seele und die Mechanismen der politischen Macht. Es analysiert die subtilen, aber wirkungsvollen Strategien, mit denen Kandidaten religiöse Werte instrumentalisieren, um Wählerstimmen zu gewinnen, und entlarvt die verborgenen Agenden hinter den frommen Fassaden. Eine spannende Reise durch die amerikanische Politik, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven eröffnet. Die US-Wahl 2004 aus einer völlig neuen Perspektive: Religion, Moral und die Macht der Überzeugung.
1. Einleitung
Der Glaube an Gott ist in den USA allgegenwärtig. Ein ehrenamtliches Engagement in der Kirche, das Gebet am Mittagstisch und die Einhaltung von religiösen Richtlinien gehören für viele US-Amerikaner zum täglichen Leben. Man erkennt schnell: Die USA sind religiöser als jeder europäische Staat. 94 Prozent der Amerikaner glauben an Gott und 86 Prozent vertrauen auf den Himmel[1]. Die traditionelle sozialwissenschaftliche These, dass mit Modernisierung und technischem Fortschritt eine Säkularisation der Gesellschaft einhergeht, trifft hier wohl kaum zu. In den USA wäre es kein Widerspruch, dass der fähigste Computerentwickler die Bibel wörtlich auslegt. Die Politik bewacht und unterstützt diese hohe Bedeutung des Glaubens. Gemäß der Religionsfreiheit, die im ersten Punkt des Menschenrechtskatalogs der Bill of Rights festgehalten ist, üben 70 Prozent der US-Amerikaner ihre Religion in etwa 250 hauptsächlich christlich-protestantischen und -katholischen Kirchen aus. Dazu kommt eine Vielzahl von Glaubensgemeinschaften mit unterschiedlichsten Grundsätzen[2].
Die religiöse Bevölkerung zählt somit zu einer der bedeutendsten Gruppen in den USA, sowohl in ihrer Funktion als Wählerinnen und Wähler sowie als Entscheidungsträger im Kongress. Demnach sind die Themen und Inhalte der Wahlkampagnen genau auf deren Interessen und Vorlieben ausgerichtet. Kandidaten setzen ihre eigene Religiosität ein, um zu zeigen, dass sie ihr Leben nach denselben moralischen Werten ausrichten wie die religiösen Wähler. Denn „die Mehrzahl der Amerikaner stuft Charakter höher ein als Kompetenz, für sie ist Moral wichtiger als die Ökonomie“[3]. Ziel der Arbeit ist es, darzustellen, welche religiösen Inhalte und Moralvorstellungen George W. Bush und John F. Kerry bei der vergangenen Präsidentschaftswahl verbreiteten. Dabei soll der Einsatz von Glaubenssätzen und Symbolen der amerikanischen Zivilreligion besonders berücksichtigt und analysiert werden. Abschließend werden die Ergebnisse der Wahl 2004 präsentiert, um festzustellen, ob sich die Bemühungen der Kandidaten im Wahlausgang widerspiegeln.
2. Religion in den USA
2.1 Religiöse Glaubensgemeinschaften
Die religiöse Wählerschaft wird in ihren Entscheidungen und Orientierungen stark von den Glaubensgrundsätzen ihrer Kirchen geprägt. Moralisch-religiöse Auffassungen über eine ideale Lebens- und Staatsführung beeinflussen die Gläubigen bei dem Gang zur Wahlurne. Dabei ist „die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession oft ein Indiz für die politische Einstellung der Menschen“[4]. Deshalb ist es wichtig, einen Überblick über die verschiedenen Denominationen der amerikanischen Bevölkerung, ihre Richtlinien und damit Parteipräferenzen zu erarbeiten.
Rund 80 Prozent der US-Amerikaner bezeichnen sich als Christen, d.h. sie gehören einem der drei Hauptzweige des Christentums an, dem Protestantismus, Katholizismus oder der Orthodoxie[5]. Die Vielfalt der Kirchen, die ihre historischen Wurzeln in der Flucht der europäischen Siedler vor Religionszwang hat, ist kaum überschaubar. Deshalb werden hier die Glaubensgemeinschaften beschrieben, die die meisten Anhänger einer Bevölkerungsgruppe auf sich vereinen. Zum protestantischen Glauben bekennt sich rund die Hälfte der amerikanischen Gesamtbevölkerung. Der Protestantismus bezeichnet viele unterschiedliche Glaubensgemeinschaften europäischen Ursprungs, die sich durch den Einfluss von Martin Luther oder John Calvin im 16. Jahrhundert von der römisch-katholischen Kirche abspalteten. Die stärkste protestantische Gruppe stellen mit über 25 Prozent die konservativen, hauptsächlich weißen, Evangelikalen[6], unter anderem aus dem Grund, da sie große Anstrengungen für die Gewinnung neuer Mitglieder auf sich nehmen. Eine Gallup-Umfrage verkündet sogar, dass sich 42 Prozent der Amerikaner als Evangelikale oder wiedergeborene Christen bezeichnen[7]. Charakteristisch für diese Kirche ist der Glaube an eine Bekehrung durch Gott. Man löst sich von bisherigen Sünden und entscheidet sich für ein Leben im Sinne christlicher Werte. Diese Erfahrung wird auch als „new birth“ oder „born again“ bezeichnet. Oberste religiöse Autorität ist die Bibel. Besonders fundamentalistische Evangelikale interpretieren diese wörtlich und verteidigen die biblische Entstehungsgeschichte, die jungfräuliche Empfängnis Marias und die Wiedergeburt Jesus gegen wissenschaftliche Erkenntnisse wie die Darwinsche Evolutionstheorie[8]. Bei den Präsidentenwahlen 2000 und 2004 machten die Evangelikalen, die eher aus ländlichen Gegenden stammen und einen geringeren Bildungsgrad sowie ein niedrigeres Einkommen besitzen, 23 Prozent der gesamten Wählerschaft aus[9]. Ein großer Vorteil für George W. Bush, denn die Gläubige wählen hauptsächlich republikanisch, da sie aufgrund ihrer religiösen Richtlinien eine sozial-reformerische und liberale Politik ablehnen. Die gleichgeschlechtliche Ehe, Abtreibungen und Stammzellenforschung sind im Mittleren Westen und im Süden der USA, den Heimatorten der Mitglieder, ein absolutes Tabu.
Die liberalen oder mainline Protestanten vertreten eine moderatere Auffassung vom Glauben und sind bis zu gewissen Grenzen offen für soziale Veränderungen. Die mit 22 Prozent zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in den USA, zu der unter anderem die Methodisten und die Lutheraner gehören, hat zahlreiche moralische und politische Reformbewegungen unterstützt. Mitglieder sind größtenteils weiße Amerikaner europäischen Ursprungs, aber auch Afroamerikaner und Menschen anderer Herkunft[10]. Zwar variieren die Parteipräferenzen je nach traditioneller oder moderater Einstellung der mainline Protestanten, dennoch ist eine Tendenz in Richtung der Republikaner klar zu erkennen.
Der Hauptteil der Vorfahren der heutigen afroamerikanischen Protestanten konvertierte Anfang des 19. Jahrhunderts zum christlichen Glauben. Aufgrund von Diskriminierungen durch europäisch stämmige Gläubige gründeten viele ihre eigenen Kirchen und passten die religiösen Richtlinien an ihre Mentalität an. Auch heute sind Gospels und Spirituals charakteristisch für den lebendigen Gottesdienst. Studien belegen, dass afroamerikanische Kirchen einen größeren Einfluss auf ihre Mitglieder haben als Glaubensgemeinschaften mit weißen Mitgliedern[11]. Dennoch ist ihr Anteil seit den sechziger Jahren rückläufig. Knapp acht Prozent der amerikanischen Christen sind afroamerikanischen Protestanten[12]. Traditionell tendieren die Anhänger zu den Demokraten, da diese besonders für die Rechte der schwarzen Bevölkerung im amerikanischen Schmelztiegel einstehen. Bei den Präsidentenwahlen 2000 bekam Bush nur neun Prozent der schwarzen Stimmen, während Al Gore auf 90 Prozent kam[13]. Jedoch sind mittlerweile Wanderungen zu den Republikanern zu beobachten. Ein Einfluss, der den High-Impact-Churches zugeschrieben werden kann. Diese wohlhabenden, streng religiösen Kirchen praktizieren eine straffe Führung und richten sich nach konservativen moralischen Vorstellungen. Sie erwarten deshalb auch „von den Politikern Amerikas absolute Integrität, Moral und Gerechtigkeits-sinn als Selbstverständlichkeit“[14].
Der Katholizismus war lange in den USA verpönt, denn er passte nicht recht zu dem amerikanischen Freiheitsideal, da die Gläubigen sich unter die Autorität des Papstes stellten. Es machte sich ein regelrechter Antikatholizismus breit. Ab 1950 jedoch entwickelte sich diese Glaubensrichtung zu einem der „America’s three faiths“[15]. Unterstützt wurde der Integrationsprozess durch die Wahl John F. Kennedys 1960, dem ersten katholischen Präsidenten. Die Katholiken, die ungefähr 27 Prozent der Wählerschaft stellen und damit einen höheren Anteil als die Protestanten darstellen, sind hart umkämpft[16]. Denn die Stimmen der katholischen Arbeiter der alten Roosevelt-Koalition, die den Demokraten über viele Jahre sicher waren, wandern langsam nach rechts. Das trifft auch auf viele Lateinamerikaner zu. Besonders die traditionellen Katholiken sind erbost, wenn sich die Demokraten mal wieder für Abtreibungen oder Homo-Partnerschaften aussprechen und tendieren deshalb zu den Republikanern. Zum anderen erzielen Republikaner und Demokraten in den Staaten, in denen viele Katholiken leben, unter anderem in Missouri, Wisconsin, Ohio und Pennsylvania, nahezu gleiche Ergebnisse. Das erfordert harte Wahlkämpfe. Die katholischen Stimmen sind noch wichtiger. Auch der Einfluss der katholischen Kirche und ihrer Pfarrer auf die Wähler bezüglich eines konservativeren Wahlverhaltens darf nicht unterschätzt werden. Dennoch halten besonders liberale Arbeiter und Gläubige, für die religiöse Einstellungen eines Kandidaten weniger wichtig sind, den Demokraten die Treue[17].
Nicht zu vergessen bei einem Überblick über US-Religionen, ist auch die andere Seite, die Säkularen. 2000 konnte Al Gore 62 Prozent dieser Stimme für sich verbuchen. Doch ist die Zahl derer, die niemals eine Kirche betreten, viel kleiner als die der regelmäßigen gläubigen Kirchgänger. Deshalb liegt die Konzentration des Wahlkampfes auf der Ansprache der religiösen Amerikaner[18].
2.2 Der Einfluss religiöser Gruppen auf die Politik
Staat und Religion sind in den USA streng getrennt. Es gibt weder eine staatlich eingezogene Kirchensteuer noch bekommen die Kirchen Unterstützung vom Staat in irgendeiner Form. Dennoch sind die Mauern der historisch begründeten Separation mittlerweile durchlässig geworden - mit Zustimmung der Bevölkerung. Eine Gallup-Umfrage belegt, dass über die Hälfte der Amerikaner eine Einfluss-nahme der Kirchen auf die Politik befürworten. In den sechziger Jahren stimmte noch die Mehrheit dagegen[19]. Möglichkeiten, Einfluss auf die Politik zu nehmen, gibt es viele. Am meisten Druck übt die Christian Right innerhalb der republi-kanischen Partei aus, deshalb soll auf diese Gruppe näher eingegangen werden.
Die Beziehung zwischen der republikanischen Partei und der in den 1920ern gegründeten Christian Right gleicht oberflächlich einer Symbiose. Beide benötigen einander zum gegenseitigen Vorteil. Sie verlieren durch das beidseitige Abhängigkeitsverhältnis jedoch einen Teil ihrer Autonomie und sind bezüglich verschiedener Inhalte häufig uneinig[20]. Die Mitglieder haben eine konservativere Einstellung gegenüber persönlichen sowie sozialen Rechten und vertreten die überzeugte Einstellung Pro-Familie. Ziel der nationalen Organisation, die häufig auch lokale Themen anspricht, ist ein klarer Lobbyismus. Anhänger sollen in republikanische Entscheidungspositionen befördert werden. Besonders in den Südstaaten ist das auf lokaler und staatlicher Ebene bereits gelungen Die Mitglieder unterstützen dabei auch Kampagnen der GOP und ihrer Kandidaten, finanziell und mit aktiven Taten. Zudem sieht die Christian Right ihre Aufgabe in der Stärkung und Verbreitung christlicher Werte. Das Böse, das zum Beispiel im Liberalismus der mainline Protestanten, im säkularen Humanismus und der sexuellen Revolution der sechziger Jahre gesehen wurde, wird bekämpft. Die Mitglieder, die größtenteils fundamentalistische evangelikale Protestanten sind, organisieren sich dafür in verschiedenen Interessengruppen. Dazu gehören die Christian Coalition, die Moral Majority, die Christian Voice und der Family Research Council. Die größte Macht besitzt ohne Zweifel die 1989 von Pat Robertson ins Leben gerufene Christian Coalition. Robertson, der ebenfalls das Christian Broadcasting Network (CBN) gründete, einen der größten religiösen Fernsehsender der Welt, errichtete „a national grassroots citiziens action organization to counter what Robertson called the anti-Christian bias in many areas of American life“[21]. Die Vereinigung, die 1997 1,7 Millionen Anhänger zählte, konzentriert ihre Anstrengungen zunächst nur auf Landkreise, um von dort die Politik der republikanischen Partei zu beeinflussen. Mitglieder versuchen in republikanische Komitees vorzustoßen und möglicht viele wichtige Positionen innerhalb der GOP zu besetzen[22]. Mit diesem Vorgehen, das der streng konservativen Christian Coalition immer mehr Macht sichert, höhlt sie die republikanische Partei in gewisser Weise von innen aus. Auf die Unterstützung ihrer Sympathisanten können sie bei Wahlen zählen, denn die sind sehr loyal. Zwar sinkt der Einfluss der Organisation seit dem Abschied des früheren Leiters Ralph Reed 1997, allerdings bleibt die Christian Coalition eines der besten Beispiele für eine politische Einflussnahme durch Christen[23].
Wegen des Einflusses, den die Mitglieder der Christian Right bereits in der US-Politik erwirkten und ihrer Unterstützung in Wahlkämpfen sowie bei der Durchsetzung verschiedener Inhalte im Kongress muss diese Gruppe besonders bei der Festlegung der Kampagnen-Themen berücksichtigt werden. Außerdem hinterlassen deren Meinungen bezüglich der zu wählenden Partei einen tiefen Eindruck bei der religiösen Bevölkerung. Auf diese Abhängigkeiten müssen die Präsidentschaftskandidaten Rücksicht nehmen. Allerdings sagen Kritiker, müsse beachtet werden, dass die Christian Right nur eine Minderheit der konservativen Christen als Mitglieder hat, die wiederum auch nur einen geringen Anteil an der Gesamtbevölkerung darstellen[24].
2.3 Die amerikanische Zivilreligion
In den gläubigen USA findet Religion nicht nur in den Kirchen statt. Wie eben beschrieben werden christliche Weltanschauungen auch aus den Gotteshäusern in den Kongress hineingetragen. Neben der Vielfalt der Glaubensgemeinschaften, die diese Werte liefern, gibt es jedoch auch ein Phänomen, dessen Name zuerst bei Jean-Jacques Rousseau 1762 im Contrat Social fiel: Die Zivilreligion[25].
Robert N. Bellah, der diesen Begriff 1967 von dem französischen Philosoph aufgriff, bezeichnet damit religiöse Symbole und Rituale, vorwiegend aus dem Alten Testament, die in Ansprachen und vor allem Inaugurationsreden der Präsidenten auf die Politik und Öffentlichkeit übertragen werden. „Behind the civil religion at every point lie biblical archetypes: Exodus, Chosen People, Promised Land, New Jerusalem, and Sacrificial Death and Rebirth”[26]. Präsidenten setzen demnach die amerikanische Bevölkerung gern mit der biblischen Metapher der auserwählten Menschen Israels gleich, denen der Weg in das gelobte Land, die USA, offenbart wurde[27]. Diese biblische Rhetorik kann als Code interpretiert werden. Vor allem Zitate oder Textstellen aus Kirchenliedern erkennen nur streng Gläubige, die somit in besonderer Weise angesprochen werden. Die durch die Gründervater und ersten Präsidenten geprägte Zivilreligion hat zudem ihre eigenen Propheten und Märtyrer wie Abraham Lincoln, der sogar mit Jesus gleichgesetzt wurde und bis heute an mehreren Memorials verehrt wird. Heilige Feiertage stellen neben dem vierten Juli und dem Veterans Day besonders der Thanksgiving Day und Memorial Day dar.
Damit bildet die Zivilreligion - trotz der Separation von Staat und Kirche - aus Politik und Religion eine Einheit zu unterschiedlichen Zwecken. Zum einen liefert sie der Bevölkerung des Melting Pots ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, eine gemeinsame Identität. Der in der öffentlichen Rhetorik der Zivilreligion genannte Gott spricht alle Amerikaner an, unabhängig von ihrer Denomination. Dennoch sind jüdisch-christliche Motive und Bilder in Reden vorherrschend[28]. Zum anderen stärkt die Zivilreligion, die nicht als Ersatz für das Christentums verstanden werden soll, die Loyalität und Akzeptanz der Bürger gegenüber Handlungen des Staates. Präsidenten sprechen häufig von einer Mission, die es zu erfüllen gilt, denn damit dienten sie einem höheren Zwecke[29]. Sozialwissenschafter sprechen hier von Legitimation oder priesterlichen Aspekten[30]. Zudem ermöglicht es die Zivilreligion, dass Sprecher durch den Gebrauch von religiösen Metaphern nationale Geschehnisse verdeutlichen und interpretieren können[31]. Neben diesen Funktionen, die Politiker zu ihrem Vorteil nutzen, muss sich auch der Staat nach den durch Zivilreligion vorgegebenen Standards richten. Denn die Taten einer Nation „under God“ werden von Bürgerinnen und Bürgern nach höheren moralischen Gesetzen bewertet.
3. Wahlkampfstrategien
Neun von zehn US-Amerikanern sind der Meinung, dass der Präsident einen starken religiösen Glauben haben sollte[32]. Deshalb ist das Gespräch über die eigene Religiosität ein fester Bestandteil einer Wahlkampagne. Dabei ist nicht nur die Art des Glaubens bedeutend für eine Nominierung und einen erfolgreichen Wahlkampf, sondern auch die Übereinstimmung zwischen der Religion eines Kandidaten und seinen politischen Überzeugungen. Dieses Kapitel soll zeigen, welche religiösen Einstellungen George W. Bush und John F. Kerry vertreten und wie sie diese der Öffentlichkeit in Wahlreden und verschiedenen Handlungen präsentieren. Dabei wird besonders auf Elemente der amerikanischen Zivilreligion und andere biblische Rhetorik eingegangen, die benutzt werden, um religiöse Wähler anzusprechen. Abschließend folgt ein Test: Agieren Bush und Kerry entsprechend den Richtlinien ihres Glaubens oder bilden sich Widersprüche, die Wählerinnen und Wähler verwirren?
3.1 George W. Bush
3.1.1 Religiöse Einstellung und Rhetorik
Der Präsident ist gläubig. Daran besteht kein Zweifel. Zu Gott verbindet ihn ein besonderes Erlebnis, das auch in seiner Autobiographie „A Charge to Keep: My Journey to the White House“ beschrieben wird. 1985 verbrachte der ehemalige Alkoholiker und starke Raucher ein Wochenende mit Billy Graham, dem mächtigen Prediger einer Evangelisationsbewegung und langjährigen Freund der Familie Bush. Inspiriert durch dessen Einfluss widmete Bush ab diesem Zeitpunkt sein Leben Jesus Christus. Diszipliniert verfolgt er seine Arbeit, liest sorgfältig die Bibel, geht früh zu Bett, meidet den Alkohol und glaubt fest an Gottes Führung. Wie jeder Präsident seit Jimmy Carter bezeichnet auch er sich als einen wiedergeborenen Christen, der seine Taten nach dem christlichen Glauben ausrichten will. Doch wenn es darum geht, ihn einer bestimmten Kirche zuzuordnen, wird es schwierig. Zwar spricht Bush häufig über Gott, aber über seine eigene Religion nennt er keine Details. Einige meinen, Bush wäre ein konservativer evangelikaler Protestanten. Doch tatsächlich hat er nie bestätigt, dass er dieser Gruppe angehöre[33]. Deshalb ist einer anderen Auffassung, er sei ein Mitglied der United Methodist Church, Folge zu leisten.
Bush spricht in seinen Reden häufiger und offener über Religion als die meisten seiner Vorgänger. Dabei fällt auf, dass er in seinen Mitteilungen häufig den Eindruck erweckt, als wisse er, was Gott beabsichtige[34]. Wird Bushs religiöse Rhetorik genau untersucht, treten verschiedene Zwecke auf, zu denen er biblische Metaphern einsetzt. Zum einen bleibt er dem zivilreligiösen Vorsatz treu und nennt keinen bestimmten Gott. Nur so kann er Christen, Juden und Moslems gleichermaßen ansprechen, ohne eine Denomination zu benachteiligen. Denn der Präsident versucht, sein konfessionsübergreifendes Wählerbündnis zu ver-größern. Mit der Aussage, dass Moslems den selben Gott wie Christen verehren, verärgerte er jedoch die Evangelikalen[35].. Zudem verwendet der Präsident religiöse Inhalte zur literarischen Unterstützung und Vereinfachung seiner Aussagen. In seiner ersten Inaugurationsrede benutzte er die Allegorie des guten Samariters, um eine Rücksichtsnahme auf die schwache Bevölkerung auszudrücken[36]. Als Samariter fungiert hier die GOP unter seiner Führung. Das Prinzip der Zivilreligion ist klar erkennbar: Eine christliche Geschichte wird auf die säkulare Politik übertragen. Auch die Berufung auf Psalme oder Textstellen aus Kirchenliedern ist beliebt bei Bush und seinem Redenschreiber Mike Gerson, einem evangelikalen Christen. Raffiniert baut dieser die biblischen Inhalte ein, die meist nur streng Gläubige entschlüsseln können. Für weltlich orientierte Wähler sind die christlichen Elemente auf den ersten Blick unsichtbar. So kann Bush vor allem Evangelikale ansprechen und ihnen seine Religiosität vermitteln, ohne jedoch weniger Gläubige oder Säkulare abzuschrecken. Diese Metaphorik ist üblich in der öffentlichen Rhetorik der USA. Bereits 1630 nutzte John Winthrops die bildhafte Beschreibung einer „city on the hill“. Daneben verwendet der 43. US-Präsident die Bibel, um seine auf den Glauben basierende Politik zu legitimieren. Dieses Vorgehen ist problematisch, da er so die Trennung zwischen Staat und Kirche verletzt. Deshalb argumentiert Bush nur vorsichtig mit religiösen Elementen. Außerdem weiß er, dass diese nur bei einigen Evangelikalen glaubhaft wirken. Moderate Gläubige verlangen nach greifbaren, beweisbaren Begründungen. So argumentiert Bush zum Beispiel nicht, dass eine homosexuelle Ehe gegen den Willen Gottes sei, sondern das diese die grundlegende Institution der Familie abschwächen würde[37].
Zusammenfassend ist zu sagen, dass auch wenn sich viele Amerikaner über die ständige Verwendung religiöser Symbole in den Reden des Präsidenten beschweren, George W. Bush dabei noch im Durchschnitt liegt. Er nutzt die christliche Rhetorik aus zivilreligiösen Elementen nicht viel mehr als frühere Präsidenten. Bill Clinton hat in seinen Reden sogar häufiger den Namen Jesus genannt als sein republikanischer Nachfolger[38].
Neben Wahlreden hat ein Präsidentschaftskandidat die Möglichkeit, Gläubige durch aktive Taten von seinen Absichten zu überzeugen. Neben Besuchen in Kirchen und bei Glaubensgemeinschaften sind auch ein Treffen mit dem Papst oder der Empfang Geistlicher im Weißen Haus von besonderer Bedeutung. Ansonsten gilt: Vorbild sein. George W. Bush geht jeden Sonntag zur Kirche. Er betet regelmäßig und fragt Gott um Rat. Gläubige US-Amerikaner erwarten das von ihrem Präsidenten und der weiß das. Bush nutzt so dieses Mittel, um für Wählerinnen und Wähler eine starke Identifikationsfigur darzustellen.
3.1.2 Position zu den „Moral Values“
Religion und moralische Werte hängen eng zusammen. Die Moral, also das sittliche Empfinden eines Einzelnen, entsteht durch Emotionen und kulturelle Einflüsse. Beide Faktoren werden unter anderem durch die religiöse Umgebung einer Person geprägt. Demnach müsste sich George W. Bushs Einstellung zu moralischen Werten, die in der Kampagne 2004 mit knappem Vorsprung wahlentscheidend waren, größtenteils mit seiner eigenen Religiosität decken, um ihn glaubwürdig erscheinen zu lassen. Das gilt es, zu untersuchen.
Schwerpunkte der „Moral Values“ waren die Einstellungen gegenüber der gleichgeschlechtlichen Ehe, Abtreibungen und der Stammzellenforschung. George W. Bush lehnt die Gleichstellung einer homosexuellen Ehe mit der heterosexuellen konsequent ab. Im Februar 2004 rief er sogar zur einer Nachbesserung des von Bill Clinton erlassenen „Defense of Marriage Act“ auf, um die weitere Herausgabe von Ehelizenzen von Stadtbeamten an Homosexuelle zu unterbinden[39]. Auch Abtreibungen steht der zweifache Vater kritisch gegenüber. Außer in Fällen von Vergewaltigungen, Inzest oder Lebensgefahr der Mutter weist er diese Methode ab. Als Legitimation zieht er die Unabhängigkeitserklärung heran, nach der alle Menschen das Recht auf Leben haben. Er unterzeichnete 2003 „Partial-Birth Abortion Ban Act“, der die Recht werdender Mütter weiter einschränkte. Ziel ist es, „to build a culture of life“[40]. Die katholische Terminologie von der Kultur des Lebens wird bewusst genutzt, um die Wähler dieser Glaubensrichtung anzusprechen. Stammzellenforschung wird als dritter Punkt ebenfalls von Bush zurückgewiesen, auch wenn damit Krankheiten wie Alzheimer bekämpft werden könnten. Zwar förderte er die Forschung, aber er setzte gleichzeitig starke Restriktionen ein, die eine effiziente Prüfung nicht zuließen. Damit ist er im Gegensatz zu seinem Herausforderer in Einklang mit dem Vatikan.
Mit diesem Vorgehen handelt Bush im Sinne evangelikaler und andere traditioneller Gläubiger. Moderate und liberale Gläubige stößt er ab. Dabei sind sogar die Richtlinien der United Methodist Church weniger streng. Zum Beispiel lehnt diese eine Abtreibung nur ab, wenn sie als eine Art Geburtenkontrolle zur Bestimmung des Geschlechts genutzt wird. Auch die Rechte Homosexueller bezüglich des Militärs sieht die Kirche weniger streng. Bush will nicht, dass diese dem Militär dienen. Seine Kirche befürwortet das jedoch. An oberster Stelle der Unstimmigkeiten zwischen der Religion des Präsidenten und seiner Politik steht aber der Irakkrieg. Die Kirchenmitglieder wurden bereits dazu aufgefordert, den Krieg öffentlich abzulehnen und Bush so zu überzeugen, den Konflikt mit friedlichen Mittel zu lösen[41].
Bushs Auseinandersetzungen mit seiner Kirche sind aber von geringer Bedeutung. Seine Position gegenüber den „Moral Values“ festigt seine Stellung bei traditionellen Gläubigen, die konservative gesellschaftliche Ansichten vertreten. Dazu entspricht seine Politik den Vorstellungen der Christian Right.
3.2 John F. Kerry
3.2.1 Religiöse Einstellung und Rhetorik
In den Anfängen der Kampagne 2004 kommunizierte Kerry immer wieder: Meine Frau und ich sind gläubige praktizierende Katholiken, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Weitere Informationen zu seinem Glauben gab der erste katholische Präsidentschaftskandidat seit John F. Kennedy jedoch nicht preis. Statt Fragen über seinen Glauben zu beantworten, kritisierte er eifrig seinen Herausforderer, der die Grenzen zwischen Staat und Religion verwische „I don’t wear my religion on my sleeve”[42], sagte er auf dem National Convention der Demokraten. Stattdessen spricht Kerry von Werten, die durch seinen Glaube und Gerechtig-keitssinn geprägt wurden. Religion sieht der frühere Messdiener aus New England als Privatsache an. Sein Vize-Präsidentschaftskandidat John Edwards ist da offener. Der Anhänger der Methodist Church spricht häufiger und überzeugender über seinen Glauben. Doch im Verlauf der Kampagne wuchs der Druck auf Kerry, religiöse Wähler zu erreichen. Prognosen offenbarten den Demokraten: Je häufiger Kirchenbesuche, desto wahrscheinlicher eine Stimme für Bush. Kerry zog die Konsequenzen und richtete seinen Wahlkampf spiritueller aus, um mehr Gläubige - von den katholischen Lateinamerikanern in New Mexico bis zu den evangelikalen Christen in Ohio - zu erreichen. Der Senator aus Massachusetts spricht nun freier und offener über Gott[43]. Genau wie sein Konkurrent nutzt er biblische Zitate, um seine Argumente zu verstärken. Im Oktober zitierte er in einer Baptistenkirche in Ohio aus dem Buch des Jakobus und klagt den Präsidenten gleichzeitig an, den leidenden Menschen im Sudan nicht zu helfen. „Words without deeds are meaningless - especially when people are dying every day”[44], sagte Kerry, der in seiner Jugend laut eigenen Angaben über eine Laufbahn als Priester nachdachte.
Ein Vergleich zu Bushs Ansprachen ist jedoch kaum möglich. Das betrifft sowohl die religiösen Inhalte der Reden als auch Elemente der amerikanischen Zivilreligion, die Kerry weniger und mit geringerer Leidenschaft gebrauchte. Damit hinterließ er einen wenig überzeugenden Eindruck auf die Wähler. Umfragen zeigten, dass die amerikanische Bevölkerung den Präsidenten viel religiöser einstuft als den Senator. Viele wissen zudem gar nicht, dass Kerry überhaupt katholisch ist.
3.2.2 Position zu den „Moral Values“
Kerrys Einstellung zu den moralischen Werten ist schnell beschrieben. Grundsätzlich hat er zu den Punkten homosexuelle Ehe, Abtreibung und Stammzellenforschung eine andere Einstellung als die katholische Kirche. Einer homosexuellen Ehe steht der Demokrat tolerant gegenüber, zum Missfallen Roms. Im August 2003 hatte sich Kerry bereits gegen die Forderung des Vatikans gestellt, katholische Politiker hätten die moralische Pflicht, gegen die gleichgeschlechtliche Ehe zu stimmen. Das Thema Abtreibung, das den Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten schärfer darstellt als jedes andere Problem, verkörpert Kerry in demokratischer Tradition. Er plädiert für das Recht der Frau, abtreiben zu dürfen. Zudem unterstützt der Ehemann von Theresa Heinz Kerry die Forschung mit Stammzellen, da er die medizinische Notwendigkeit Parkinson oder Alzheimer zu heilen höher stellt als ethische Bedenken.
Katholiken: Kerry fehlt die Mehrheit. Katholiken sind wichtige Wechselwähler, werden in letzten Tagen nochmals beworben (Faith increasingly...)
1. Woran glauben sie selbst? Wie leben sie ihren Glauben aus? Besondere Erlebnisse mit der Religion? (3.1, 3.2) 2. Welchen Metaphern und Handlungen nutzen sie? Welche Unterschiede ergeben sich? Zivilreligiöse Elemente? 3. Wie ist ihre Position gegenüber Wahlthemen? Entspricht das den Richtlinien ihres Glaubens? 4. Wer spricht welche Religion an? Wie berücksichtigen sie die religiöse Rechte? 5. Realignment reinbauen?
[...]
[1] Vgl.: Vorländer, Hans (2004): Politische Kultur, in: Länderbericht USA. S. 300.
[2] Vgl.: USA: Geschichte, Wirtschaft, Gesellschaft. Informationen zur politischen Bildung 268. S. 74.
[3] Brinkbäumer, Klaus et al (2004): Die rechte Revolution, in: Der Spiegel Nr. 46. S. 130.
[4] Braml, Josef (2005): Die theo-konservative Politik Amerikas, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 7/2005. S. 31.
[5] Vgl.: Ebd. S. 30.
[6] Vgl.: Ebd. S. 30.
[7] Vgl.: Schneider, Peter (2004): Ein Bush, der Berge versetzt, in: Der Spiegel 44/2004. S. 172.
[8] Vgl.: Queen II, Edward L. et al. (2001): Encyclopedia of American Religious History. Volume I. S. 238.
[9] Vgl.: The triumph of the religious right, in: Economist.com 11.11.2004. Abruf: 22.02.2005.
[10] Vgl.: Queen II, Edward L. et al. (2001): a.a.O. Volume II. S. 414.
[11] Vgl.: Queen II, Edward L. et al. (2001): a.a.O. Volume I. S. 14.
[12] Vgl.: Braml, Josef (2005): a.a.O. S. 30.
[13] Vgl.: Busse, Nikolas (2004): Wo es mehr Kirchen als „Shopping Malls“ gibt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 26.10.2004 OEC!!
[14] Göller, Josef-Thomas (2004): Go down, Moses - Evangelisten machen mobil für Bush, in: Das Parlament Nr. 44, 25.10.2004. S. 3.
[15] Queen II, Edward L. et al. (2001): a.a.O. Volume II. S. 619.
[16] Vgl.: The triumph of the religious right, in: Economist.com 11.11.2004. Abruf: 22.02.2005
[17] Vgl.: Kleine, Thomas (2004): Ihr Schäflein, wählet mich“, in: Die Zeit Nr. 40, 23.09.2004. S. 12, 13.
[18] Vgl.: Kleine, Thomas (2004): a.a.O. S. 12, 13.
[19] Vgl.: The triumph of the religious right, in: Economist.com 11.11.2004. Abruf: 22.02.2005.
[20] Vgl.: Djube, Paul/ Olson, Laura (2003): Encyclopedia of American Religion and Politics. S. 93.
[21] Schultz, Jeffrey D./ West Jr., John G./ Maclean, Iain (1999): Encyclopedia of Religion in American Politics. S. 48.
[22] Vgl.: Ebd. S. 48.
[23] Vgl.: Djube, Paul/ Olson, Laura (2003): a.a.O. S. 91.
[24] Vgl.: Queen II, Edward L. et al. (2001): a.a.O. Volume I. S. 125.
[25] Vgl.: Lübbe, Hermann (1981): Staat und Zivilreligion. S. 6.
[26] Bellah, Robert N. (1967): Religion in America, in: Daedalus, Winter 1967, Vol. 96, No. 1, S. 1-21. S. ???
[27] Clinton sagte in seiner „Inaugural Address“ am 20.01.1999: „Guided by the ancient vision of a promised land, let us set our sights upon a land of new promise.”
[28] Vgl.: Vorländer, Hans (2004): Politische Kultur, in: Länderbericht USA. S. 291-292.
[29] Bush legitimierte sein Vorgehen gegen autoritäre Regimes beim National Convention der Republikaner 2004 folgendermaßen: “I believe all these things because freedom is not America's gift to the world, it is the almighty God's gift to every man and woman in this world.”
[30] Vgl.: Wald, Kenneth D.: (1997): Religion and Politics in the United States. S. 63.
[31] Vgl.: Vorländer, Hans (2004): a.a.O. S. 291.
[32] Vgl.: The triumph of the religious right, in: Economist.com 11.11.2004. Abruf: 22.02.2005.
[33] Vgl.: Johnson, Alex (2004): For Bush, a hunt for the right voters, in: MSNBC.com 26.10.2004. Abruf: 20.01.2005.
[34] Vgl.: Ebd.
[35] Vgl.: A hot line to heaven, in: Economist.com 16.12.2004. Abruf: 01.03.2005.
[36] Bush sagte: „When we see that wounded traveller on the road to Jericho, we will not pass to the other side.“
[37] Vgl.: A hot line to heaven, in: Economist.com 16.12.2004. Abruf: 01.03.2005.
[38] Vgl.: Ebd.
[39] Vgl.: President Calls for Constitutional Amendment Protecting Marriage 24.02.2004, nach http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/02/20040224-2.html. Abruf: 05.03.2005.
[40] Vgl.: National Sanctity of Human Life Day 16.01.2004, nach http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040116-2.html. Abruf: 05.03.2005.
[41] Vgl.: Johnson, Alex (2004): John Kerry - man in the middle, in: MSNBC.com 26.10.2004. Abruf: 20.01.2005.
[42] Ebd.
[43] Vgl.: Vandehei, Jim (2004): Faith Increasingly Part of Kerry’s Campaign, in: washingtonpost.com 18.10.2004. Abruf: 01.03.2005.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einleitung des Textes?
Die Einleitung befasst sich mit der Allgegenwärtigkeit des Glaubens in den USA und stellt fest, dass die USA religiöser sind als die meisten europäischen Staaten. Sie hinterfragt die Säkularisierungsthese und betont die Bedeutung religiöser Wählergruppen für die Politik, insbesondere bei Präsidentschaftswahlen. Ziel der Arbeit ist es, die religiösen Inhalte und Moralvorstellungen von George W. Bush und John F. Kerry bei der Präsidentschaftswahl 2004 zu analysieren.
Welche religiösen Glaubensgemeinschaften werden in dem Text behandelt?
Der Text gibt einen Überblick über verschiedene Denominationen in den USA, darunter Protestantismus (insbesondere Evangelikale und Mainline-Protestanten), Katholizismus und afroamerikanische Protestanten. Er erörtert auch die politische Ausrichtung dieser Gruppen.
Welchen Einfluss haben religiöse Gruppen auf die Politik in den USA?
Der Text beschreibt, wie religiöse Gruppen, insbesondere die Christian Right, Einfluss auf die Politik ausüben. Obwohl Staat und Religion getrennt sind, befürwortet ein wachsender Teil der Bevölkerung einen Einfluss der Kirchen auf die Politik. Die Christian Right übt insbesondere innerhalb der Republikanischen Partei Druck aus.
Was ist die amerikanische Zivilreligion?
Der Text erklärt das Konzept der amerikanischen Zivilreligion, definiert von Robert N. Bellah, als die Übertragung religiöser Symbole und Rituale auf Politik und Öffentlichkeit. Es wird auf biblische Archetypen wie Exodus und das gelobte Land Bezug genommen. Die Zivilreligion dient dazu, Zusammengehörigkeit zu stiften, die Loyalität zum Staat zu stärken und nationale Ereignisse zu interpretieren.
Wie präsentierten George W. Bush und John F. Kerry ihre Religiosität im Wahlkampf 2004?
Der Text untersucht die religiösen Einstellungen und Rhetoriken von George W. Bush und John F. Kerry während des Wahlkampfs 2004. Bush wird als gläubiger Christ dargestellt, der häufig religiöse Metaphern verwendet und sich auf seine Erfahrungen mit Billy Graham beruft. Kerry hingegen legte seinen Fokus zunächst weniger auf seine Religiosität und betonte stattdessen seine Werte.
Wie positionierten sich Bush und Kerry zu den "Moral Values" (Moralischen Werten)?
Der Text beschreibt die Positionen von Bush und Kerry zu den moralischen Werten, einschließlich der gleichgeschlechtlichen Ehe, Abtreibung und Stammzellenforschung. Bush lehnte die gleichgeschlechtliche Ehe und Abtreibung ab und setzte Restriktionen für die Stammzellenforschung ein. Kerry war toleranter gegenüber der gleichgeschlechtlichen Ehe, befürwortete das Recht auf Abtreibung und unterstützte die Forschung mit Stammzellen.
Gibt es Widersprüche zwischen Bushs oder Kerrys Religion und ihrer Politik?
Der Text deutet an, dass es gewisse Widersprüche zwischen Bushs Politik und den Richtlinien seiner Kirche gibt, insbesondere im Hinblick auf den Irakkrieg. Kerrys Positionen zu bestimmten moralischen Werten standen im Gegensatz zu den Lehren der katholischen Kirche.
Welche Rolle spielten religiöse Wähler bei der Wahl 2004?
Der Text betont die Bedeutung religiöser Wähler für die Politik, insbesondere Evangelikale, die eher republikanisch wählen. Kandidaten passen ihre Wahlkampagnen an, um diese Wählergruppen anzusprechen.
- Quote paper
- Carina Troll (Author), 2004, Religion und Wahlen in den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110363