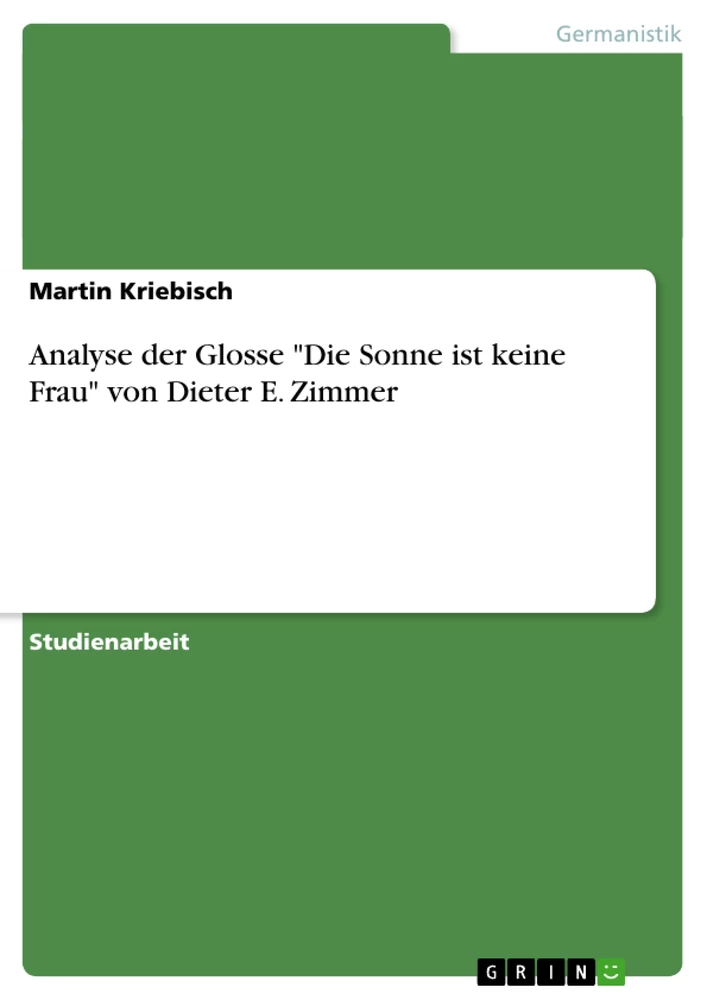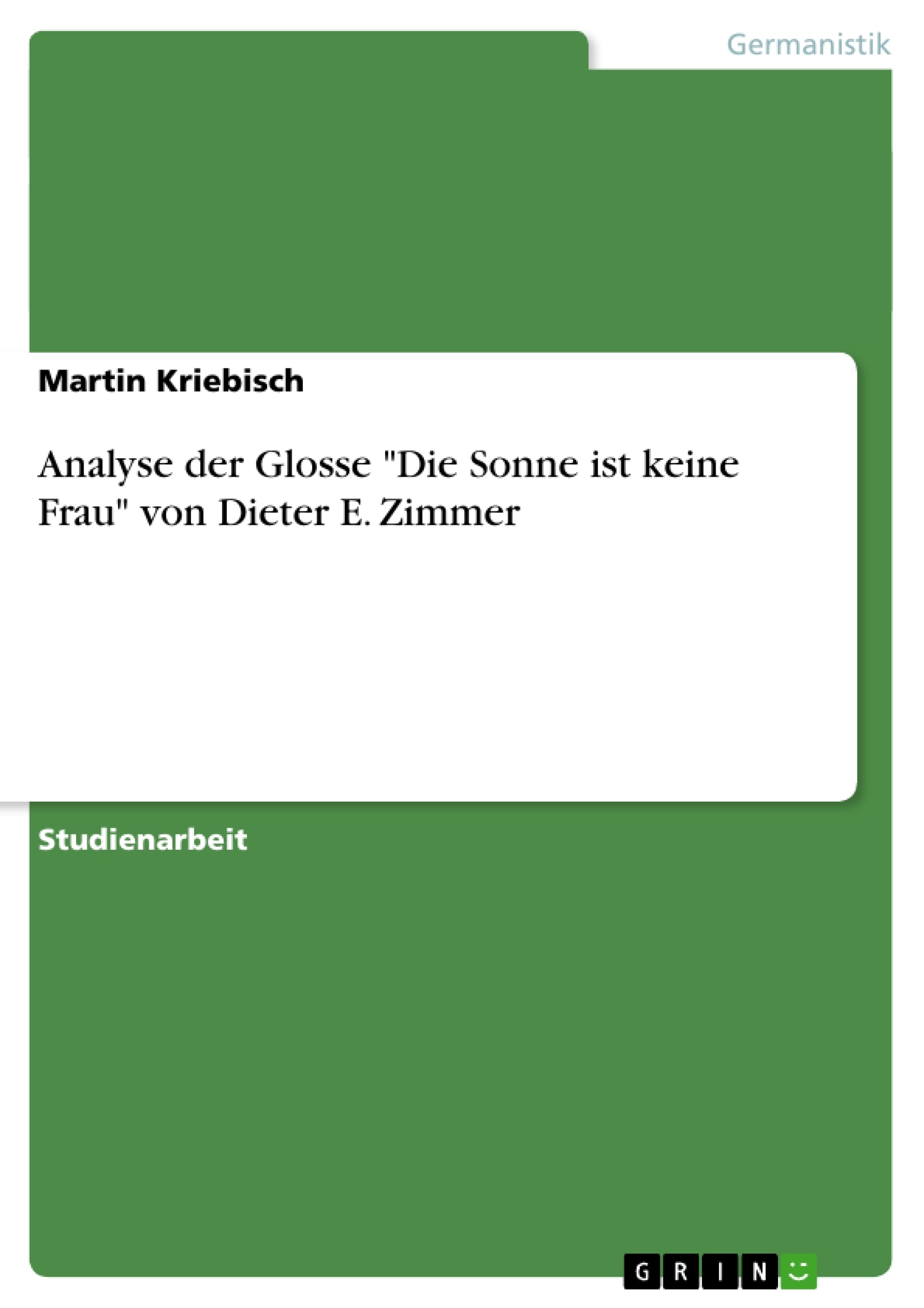Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Sprache selbst zum Schlachtfeld ideologischer Auseinandersetzungen wird. In dieser messerscharfen Analyse entlarvt Dieter E. Zimmer die vermeintliche Notwendigkeit der Feminisierung der deutschen Sprache durch Paarformen und präsentiert ein ebenso geistreiches wie provokantes Plädoyer für sprachliche Klarheit und historischen Respekt. Anhand pointierter Beispiele, von sperrigen Gesetzestexten bis hin zu Schiller'schen Klassikern, demonstriert Zimmer die Absurdität und kontraproduktive Wirkung einer zwanghaften sprachlichen Gleichmacherei. Er argumentiert, dass die Einführung von Paarformen nicht nur zu umständlichen und schwer verständlichen Texten führt, sondern auch die subtilen Nuancen und die ästhetische Kraft unserer Sprache untergräbt. Zimmer scheut sich nicht, die vermeintlichen Fortschritte der sprachlichen Gleichstellung kritisch zu hinterfragen und deckt dabei die ideologischen Fallstricke auf, die hinter der vermeintlichen Notwendigkeit einer solchen Reform lauern. Mit satirischer Schärfe und sprachlichem Feingefühl seziert er die Argumente der Befürworter und entlarvt die darin verborgenen Widersprüche. Diese Glosse ist mehr als nur eine sprachkritische Analyse; sie ist ein Aufruf zur Besinnung auf die Werte der Klarheit, Präzision und historischen Kontinuität in einer Zeit, in der die Sprache allzu oft zum Instrument politischer Agitation verkommt. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine intellektuelle Reise, die zum Nachdenken anregt und die eigene Sprachsensibilität schärft. Es geht um die Frage, ob wir bereit sind, die Schönheit und Eleganz unserer Sprache auf dem Altar ideologischer Reinheit zu opfern. Die Analyse ist relevant für Sprachwissenschaftler, Germanistik-Studierende, Journalisten, politische Entscheidungsträger und alle, die sich für die Entwicklung der deutschen Sprache und die damit verbundenen gesellschaftlichen Auswirkungen interessieren. Es ist eine Einladung, über den tieferen Sinn und Zweck von Sprache nachzudenken und sich der Verantwortung bewusst zu werden, die wir alle für den Erhalt ihrer Vielfalt und Ausdruckskraft tragen. Tauchen Sie ein in eine Welt sprachlicher Paradoxien und entdecken Sie die unerwarteten Konsequenzen vermeintlich wohlmeinender Sprachreformen.
Analyse der Glosse „ Die Sonne ist keine Frau“ von Dieter E. Zimmer
Der hier vorliegenden Text von Dieter E. Zimmer, welcher den Titel trägt „Die Sonne ist keine Frau“, erschien am 1. April 1994 in der Zeitung „Die Zeit“. Es handelt sich um eine argumentativ aufgebaute Glosse, welche anlässlich der Einführung von Paarformen in der deutschen Schriftsprache verfasst wurde und den Leser von deren Sinnlosigkeit und der die Wirkung verfehlenden Idee, - der Feminisierung der deutschen Sprache - , überzeugen soll.
Zimmer beginnt seine Ausführungen mit dem Zitat eines Auszuges aus dem NRW Gesetz, welches sich mit den Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfahlen befasst.
Danach nimmt Zimmer Bezug auf die Tatsache, dass die Feminisierung bzw. die Existenz sogenannter Paarformen, noch nie da gewesen seien und die deutsche Menschheit auch noch die ein Problem diesbezüglich feststellen konnte, da es ja das grammatikalische – und das natürliche Geschlecht gäbe.
Anschließend weißt Zimmer darauf hin, dass auch historische Texte im Falle einer generellen Angleichung der Sprache durch Paarformen verändert werden müssten. Infolge dessen ginge deren Wirkung verloren.
Abschließend verweißt der Autor auf ein Fallbeispiel aus der Schweiz, welches beschreibt, wie die Ortschaft Wädenswil nach einer Angleichung ihrer Verafassung, diese wieder in ihre Ursprungsform korrigieren musste.
Dass es sich bei dem vorliegenden Text um eine Glosse handelt, wird dem Leser sehr schnell deutlich, da es sich hier um eine sehr subjektive, mit Ironie und Sarkasmus angereicherte Auseinandersetzung mit dem thematischen Hintergrund handelt.
Zimmers Position und somit auch seine These stehen fest. Er ist gegen eine Angleichung der Sprache durch feminisierende Paarformen.
Seine Argumente sind die dadurch entstehende Überlänge von Texten und deren damit verbundene Unverständlichkeit, sowie die Tatsache, dass es in der deutschen Sprachgeschichte noch nie eine vergleichbare Problematik gab.
Seine Argumente stützt Zimmer mit Beispielen. Als erstes führt er den NRW-Gesetzestext an, welcher sich mit der Regulierung der Rangordnung, der an universitätsrelevanten Entscheidungen beteiligten Organen, im Lande Nordrhein-Westfahlen beschäftigt (Z.2-12)
Die Absicht dieses Zitates ist, dem Leser zu veranschaulichen, dass ein Text – hier ein Gesetzestext, welcher ohnehin schon ungemein schwer verständlich ist – noch komplizierter und unverständlicher wird.
Sein zweites Argument, welches besagt, die Deutschen seien auch bisher in der Lage gewesen, grammatikalisches – und natürliches Geschlecht voneinander zu trennen ( Z.23f.), stützt er mit dem Beispiel, indem er ein Schillerwerk hinzuzieht
(Z. 33 – 38), welches zusätzlich dazu dient, dem Leser zu zeigen, wie wirkungslos und sachlich, aber nicht mehr künstlerisch Schillers’ „Lied der Glocke“ klingt.
Es folgt nun die Antithese, also die Gegenposition Zimmers’ mit dem Zitat „ eine Benachteiligung von Frouwen [...] kann nicht ausgeschlossen werden.“ Zimmer stimmt hier zunächst zu, wiederlegt diese Antithese jedoch sofort wieder, indem er Bezug nehmend auf sein erstes Beispiel, auf die durch Paarformen resultierende Überlänge von Texten, verweißt.
Zum Schluss nennt Zimmer das seine These unterstützende Beispiel aus der Schweiz, welches beschreibt, wie dort nach nur wenigen Monaten, eine durch Paarformen angeglichene Verfassung wieder rückläufig geändert werden musste, da sie durch Paradoxa inhaltlich nicht mehr stringent war. (Z. 49 – 54)
Dieter Zimmer’s Hauptabsicht, nämlich den Leser von der Sinnlosigkeit und Lächerlichkeit des Phänomens der Paarform zu überzeugen, lässt sich in verschiedene Teilabsichten differenzieren, welche jeweils sprachstilistisch gestützt sind.
So ist die erste Teilabsicht Zimmers’ sicher diejenige, dem Leser die überdimensional erscheinende Länge und die daraus resultierende Unverständlichkeit nahe zu bringen. Es ist natürlich sehr geschickt von Zimmer, einen ohnehin schon lang und mühsam zu lesenden Gesetzestext zu verwenden. Doch dies bestärkt natürlich somit nur die gewünschte Wirkung: Der Text erscheint lang.
Die nächste Teilabsicht, nämlich den Frauen klar zu machen, dass es noch nie ein Problem dargestellt hat, das generische Maskulinum zu verwenden, führt er auf mehrere Arten durch. Zum einen spricht er die Frauen mit dem mittelhochdeutschen Wort „Frouwen“ an ( Z.18) und zieht sie so ins Lächerliche, da diese Bezeichnung früher als leicht spöttisch zu verstehende Anrede des weiblichen Adels gemeint war. Zum anderen beschreibt er die Zeit, in der das generische Maskulinum widerstandslos geduldet wurde und „von Anbeginn der deutschen Sprache währte“ (Z-22) mir dem Wörtchen „nur“(Z.22)
Durch die Verwendung dieser Hyperbel macht er inhaltlich genau das Gegenteilige deutlich; nämlich dass es in der sehr, sehr langen Zeit des Bestehens der deutschen Sprache noch nie ein Problem dargestellt hat, generisch maskulin zu schreiben und zu sprechen.
Des weiteren ist Zimmers’ Sprache von sarkastischen Zügen geprägt. Er stellt die Frauen bloß, um ihnen vor Augen zu führen, welche Dimension das durch sie entstandene Problem nun erreicht habe.
Mit der für Glossen üblichen Ironie und Spott – hier in Z. 32 –34 - womit er seine nächste Teilabsicht einleitet, bringt Zimmer genau das Gegenteil dessen, was er schreibt, zum Ausdruck. Eine Veränderung der historischen Werke, hier am Beispiel Schiller, sei somit nicht als “fortschrittlich“(Z.32), sondern umgekehrt eher als unsinnig und zu verstehen. Ebenso wie die „finsteren Zeiten“ (Z.32), welche die Zeit der Schillerwerke beschreibt und in unseren Augen gerade nicht finster, sondern künstlerisch geprägt und deshalb eher „hell“ waren, ist ein Element der Ironie.
Sarkastisch ist nun wieder der erneute Verweis darauf, dass wir Menschen, genauer gesagt die Frauen, das sprachliche- und das natürliche Geschlecht nicht mehr auseinanderhalten können (Z. 42-44).
Dieter Zimmer’s vorletzte Teilabsicht, den Leser gegen die angleichenden Paarformen zu stimmen, beinhaltet das o.g. Beispiel des schweizerischen Ortes Wädenswil. Durch das Paradoxon „männliche Stadtpräsidentin“ (Z.52) führt er nun passend zum eingesetzten Stilmittel die Widersprüchlichkeit auf, die sich als Konsequenz aus der feminisierten Sprache ergibt.
Dieses Beispiel schildert weiter, wie die Stadtverwaltung Wädenswil ihre sprachliche Neuerung wieder abschaffen musste. Damit warnt Zimmer davor, den gleichen Fehler zu begehen. Er beendet seine Ausführung nun mit der Synthese, welche erneut ironisch zu verstehen ist. Denn genau wie er sagt, „scheuen wir nicht einmal die Lächerlichkeit“ (Z.55). Explizit gesagt, ist es genau das, was wir durch die Angleichung tun – uns lächerlich machen.
In seiner Glosse bringt es Zimmer auf den Punkt. Sicher ist eine Angleichung richtig, sofern sie in Grenzen bleibt. Meiner Meinung nach ist es z.B. richtig, dass jetzt im Gegensatz zu früheren Zeiten, in einem offiziellen Schreiben am zwei Eheleute, beide in der Anrede angesprochen werden. Eine Ignoranz der Frau ist natürlich nicht angebracht. Genauso richtig finde ich es, dass wenigstens einige Berufsbezeichnungen die Frau in Ihrem Geschlecht unterstützen. So ist eine Frau, die den Beruf, der sich nach dem Medizinstudium erstreckt, ergriffen hat, nun eine Ärztin und nicht mehr ein Arzt und kann auch unter ärztlichen Schreiben ihre Unterschrift unter das Feld „behandelnde Ärztin“ setzen. Ebenso ist die Rechtsanwältin nun nicht mehr der Rechtsanwalt. Doch ist es wirklich sinnvoll eine allgemeine Angleichung der Sprache durch Paarformen vorzunehmen? Zimmers Beispiel, welches sich mit dem NRW Gesetz beschäftigt, finde ich am wirkungsvollsten. Solch ein Text wird unverständlich, schwer lesbar und verfehlt die Wirkung, da der Inhalt nicht mehr deutlich wird.
Das Argument, das generische Maskulinum gäbe es schon immer, erscheint mir, trotz seiner Pauschalität und primär zu vermutenden Oberflächlichkeit, am gewichtigsten. Wieso können die Menschen, viel mehr gesagt die Frauen, das grammatikalische Geschlecht nicht mehr vom natürlichen Geschlecht unterscheiden? Muss in einer Zeit der Emanzipation wirklich alles bis heute Gültige angezweifelt und in Frage gestellt werden? Sicher sind einige Änderungen zur Gleichberechtigung der Frau vorzunehmen. So z.B. die o.g. Anrede in offiziellen Schrieben, oder die jetzt in Stellenausschreibungen obligatorische Paarform in der Bezeichnung des Berufsbildes. Eine Ignoranz und Diskriminierung der Frau ist nicht richtig und muss vermieden werden – eine Ignoranz unserer Sprache und Sprachgeschichte – und vor allem unseres gesunden Menschenverstandes jedoch auch.
Von Martin R. Kriebisch
Go 042
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Glosse „Die Sonne ist keine Frau“
Worum geht es in Dieter E. Zimmers Glosse „Die Sonne ist keine Frau“?
Die Glosse, erschienen am 1. April 1994 in der „Die Zeit“, argumentiert gegen die Einführung von Paarformen in der deutschen Schriftsprache zur Feminisierung der Sprache. Zimmer ist der Ansicht, dass dies sinnlos ist und die gewünschte Wirkung verfehlt.
Wie beginnt Zimmer seine Argumentation?
Zimmer beginnt mit dem Zitat eines Auszugs aus dem NRW-Gesetz über Hochschulen, um die Komplexität und Unverständlichkeit von Texten durch Paarformen zu verdeutlichen.
Was ist Zimmers Hauptargument gegen Paarformen?
Zimmer argumentiert, dass die deutsche Sprache bisher gut ohne Paarformen funktioniert hat und die Unterscheidung zwischen grammatikalischem und natürlichem Geschlecht kein Problem darstellte. Er befürchtet eine Überlänge und Unverständlichkeit von Texten.
Welches historische Beispiel führt Zimmer an?
Zimmer bezieht sich auf Schiller, um zu zeigen, wie historische Texte durch die Angleichung der Sprache verändert und ihre Wirkung somit verloren gehen würde.
Welches Beispiel aus der Schweiz bringt Zimmer an?
Zimmer verweist auf die Ortschaft Wädenswil, die ihre Verfassung nach einer Angleichung durch Paarformen wieder in die Ursprungsform korrigieren musste, da sie inhaltlich widersprüchlich wurde.
Wie beschreibt die Analyse Zimmers Schreibstil?
Die Analyse beschreibt Zimmers Stil als subjektiv, ironisch und sarkastisch, typisch für eine Glosse.
Welche Teilabsichten werden Dieter E. Zimmer zugeschrieben?
Zimmer will dem Leser die Länge und Unverständlichkeit verdeutlichen, die Paarformen verursachen, und er will Frauen vermitteln, dass das generische Maskulinum bisher kein Problem dargestellt hat. Er will auch die Leser von der Sinnlosigkeit und Lächerlichkeit der Paarformen überzeugen.
Wie argumentiert Zimmer gegen die Antithese, dass Frauen benachteiligt werden könnten?
Zimmer stimmt zunächst zu, dass eine Benachteiligung nicht ausgeschlossen werden kann, wiederlegt dies aber sofort mit dem Hinweis auf die resultierende Überlänge der Texte.
Wie wird die Wirkung des Paradoxons "männliche Stadtpräsidentin" beschrieben?
Es wird beschrieben, dass Zimmer durch das Paradoxon passend zur Schreibweise die Widersprüchlichkeit aufzeigt, die als Konsequenz aus der feminisierten Sprache resultiert.
Wie wird Zimmers abschließende Synthese interpretiert?
Seine Synthese ist ironisch gemeint. Es ist genau das, was wir durch die Angleichung tun – uns lächerlich machen.
- Quote paper
- Martin Kriebisch (Author), 2006, Analyse der Glosse "Die Sonne ist keine Frau" von Dieter E. Zimmer , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110328