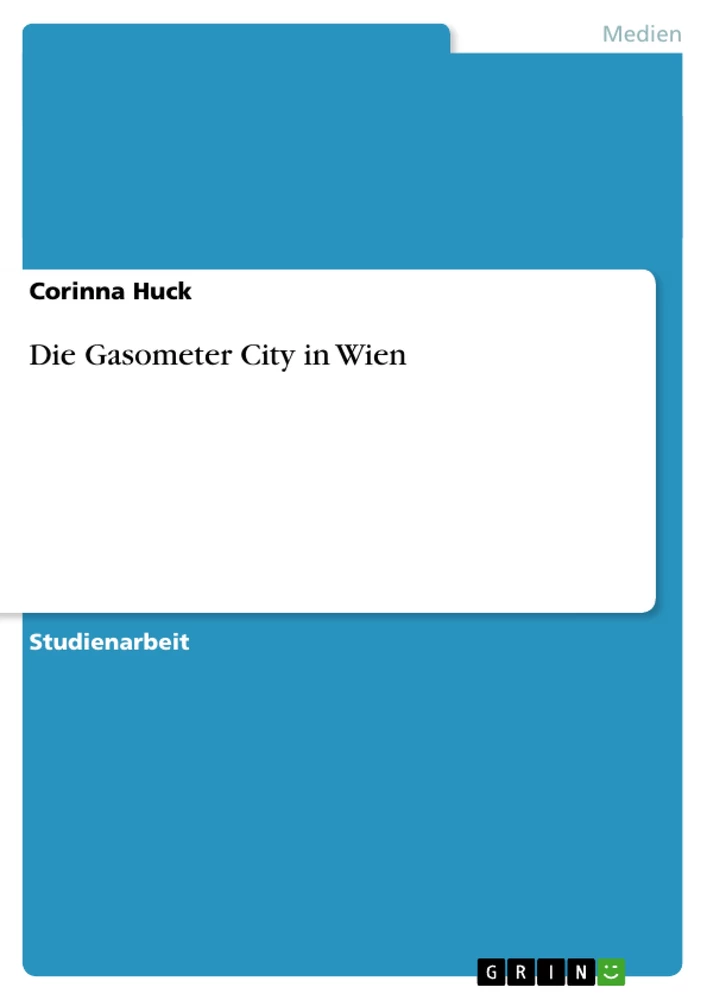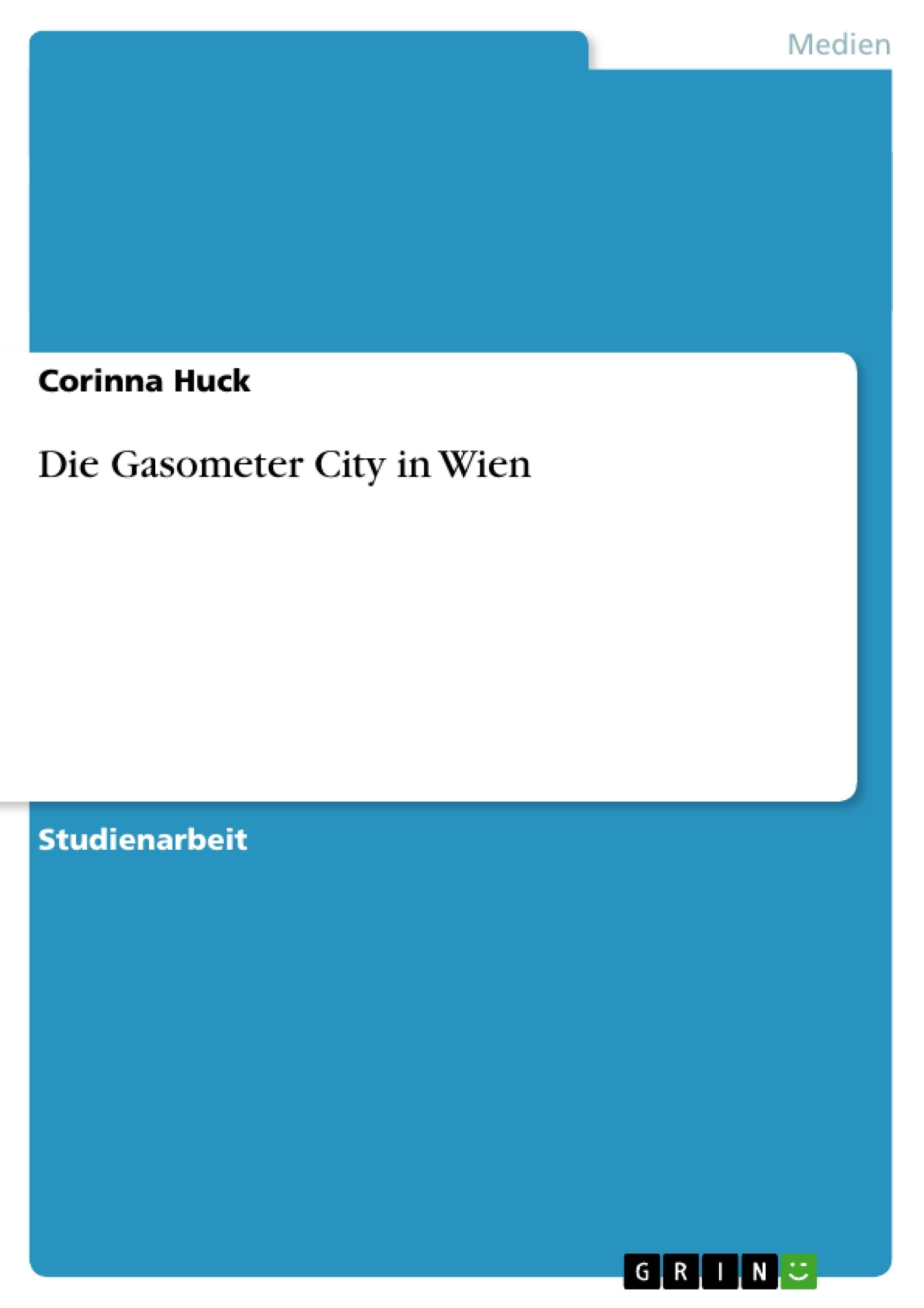Inhaltsverzeichnis:
Einleitung.
Wo ist die Gasometer – City? Was ist das?
Was ist ein Gasometer? Seite 3
Wie funktioniert ein Gasometer? Wie sieht er aus?
Die Entwicklung der Gasnutzung in Wien und die Geschichte
der Gasometer in Simmering.
Wieso überhaupt Revitalisierung? Ist sie gelungen?
Wie sind die Gasometer heute aufgebaut?
Gasometer A.
Gasometer B.
Gasometer C.
Gasometer D.
Schluss und eigener Eindruck
Literaturverzeichnis
Einleitung.
Im Folgenden möchte ich die Gasometer – City in Wien vorstellen.
Ich werde zunächst auf allgemeine Fragen eingehen, mich dann mit der Geschichte und der Entwicklung der Gasometer befassen, um dann die einzelnen Gasometer in ihrer jetzigen revitalisierten Form vorzustellen.
Wo ist die Gasometer – City? Was ist das?
Im 11. Wiener Bezirk, genauer gesagt in Wien – Simmering an der Guglgasse die nördlich der Gebäude verläuft stehen die vier Gasometer die zusammen unter dem Namen „Wiener Gasometer – City“ bekannt sind. Wobei dieser Begriff eigentlich nur die dortige Shopping – Mall bezeichnet, von den Bewohner werden die Wohngebäude schlicht „Gasometer“ genannt. Der Gebäudekomplex ist bequem mit der U – Bahn Linie 3 in wenigen Minuten zu erreichen.
Was ist ein Gasometer?
Der Begriff Gasometer bedeutet zweierlei, zum einen ist ein Gasometer die Messuhr an der Außenseite eines Gasbehälters der die Menge des gespeicherten Gases anzeigt, zum anderen ist es ein Behälter zur Speicherung und kontrollierten Abgabe von Gas.
Wie funktioniert ein Gasometer? Wie sieht er aus?
Im Inneren des Gasbehälters befindet sich eine bewegliche Teleskophülle aus drei Ringen bestehend die oben mit einem Glockendach abschießen. Beim Einströmen von Gas dehnt sich diese, von Schienen an der Innenseite der Außenmauer gehalten, nach oben aus, beim Ausströmen setzt der umgekehrte Vorgang ein. Der so entstehende Lagerraum kann bis zu 90.000m ³ Gas fassen. Unter dieser Konstruktion befindet sich ein Wasserbassin das den Gasaustritt verhindert.
Der Gasometer (im Folgenden GM.) aus Vollziegelmauerwerk hat eine Höhe von 40m, das Dach aus Stahl bringt noch einmal 25 Höhenmeter; unter der Erdaufschüttung reicht der Gasbehälter 12m in die Tiefe. Der GM. umschließt im Inneren einen Kreis von 3096m ² Fläche.
Die Entwicklung der Gasnutzung in Wien und die Geschichte der Gasometer in Simmering.
Bereits zu Beginn des 19. Jh. wurde mit der Herstellung und Nutzung von Gas experimentiert.
So erzeugte bereits 1816 der Apotheker Josef Moser aus Harz ein Gas mit welchem er die Schaufenster seiner Apotheke beleuchtete.
Im gleichen Jahr wurde durch Johann Josef Ritter von Prechtl eine größere Anlage zur Erzeugung von Gas errichtet. Prechtl war Direktor des Polytechnischen Instituts in Wien. Mit dieser Anlage sollten 120 Lampen betrieben werden, außerdem wollte Prechtl die Abwärme zum Betrieb einer Zentralheizung nutzen. Diese Anlage wurde 1818 in Betrieb genommen und 1826 erweitert.
Zahlreiche weitere Schritte wie die erste Gasleitung 1834 in Wien und der gestiegene Bedarf führten 1840 zum Bau eines weiteren Gaswerks.
Der Einstieg der englischen I.C.G.A. (Imperial Continental Gas Association) 1842 und deren Aufkäufe der privaten kleinen Gaswerke führte zu einer Monopolstellung der I.C.G.A auf dem Wiener Gasmarkt. Dies führte dazu, dass am 04. 03.1855 die "Österreichische Gasbeleuchtungs-Aktiengesellschaft" (ÖGA) gegründet wurde um der I.C.G.A. ein Gegengewicht zu setzen. Die ÖGA versorgte mehrere Wiener Vororte wie Fünfhaus, Sechshaus, Rudolfsheim, Gaudenzdorf, Hetzendorf und andere mit Gas.
Nach und nach kam es zu Unstimmigkeiten zwischen Stadt und I.C.G.A., so dass der Plan zu einem kommunalen eigenen Gaswerk reifte. Auch die schlechte Versorgung durch die I.C.G.A. mit Gas aufgrund von Druckschwankungen etc. unterstützte diesen Gedanken.
Die Verträge mit der I.C.G.A. liefen aus und somit stand fast nichts mehr der Verwirklichung eines kommunalen Gaswerks im Wege.
Im Jahr 1893 wurde der Ingenieur Theodor Hartmann als technischer Consulent vom Gemeinderat bestellt. Er sollte die kommende Errichtung eines Gaswerkes ausarbeiten. Im Juli 1894 kaufte die Stadt das Gelände des Bürgerspitals für den Bau eines Gaswerkes. Theodor Hartmann lieferte im Jahr darauf die Detailpläne für ein Wiener städtisches Großgaswerk.
Im Jahr 1896 debattierte man im Gemeinderat lange über den geplanten Neubau oder den Aufkauf der Werke der I.C.G.A.. Mit knapper Stimmehrheit wurde dem Neubau jedoch zugestimmt. Die Leitung des Baues übernahm Franz Kapaun vom Stadtbauamt Wien.
Am 28. Dezember 1896 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau der Gasometer. Im Juli 1899 waren alle vier Behälter einsatzbereit und wurden am 31. Oktober 1899 eingeweiht.
Durch die Fortschritte auf dem Gebiet der Energiegewinnung bzw. Stromerzeugung und die daraus resultierende Umstellung auf Erdgas, welches unterirdisch gelagert wird endet die klassische Gaserzeugung in Simmering ab 1966 schrittweise.
Im Jahr 1981 werden die vier Gasbehälter unter Denkmalschutz gestellt, sind aber noch zum Teil in Betrieb. Ab 1984 werden sie nach und nach „vom Netz genommen“, GM. B ist der erste der außer Betrieb gesetzt wird, die andere drei folgen in den nächsten zwei Jahren.
Das bedeutet aber nicht, dass die GM. in Vergessenheit geraten. GM. B dient in einem James Bond Film als grandiose Kulisse, GM. D wird als Ausstellungsort genutzt, wofür seine Außenmauer saniert wird. Aber auch für Raves werden die vier Gebäude genutzt und erreichen im Laufe der 90er Jahre wahren Kultstatus in der Szene. Im Jahr 1996 werden die vier Behälter an die GESIBA, SEG und Wohnbauvereinigung verkauft. 1997 fällt die Entscheidung zur Revitalisierung der GM. die 1999 in Angriff genommen wird. Im Mai 2001 ziehen bereits die ersten Mieter ein. Damit ist die Arbeit aber nicht beendet, das umgebende Gelände wird weiter bearbeitet, so entsteht zum Beispiel ein Kirschgarten, ein neuer Wohnbau „Villa Verde“ ist geplant und im Norden und Osten wird das Gelände ebenfalls weiter ausgebaut.
Wieso überhaupt Revitalisierung? Ist sie gelungen?
Die aufwändigen Baumaßnahmen hatten zum Ziel die Achse zwischen Innenstadt und Flughafen Wien Schwechat auszubauen und das Gebiet zu beleben. Durch vielfältige Nutzungsmöglichkeiten sowohl für Privatpersonen (Wohnungen, Mall, Veranstaltungen etc.) als auch für Geschäfts- und Firmeninhaber sollte eine Ansiedlung hier attraktiv gemacht werden.
Eine Studie durch M. Wehdorn mit der die Möglichkeiten einer Fremdnutzung der GM. belegt werden sollten stellte 1989 die Grundlage für die Revitalisierung.
Durch den Preisanstieg der umgebenden Grundstücke ist diese Idee wohl durch den wirtschaftlichen Erfolg als gelungen belegt.
Aber auch der Aufstieg zum neuen IN – Viertel Wiens zeugt vom Durchbruch dieser Idee.
Wie sind die Gasometer heute aufgebaut?
Alle vier GM. sind durch eine Shopping – Mall auf der Ebene U3 miteinander verbunden. Der zentrale Eingang befindet sich im GM. A, zwischen den GM. B und C wurde eine Glasbrücke errichtet die diese beiden miteinander verbindet. In den Gebäuden befinden sich neben den Wohnungen auch noch Garagen, Arztpraxen, Büros und das Wiener Stadtarchiv und ähnliches mehr.
Gasometer A.
Dieser ist der erste im Westen gelegene GM., durch dessen Haupteingang man in die Mall gelangt. Über der Mall befinden sich 3 Bürogeschoße und 9 Wohngeschoße mit 128 Wohnungen, die über Laubengänge zu betreten sind. Die Mall ist in drei Etagen gegliedert, es befinden sich noch eine Garage und Arztpraxen sowie eine Apotheke im Gebäude.
Der Architekt Jean Nouvel plante die Umgestaltung dieses GM.. Um die innere Struktur der Mauern zu erhalten ließ er 9 Türmchen in denen sich die Wohn – und Bürogeschoße befinden aus Stahl errichten die verglast wurden – dadurch gelangt viel Tageslicht in die Räume. Den Türmchen die an den Seiten komplett mit Nirosta - Stahl verkleidet sind liegt jeweils ein originales Stück Ziegelmauer gegenüber und bietet somit einen reizvollen Kontrast zwischen Alt und Neu.
Die Verwendung von Glas und Stahl in Kombination mit dem offenen Kuppeldach und den erhaltenen Fenstern in der Außenmauer erzielt faszinierende Lichtreflexe und Spiegelungen durch das einfallende Sonnenlicht und gibt dem Inneren ein lebendiges Aussehen.
J. Nouvel war es „wichtig eine visuelle Leichtigkeit zu vermitteln und eine Synergie zwischen der alten bestehenden Außenmauer und der neuen Konstruktion zu schaffen.“
Im Zentrum des Innenhofs über der Mall befindet sich ein großes Fenster das Blicke sowohl in die Mall als auch aus ihr heraus nach oben zulässt. Der Bereich der Mall und der darunter liegenden Garage sind aus Stahlbeton gefertigt. Die Mall selbst orientiert sich an der Fensterform, d.h. sie ist auf drei Etagen rund um das Fenster als Zentrum angelegt. Hier stehen die verschiedensten Geschäfte – das Angebot reicht vom Modegeschäft bis zum Lebensmittelgeschäft – sowie eine Bar zur Verfügung. Verschiedene kleinere und größere Restaurants runden das Angebot ab.
Gasometer B.
Das auffälligste Merkmal an diesem Gasometer ist der angebaute Schild an der nördlichen Außenmauer, er dient zur Erweiterung der Wohnfläche.
Der Architekt Wolf Prix von Coop Himmelb(l)au wollte damit einen Akzent setzen der für Modernität steht.
Durch die eckige Form und die glatte Außenfassade setzt er sich deutlich vom originalen Ziegelmauerwerk ab.
Die Nutzung dies GM. ist äußerst effizient. Er verfügt über insgesamt 256 (140 und 116) Wohnungen, 247 Plätze im Studentenwohnheim, eine Veranstaltungshalle mit 7.558,10 m² und 2.000 Sitzplätze oder 3.600 Stehplätze. Darüber hinaus beherbergt er die Büros der Wiener Gebietskrankenkasse, verschiedene Praxen und die Mall.
Zunächst zum Schild als Wohnraum.
Diese zeichnen sich durch Helligkeit und einen grandiosen Panoramablick über die Stadt aus. Zugang erhalten die Bewohner über zwei Eingänge, einen in Höhe der Mall den anderen im Wohnbereich. Diese zwei Zugänge bilden die einzigen Berührungspunkte von Zubau und Gasometer, so dass keine großen Eingriffe an der originalen Hülle vorgenommen wurden. Die Konstruktion ruht auf vier Füßen und ist somit durch diese entstehende Öffnung zwischen der untersten Bodenplatte und dem Gehweg kein Block sondern wirkt relativ leicht, unterstützt wird dieser Eindruck durch die sich in die Höhe streckende Silhouette des Schildes. Im obersten Stockwerk, über dem Kuppeldach des GM. gelegen befinden sich Ateliers mit Dachterrassen.
Die Wohnungen im Inneren des GM. sind kreisförmig und bilden einen Kernbau mit einem kleinen Innenhof. Dadurch entstehen Wohnungen mit Blick in diesen selbst, als auch mit Blick auf die Umgebung, nach außen. Da die Wohngeschoße erst ab 30m Höhe beginnen wird der Ausblick begünstigt.
Das Studentenheim das unter den „normalen“ Wohngeschoßen liegt verfügt neben einer Studentenbar über einen Saunabereich, einen Fitnessbereich und einen Probenraum.
Die Mall bietet mit verschiedenen Ladengeschäften, einer Bar und einem Eiscafe einige Möglichkeiten sich beim Bummeln etc. zu entspannen.
Unterhalb der Mall befindet sich die Ei – förmige Veranstaltungshalle. Durch eine spezielle Aufhängtechnik bzw. durch eine frei schwingende Erbauung die durch zwei riesige kreisförmige Kunststoffringe gewährleistet wird, ist diese schallfrei, da kein Körper bzw. Luftschall übertragen werden kann. Somit ist gewährleistet, dass kein Anwohner durch laute Konzerte o. ä. gestört wird. Modernste Bühnentechnik und mobile Sitzgelegenheiten lassen eine flexible Gestaltung vom klassischen Konzertsaal bis zum Rave / Rockkonzertsaal zu.
Gasometer C.
Der dritte GM. bietet ein absolut unterschiedliches Bild gegenüber seinen Vorgängern. Waren in GM. A stahl und Glas beherrschend, in B ein herausragendes Schild und moderne Ringwohnungen bestimmend, so besticht C durch eine an klassische Wiener Bauweise angelehnte Architektur mit großem Innenhof, viel Grün viel Licht und Platz zum Leben und Durchatmen. Die treppenförmig aufsteigenden sich nach oben verjüngenden Laubengänge lassen Licht und Umwelt herein und bieten nostalgischen Gefühlen von Hinterhofromantik Platz.
Auch in diesem umgebauten GM. teilen sich Wohnungen (92), Büros, Mall (zwei Etagen) und eine Garage (fünf Etagen) den Raum.
Der Architekt und Universitätsprofessor Manfred Wehdorn plante diesen Umbau. Sein Ziel war es den Innenhof als grüne Oase erlebbar zu machen. Bereits auf dem Papier plante er großzügige Beete und Grünflächen sowohl in den Laubengängen als auch im Hof selbst ein. Durch das offene Kuppeldach – übrigens in allen vier GM. sind die Kuppeldächer nicht verschlossen – sind die Bäume etc. im Hof optimal mit Regen, Sonne, Sauerstoff versorgt, und es bedarf keiner aufwändigen Belüftung o. ä.
Die an die Außenmauer angelehnten Wohnungen sind in vier Segmente – zwei große und zwei kleine – geteilt, so dass auch die Zwischenstücke der originalen Mauer begrünt werden können. Die Aufteilung in Segmente und deren unregelmäßiges Vorspringen haben aber auch noch den Effekt, dass so gut wie keine Schallreflektionen entstehen – somit bleibt die grüne Oase ruhig und friedlich und verbreitet eine angenehme Atmosphäre.
Die bereits erwähnte Anlehnung an traditionelle Wiener Bauweise spiegelt sich in den Laubengängen wieder – auf wienerisch „Pawlatschen“ - diese bilden die Zugänge zu den Wohnungen, bieten Begegnungsmöglichkeiten als auch schlichte Funktionalität und Wohnraumerweiterung. Durch die Besonderheit der nach oben zurück gesetzten Wohnungen wird der Lichteinfall und damit die Helligkeit und freundliche Atmosphäre begünstigt.
Die Mall mit ihrem Bullauge zum Innenhof hält eine weitere Besonderheit parat. So Schallarm der Innenhof ist, erlebt man genau unter der Mitte des Bullauges in der Mall ein vierfaches Echo. In dieser befindet sich das Narrenschloß als besondere Attraktivität, hier können Kinder verschiedener Altersgruppen Geburtstage feiern, es werden Discos und weitere Veranstaltungen speziell für Kinder angeboten.
Gasometer D.
Die Revitalisierung bzw. der Umbau wurde von Architekt Wilhelm Holzbauer geplant. Er ließ die 114 Wohneinheiten wie einen dreistrahligen Stern in die Mitte des GM. setzen, so dass durch die Berührungspunkte von Außenmauer und Wohnbereich eigentlich drei Mehrfamilienhäuser mit Garten auf einer Höhe von 30m entstanden sind.Untergebracht sind neben der zweigeschossigen Mall eine Garage und das Wiener Stadt – und Landesarchiv auf insgesamt sechs Etagen.
Durch die spezielle Anordnung der Wohnungen bleibt der Blick auf die historische Außenmauer frei. In diese wurden zusätzliche „Fenster“ allerdings ohne Glas und Leibung eingelassen. Durch diese erweiternde Raumöffnungen nach außen wird ein Austausch von Eindrücken von drinnen nach draußen und umgekehrt ermöglicht.
Die so gestaltete Mauer erinnert an ein römisches Aquädukt bzw. durch die Kletterpflanzen die an den originalen Stahlgerippen ranken, an eine – allerdings sehr gut erhaltene – verwunschene Burgruine.
Im Wiener Stadt – und Landesarchiv sind auf 30.000 Regalmetern Kostbarkeiten wie Beethovens Testament und andere stadtgeschichtliche Daten sicher untergebracht. Eine Belüftungs- – und Beleuchtungssystem konserviert die zum Teil sehr alten Dokumente.
Schluss und eigener Eindruck.
Meiner Ansicht nach bieten die unterschiedlich gestalteten GM. eine spannende Verbindung von Alt und Neu.
Dieses Projekt ermöglicht interessante Einblicke in gestalterische Möglichkeiten der Architektur in Verbindung mit denkmalgeschützten Bauten und zeigt außergewöhnliche Wohn – und Lebenskonzepte.
Mit der Umgestaltung durch verschiedene Architekten ist ein abwechslungsreiches Gestaltungsprogramm entstanden. Jeder GM. besitzt andere Vorzüge, bedient andere ästhetische Erwartungen. Vereint sind die vier Gebäude durch die
Shopping – Mall, die trotz unterschiedlicher Gestaltung ein einheitliches, verbindendes Bild schafft.
Entstanden ist in den Gaswerken nicht nur Wohnraum, sondern ein eigener Lebensraum, eine eigene kleine Stadt mit ärztlicher Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Arbeitsplätzen, Restaurants, Unterhaltungsangeboten etc. .
Doch sehe ich darin bereits auch einen möglichen Nachteil.
Die Abgeschlossenheit des Komplexes, der Wunsch alles auf einem Fleck zu konzentrieren sozusagen die „Stadt der kurzen Wege“, kann meiner Ansicht nach dazu führen, daß damit ein wirklicher Austausch mit dem „wahren Leben draußen“ eingeschränkt wird. Alles, einschließlich des Individuums, wird auf einen Mikrokosmos reduziert - Leben, Wohnen und Arbeiten in ein und demselben Gebäudekomplex.
Trotzdem könnte ich mir vorstellen eine gewisse Zeit in einem der GM. zu wohnen, aber eben nur eine gewisse Zeit, denn das Gefühl in den GM. eingeschlossen zu sein, allein schon aufgrund der runden, geschlossenen vorgegebenen Architektur der Gebäude, wäre für mich nicht auf Dauer zu ertragen.
Literaturliste
Internetseiten:
http://www.wien.gv.at
http://www.wiener-gasometer.at
http://www.nextroom.at
http://www.tages-anzeiger.ch
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Gasometer-City?
Die Gasometer-City befindet sich im 11. Wiener Bezirk (Simmering) an der Guglgasse. Es handelt sich um vier Gasometer, die unter dem Namen "Wiener Gasometer-City" bekannt sind. Dieser Begriff bezieht sich hauptsächlich auf das dortige Einkaufszentrum (Shopping Mall). Für die Bewohner sind die Wohngebäude schlicht "Gasometer".
Was ist ein Gasometer?
Ein Gasometer hat zwei Bedeutungen: Einerseits ist es die Messuhr an der Außenseite eines Gasbehälters, die die Menge des gespeicherten Gases anzeigt. Andererseits ist es ein Behälter zur Speicherung und kontrollierten Abgabe von Gas.
Wie funktioniert ein Gasometer und wie sieht er aus?
Im Inneren befindet sich eine bewegliche Teleskophülle aus drei Ringen mit einem Glockendach. Beim Einströmen von Gas dehnt sich diese nach oben aus, gehalten von Schienen an der Innenseite der Außenmauer. Beim Ausströmen kehrt sich der Vorgang um. Der Lagerraum kann bis zu 90.000 m³ Gas fassen. Ein Wasserbassin verhindert den Gasaustritt. Der Gasometer besteht aus Vollziegelmauerwerk, ist 40 m hoch (plus 25 m Dach) und reicht 12 m in die Tiefe. Er umschließt eine Fläche von 3096 m².
Was ist die Geschichte der Gasometer in Simmering?
Im 19. Jahrhundert begann die Gasnutzung in Wien. 1816 erzeugte Josef Moser Gas aus Harz. Johann Josef Ritter von Prechtl baute eine größere Anlage. Die englische I.C.G.A. erlangte eine Monopolstellung. 1855 wurde die "Österreichische Gasbeleuchtungs-Aktiengesellschaft" (ÖGA) gegründet. Die Stadt Wien plante ein eigenes Gaswerk. 1896 erfolgte der Spatenstich, und 1899 wurden die vier Gasometer eingeweiht. Ab 1966 wurde auf Erdgas umgestellt, und die Gasometer wurden ab 1984 stillgelegt.
Wieso wurden die Gasometer revitalisiert?
Ziel war es, die Achse zwischen Innenstadt und Flughafen Wien-Schwechat auszubauen und das Gebiet zu beleben. Die vielfältige Nutzung (Wohnungen, Mall, Veranstaltungen, Geschäfte) sollte eine Ansiedlung attraktiv machen. Eine Studie von M. Wehdorn 1989 bildete die Grundlage für die Revitalisierung. Der Preisanstieg der Grundstücke und der Aufstieg zum neuen IN-Viertel Wiens zeugen vom Erfolg.
Wie sind die Gasometer heute aufgebaut?
Alle vier Gasometer sind durch eine Shopping-Mall auf der Ebene U3 verbunden. Der zentrale Eingang ist im Gasometer A. Zwischen Gasometer B und C gibt es eine Glasbrücke. In den Gebäuden befinden sich Wohnungen, Garagen, Arztpraxen, Büros und das Wiener Stadtarchiv.
Wie ist Gasometer A gestaltet?
Gasometer A wurde von Jean Nouvel umgestaltet. Er ließ 9 verglaste Stahltürmchen für Wohn- und Bürogeschosse errichten. Die Mall ist in drei Etagen gegliedert. Es gibt Geschäfte, eine Bar und Restaurants.
Wie ist Gasometer B gestaltet?
Gasometer B hat einen angebauten Schild an der nördlichen Außenmauer, entworfen von Wolf Prix von Coop Himmelb(l)au. Er verfügt über Wohnungen, ein Studentenwohnheim, eine Veranstaltungshalle und Büros der Wiener Gebietskrankenkasse.
Wie ist Gasometer C gestaltet?
Gasometer C wurde von Manfred Wehdorn umgebaut. Er ist an klassische Wiener Bauweise angelehnt, mit einem großen Innenhof, viel Grün, Licht und Pawlatschen. Es gibt Wohnungen, Büros, eine Mall und eine Garage.
Wie ist Gasometer D gestaltet?
Gasometer D wurde von Wilhelm Holzbauer geplant. Die 114 Wohneinheiten sind wie ein dreistrahliger Stern angeordnet. Es gibt eine Mall, eine Garage und das Wiener Stadt- und Landesarchiv.
Welchen Eindruck hinterlassen die Gasometer?
Die Gasometer bieten eine spannende Verbindung von Alt und Neu und zeigen außergewöhnliche Wohn- und Lebenskonzepte. Die Abgeschlossenheit des Komplexes könnte jedoch zu einer Einschränkung des Austauschs mit dem "wahren Leben draußen" führen.
- Quote paper
- Corinna Huck (Author), 2005, Die Gasometer City in Wien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110315