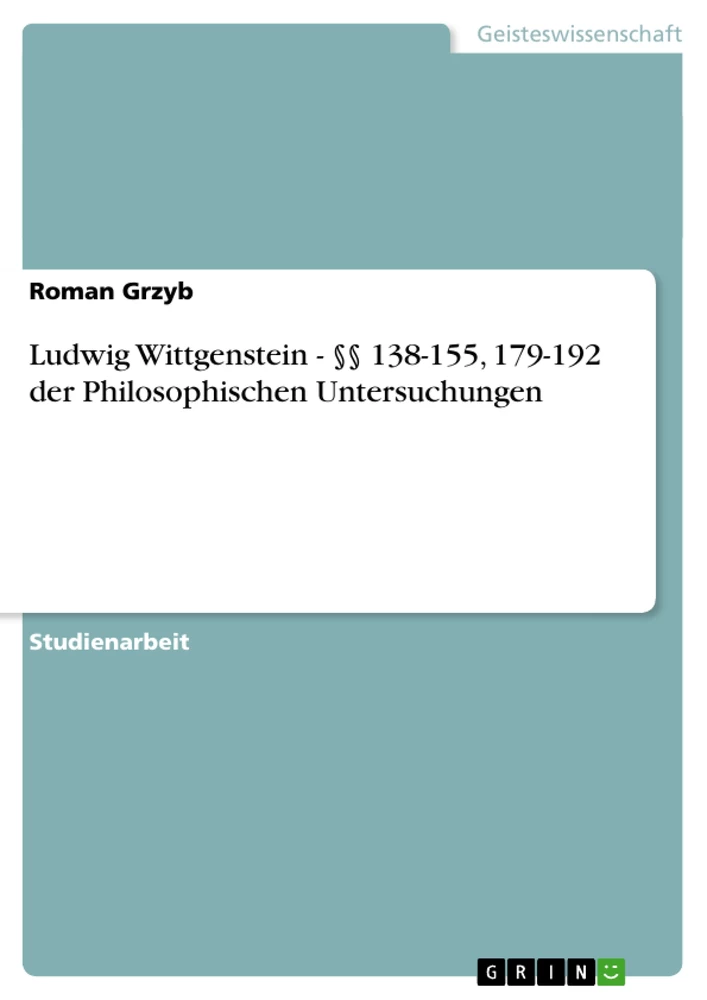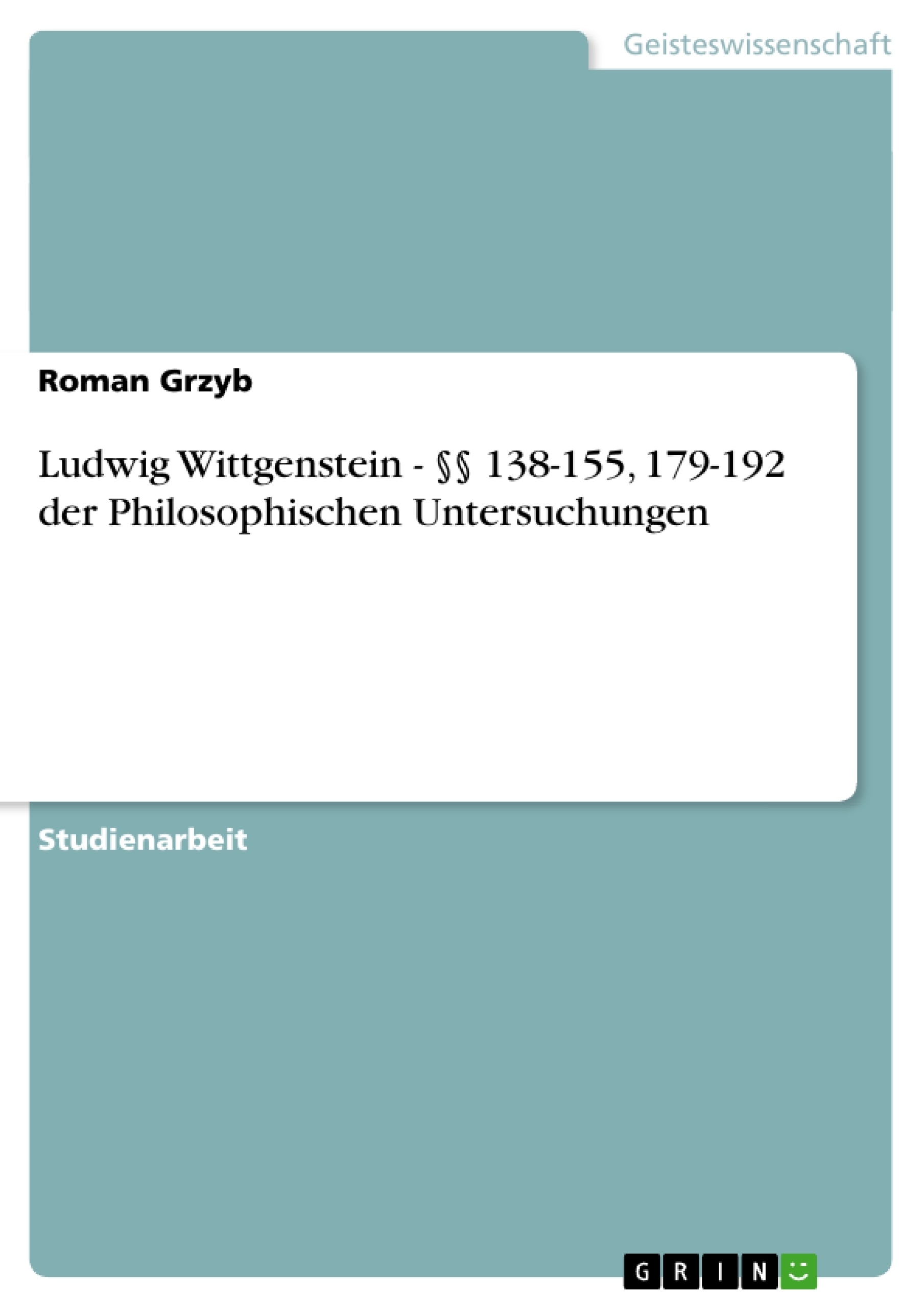„In den Paragraphen 138-155, 179-192 der Philosophischen Untersuchungen (PU) diskutiert Wittgenstein, warum das (eventuell „schlagartig“ sich einstellende) Verstehen einer Regel kein „seelischer“ Vorgang oder Zustand sein kann. Diskutieren sie kritisch Wittgensteins Argumente, wobei Sie zunächst ausführen sollten, weshalb Wittgenstein das Verstehen beim Regelfolgen überhaupt erwägt.“
In den von mir betrachteten Paragraphen der Philosophische Untersuchungen1, insbesondere die Paragraphen PU 138 bis 155 sowie PU 179 bis 192, diskutiert Wittgenstein seine Auffassung vom „Verstehen“. Ich möchte mich unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung, besonders mit der Frage beschäftigen, ob das Verstehen als geistiger Zustand begriffen werden darf oder nicht. Und was die Gründe für ein blitzartiges Verstehen von gesprochenem Wort sind bzw. seien können.
Nach Wittgensteins Überzeugung ist die Sprache ein regelgeleitete Tätigkeit, wobei die Regeln als Maßstäbe der Richtigkeit zu begreifen sind, welche nicht beschreiben wie Leute sprechen bzw. sprechen sollten, sondern erläutern, was es heißt, richtig und sinnvoll zu sprechen. Ich glaube er denk hierbei nicht unbedingt an die Grammatik, so wie wir sie verstehen, denn derjenige der eine sprachliche Regel ausdrückt, muss keine metasprachliche Aussage über die Anwendung von Wörtern haben, sondern es stellt sich vielmehr das Problem in den Vordergrund ob ein Ausdruck zu einem bestimmten Anlass eine normative Funktion erfüllt. Ich sehe dies als einen angenehm pragmatischen Ansatz in Wittgensteins Denkweise. Man kann somit sagen, dass Wittgenstein eine Differenzierung zwischen einer Regel und ihrem Ausdruck, einer Regelformulierung macht. Aber der Unterschied ist nicht der zwischen einer abstrakten Entität und ihrer konkreten Bezeichnung, sondern vielmehr der zwischen einer normativen Funktion und der sprachlichen Form, die benutzt werden muss um das Konstrukt anzuwenden. Daher glaube ich dass das „Regelfolgen“ als eine Art Erfolgsindikator angesehen werden kann, da es diesen Unterschied zwischen glauben, dass man einer Regel folgt, und ihr wirklich zu folgen, mit einspannt. Entscheidend ist doch, dass es einen Unterschied macht ob ich einer Regel folge oder ob ich vielmehr durch mein bloßes Handeln in Übereinstimmung mit der Regel, die Gesetzmäßigkeit verstanden habe. Hierzu eignet sich das Beispiel aus den PU 1432 mit dem Niederschreiben von Reihen.
Inhaltsverzeichnis
- Philosophische Untersuchungen, insbesondere die Paragraphen PU 138 bis 155 sowie PU 179 bis 192
- Paragraphen PU 143 bis 184
- Paragraphen PU185 bis 242
- Paragraphen PU185ff.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay beschäftigt sich mit Wittgensteins Argumenten zum Verstehen von Regeln im Kontext seiner Philosophischen Untersuchungen. Der Fokus liegt auf der Kritik an der Vorstellung, dass Verstehen ein seelischer Zustand oder Vorgang sei.
- Die Natur des Verstehens
- Die Rolle von Regeln im sprachlichen Handeln
- Das Verhältnis von Verstehen und Anwendung
- Die Kritik an der Vorstellung eines seelischen Zustands des Verstehens
- Die Bedeutung von Praxis und Gebrauch im Verstehensprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay analysiert die in Wittgensteins Philosophischen Untersuchungen dargelegten Argumentationen zum Verstehen von Regeln. Zuerst wird die Bedeutung der Regelhaftigkeit im sprachlichen Handeln erläutert. Anschließend werden die Argumente Wittgensteins gegen die Vorstellung des Verstehens als seelischen Zustand vorgestellt und diskutiert. Das Beispiel des Schülers B, der eine Zahlenreihe nach einer Regel fortsetzen soll, wird herangezogen, um zu verdeutlichen, wie Verstehen nicht durch eine mentale Repräsentation der Regel, sondern durch die praktische Anwendung der Regel im Handeln zustande kommt. Der Essay beleuchtet, dass Verstehen eine bleibende Bedingung ist und nicht als seelischer Vorgang oder Zustand begriffen werden kann. Außerdem wird die Frage nach der Richtigkeit und Falschheit von Regelanwendungen im Detail behandelt, wobei die These von Wittgenstein hervorgehoben wird, dass die Richtigkeit oder Falschheit einer Regelanwendung nicht durch eine abstrakte Definition der Regel, sondern durch den tatsächlichen Gebrauch in einer bestimmten Situation bestimmt wird.
Schlüsselwörter
Verstehen, Regeln, Sprache, sprachliches Handeln, Philosophische Untersuchungen, Wittgenstein, seelischer Zustand, Regelanwendung, Praxis, Gebrauch, Richtigkeit, Falschheit.
- Quote paper
- Roman Grzyb (Author), 2003, Ludwig Wittgenstein - §§ 138-155, 179-192 der Philosophischen Untersuchungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11027