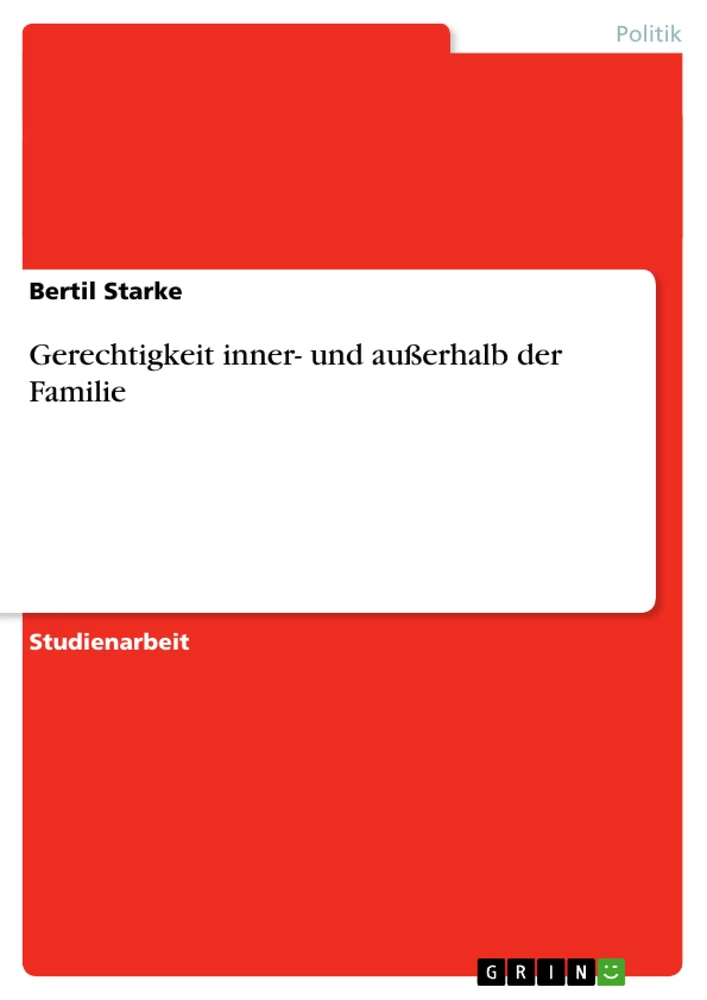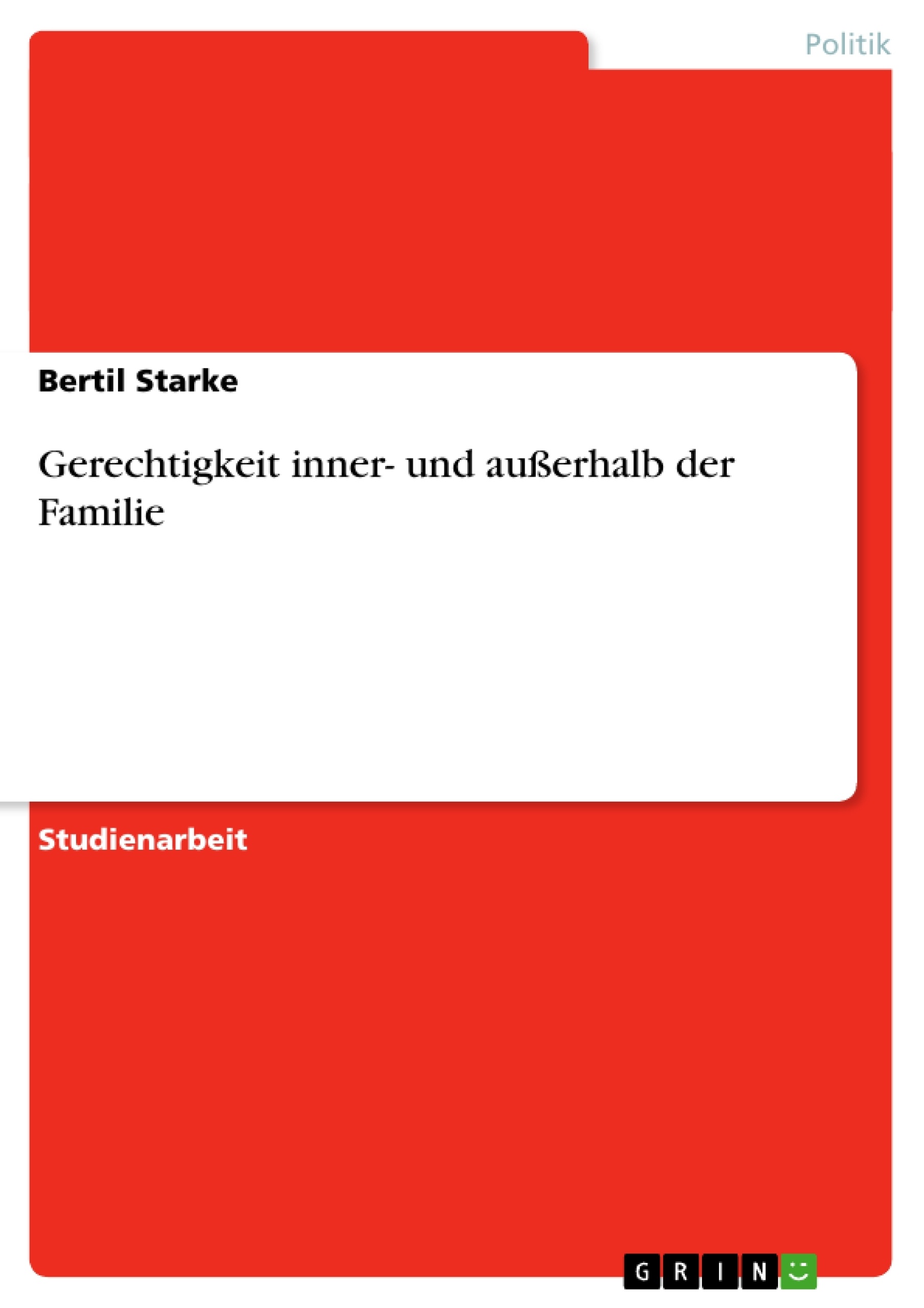Gliederung:
Aufgabe 1. Einleitung
Aufgabe 2.1. John Rawls: Die Familie als Basisinstitution
Aufgabe 2.2. Will Kymlicka: Rethinking the Family
Aufgabe 3. Interne Kritik an den beiden Texten
Aufgabe 4. Vergleich und Herausarbeitung der Unterschiede
Aufgabe 5. Externe Kritik
Aufgabe 6. Schlussbemerkung
Bibliographie
Aufgabe 1. Einleitung
Die Institution der Familie gilt als Kern aller liberalen und demokratischen Gesellschaften. Sie übernimmt wichtige gesellschaftliche Aufgaben wie die Erziehung der Kinder und die damit einhergehende Vermittlung von Normen und Werten. Während der Staat nur einen geringen Anteil an der Erziehung der Kinder trägt, zum Beispiel durch die Einrichtung der Schulen, übernimmt die Familie den größten Anteil an der Erziehung und der Prägung des Kindes. Die innerfamiliären Verhältnisse und Konstellationen spiegeln außerdem gesamtgesellschaftliche Verhältnisse wieder. Damit sind vor allen Dingen die Gleichberechtigung der Frau sowie die Tolerierung von nichttraditionellen Lebensgemeinschaften und Familienformen gemeint. Deshalb ist die Familie häufig Gegenstand geisteswissenschaftlicher Untersuchungen, so auch in der politischen Philosophie. Hier werden die eben von mir genannten Kernaufgaben, d.h. die Erziehung der Kinder und die Vermittlung von Werten und Normen, die Familienkonstellationen und die Herstellung der Gleichheit aller Familienmitglieder kontrovers diskutiert.
Einer der bedeutendsten Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts, John Rawls, befasst sich im Rahmen seiner „ Theorie der Gerechtigkeit “mit der Institution der Familie. Dort ist sie nicht einziger Untersuchungsgegenstand, sondern wird im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet. In seinem Werk „ Gerechtigkeit als Fairneß – Ein Neuentwurf “ ist die Familie erneut Thema. In diesem Werk geht Rawls unter anderem auf die Kritik ein, die an seiner Theorie der Gerechtigkeit geübt wurde. Eine seiner Kritikerinnen ist Susan Moller Okin, die in ihrem Buch „ Justice, Gender and the Family “ direkt Stellung zu Rawls Thesen nimmt. Ein anderer in diesem Zusammenhang wichtiger Kritiker ist Will Kymlicka, mit seinem Aufsatz „ Rethinking the Family “.
Die Differenzen zwischen Okin, Rawls und Kymlicka werden nun im Folgenden dargestellt. Zunächst wird der Paragraph 50 aus Rawls Werk „ Gerechtigkeit als Fairneß – Ein Neuentwurf “, sowie der Aufsatz „ Rethinking the Family “ von Will Kymlicka, der sich mit Susan Moller Okin intensiv auseinandersetzt, zusammengefasst. Nach einer internen Kritik beider Texte werden sie miteinander verglichen und die verschieden Positionen der Autoren gegenübergestellt. In einer anschließenden externen Kritik werden die unterschiedlichen Positionen beurteilt. Die Schlussbemerkung soll die These begründen: In einer liberalen Gesellschaft muss der Familie ausreichend individueller Spielraum gelassen werden, da die Gesellschaft hier sonst ihren liberalen Charakter verlieren würde.
Aufgabe 2.1. John Rawls: Die Familie als Basisinstitution
John Rawls befasst sich in § 50 seines Werkes „ Gerechtigkeit als Fairneß – Ein Neuentwurf “ mit der Institution Familie. In seiner Theorie der Gerechtigkeit ist der Grundgedanke die Ausarbeitung einer Gerechtigkeitskonzeption. Sie soll auf der Basis eines fairen und langfristigen Systems der sozialen Kooperation stehen und von einer Generation zur nächsten weitergeführt werden. Der wichtigste Akteur in diesem generationsübergreifenden Konzept ist die Familie. Die beiden, von ihm aufgestellten Gerechtigkeitsprinzipen sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: Das Differenzprinzip und das Prinzip des unabdingbaren Anspruchs aller Bürger auf gleiche Grundrechte und Grundfreiheiten.
Für Rawls besitzen seine Gerechtigkeitsprinzipien unter anderem Gültigkeit für die Familie. Diese ist ein Teil der Grundstruktur und für sie gilt ebenfalls das Prinzip der fairen Chancengleichheit. Weil sie ein Teil der Grundstruktur ist, hat die Familie bestimmte Aufgaben zu erfüllen: Die geordnete Schaffung und die Regeneration, sowie die Erhaltung der Kultur für zukünftige Generationen soll gesichert werden. D.h. die „Fortpflanzungsarbeit“ ist in Bezug auf die Gesellschaft eine absolut notwendige Funktion. Wenn dies anerkannt wird, soll die Gesellschaft die Erziehung der Kinder vernünftig und vor allen Dingen effizient gestalten. Die Bürger müssen einen Sinn für die politische Gerechtigkeit und für die politischen Tugenden entwickeln, auf denen die politischen und die sozialen Institutionen basieren. Dies muss die Familie so zahlreich erfüllen, damit eine auf Dauer bleibende Gesellschaft aufrechterhalten werden kann. Die Form der Familie (heterosexuell, homosexuell, monogam, polygam) spielt dabei keine Rolle, solange die eben genannten Voraussetzungen erfüllt werden können und keine gesellschaftlichen Werte verletzt werden.
Rawls führt aus, dass die oben genannten Notwendigkeiten alle Einrichtungen der Grundstruktur begrenzen, so auch die Institution der Familie. Doch durch die Grundprinzipien der Gerechtigkeit wird diesen Einschränkungen entgegengewirkt.
Im weiteren Verlauf räumt Rawls ein Missverständnis aus: Die Prinzipien der politischen Gerechtigkeit gelten, da der maßgebliche Gegenstand der Gerechtigkeit die Grundstruktur der Gesellschaft ist, zwar unmittelbar für dieses Gefüge, allerdings haben sie für das Innenleben eines Verbandes, zu denen Rawls auch Familien zählt, nur indirekt Geltung. Dies wird anhand der Kirche als Beispiel für einen Verband verdeutlicht: Die Kirche muss sich bestimmten Beschränkungen unterwerfen, die die politischen Gerechtigkeitsprinzipien verlangen. Ihre Mitglieder sind außerdem durch die Grundrechte geschützt. Die innerkirchlichen Macht- und Herrschaftsverhältnisse sind jedoch von den Gerechtigkeitsprinzipien nicht geregelt, bzw. beschränkt. Der Kirche soll also ein gewisser Handlungsspielraum gewährleistet werden.
Dieses Prinzip gilt genauso für die Familie. Laut Rawls soll die Erziehung der Kinder zu einem großen Teil von den Eltern gestaltet werden. Er spricht in diesem Zusammenhang von dem Vertrauen der Gesellschaft in die Fähigkeiten und in die Liebe der Eltern. Allerdings wird die Familie durch die Gerechtigkeitsprinzipien auch eingeschränkt. Gerade das Prinzip des unabdingbaren Anspruchs aller Bürger auf gleiche Grundrechte und Grundfreiheiten hat in diesem Kontext eine große Bedeutung. Alle Mitglieder der Familie sind also neben ihrer Mitgliedschaft in ihrem Verband (Familie) auch gleichberechtigte Bürger der Gesellschaft. D.h. die faire Chance auf Gleichheit sowie ihre Grundrechte und Grundfreiheiten besitzen sie auch innerhalb der Familie. Deshalb lässt sich sagen, dass die Gerechtigkeitsprinzipien indirekt auf die Familie projiziert werden, um ihre Mitglieder, gerade die Frauen und die Kinder, vor Schäden, zum Beispiel Missbrauch oder Vernachlässigung, zu schützen.
Rawls greift nun die in demokratischen Gesellschaften häufig auftretende Problematik der ungerechten gesellschaftlichen Stellungen der Geschlechter auf und verweist in diesem Zusammenhang auf die Ausarbeitungen Susan Moller Okins. Ehefrauen übernehmen demnach den größten Teil der familiären und häuslichen Arbeit und Aufgaben. Damit ist sowohl die Erziehung der Kinder, wie auch der Verzicht auf die eigenen beruflichen Ambitionen gemeint. Das Ergebnis dieser Ungleichheit ist die finanzielle und politische Vormachtstellung des männlichen Geschlechts. D.h. die Ehefrau ist in der Regel finanziell von ihrem Ehemann abhängig und wird im Falle einer Scheidung ungleich mehr benachteiligt.
Rawls geht auf diese Problematik folgendermaßen ein: Seine Gerechtigkeitsprinzipien gelten für jeden Bürger und gewähren allen Mitgliedern der Gesellschaft eine faire Chancengleichheit. Der Institution der Familie, die in ihrem Innenleben eigentlich frei von Beschränkungen sein soll, sollte zumindest ein gewisser Rahmen gegeben werden, um gerade Ehefrauen und Kindern, Schutz vor Vernachlässigung, sowie Missbrauch und Ungleichheit zu geben. Hier nimmt Rawls den Vorschlag Okins auf, die Hälfte des vom Ehemannes erwirtschafteten Einkommens der Ehefrau zuzugestehen, um sie für die Erziehung der Kinder und die häusliche Arbeit zu entschädigen. Im Fall einer Scheidung soll das während der Ehe entstandene Vermögen aufgeteilt werden, so dass beide Ehepartner genau die Hälfte des Vermögens erhalten.
Rawls setzt sich für Maßnahmen ein, eine faire Chancengleichheit für alle Mitglieder der Gesellschaft zu erreichen, vor allen Dingen um die Stellung der Frau zu verbessern. Regelungen für die Familie lehnt Rawls weitestgehend ab. Er befürwortet sie nur dann, wenn sie der Chancengleichheit der Familienmitglieder dienen. Er ist der Auffassung, dass seine Gerechtigkeitsprinzipien soweit in die Familie hineinwirken, dass es keinerlei weiterer Beschränkungen bedarf. Außerdem sollte die Gesellschaft, wie bereits erwähnt, Vertrauen in die erzieherischen Fähigkeit und die Liebe der Eltern haben.
Aufgabe 2.2. Will Kymlicka: Rethinking the Family
Will Kymlicka beschäftigt sich in seinem Aufsatz „ Rethinking the Family “ mit der Bedeutung der Familie in einer liberalen Gesellschaft. Die Gleichberechtigung der Frau innerhalb und außerhalb der Familie, andere „nicht – traditionelle“ Beziehungs- und Fortpflanzungsformen sowie die Regulierung der Ehe durch Verträge spielen in seinen Ausarbeitungen eine große Rolle. Er geht dabei größtenteils auf die Werke von Susan Moller Okin ein und diskutiert anhand ihrer Aussagen die oben genannten Schwerpunkte.
Zunächst beschreibt Kymlicka, dass die gesellschaftliche und ökonomische Gleichberechtigung der Frau in liberalen Demokratien trotz einiger Maßnahmen fehlgeschlagen ist. Frauen sind, wie Catherine MacKinnon meint, immer noch von Geburt an benachteiligt. Um die Gründe für diese Benachteiligung herauszufinden, führt Kymlicka das Buch „ Justice, Gender, and the Family “ von Susan Moller Okin an. Für Okin liegt in der Familie die Hauptursache für die Ungleichheit der Geschlechter, da die Familie eine der wichtigsten Institutionen ist, in der Güter aufgeteilt werden, und hier die wichtigsten Fragen der Gerechtigkeit und des Wohlstandes gestellt werden. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Benachteiligungen entstehen schon dadurch, dass Frauen Kinder gebären. Die Verantwortung für die Erziehung der Kinder wird dann dadurch meist auf die Frauen projiziert. Liberale Theoretiker lassen diesen Aspekt und den Zusammenhang zwischen häuslicher Arbeit und den sich daraus ergebenden Benachteiligungen im öffentlichen Leben meist außer Acht. In diesem Kontext wird John Rawls kritisiert, der die Erziehung der Kinder zwar nicht den Frauen zuschreibt und die politische und wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Mann und Frau nicht gutheißt, familiäre Angelegenheiten allerdings als Privatsache betrachtet, die nicht unter die Prinzipien der Gerechtigkeit fallen.
Okin führt weiter aus, dass Männer, da sie in der Regel bezahlte Arbeit verrichten und damit Macht erlangen, in Gegenposition zu ihren Frauen stehen, die meist genauso viel arbeiten (Haushalt, Erziehung der Kinder etc.), dafür allerdings nicht bezahlt werden. Diese Machtposition nutzen die Männer meist dazu aus, um über die wichtigsten Dinge, die die Familie bzw. die Ehe betreffen, zu bestimmen. Frauen werden deshalb von vorneherein in einer Ehe benachteiligt und stehen im Falle einer Scheidung wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit vor einem sozialen Abstieg.
Auf die Frage, wie eine Theorie der Gerechtigkeit mit der Familie umgehen sollte, schlägt Okin die Schaffung einer geschlechtsneutralen Gesellschaft vor, in der das Geschlecht einer Person eine ähnlich untergeordnete Rolle spielen soll wie die Augenfarbe. In einer solchen Gesellschaft sollte ihrer Meinung nach das Gebären von Kindern und die Erziehung von Kindern zwei voneinander getrennte Gebiete sein. Kymlicka schließt sich dieser Idee weitestgehend an. Seiner Meinung nach müssen vor der Teilung von häuslicher Arbeit (die Kindererziehung eingeschlossen) grundlegende Fragen in Bezug auf die Familie beantwortet werden. Eine dieser Fragen ist, wer das Recht hat, eine Familie zu gründen. Kymlicka stellt dazu fest, dass in der gegenwärtigen Gesellschaft nur traditionelle Partnerschaften, d.h. Mann und Frau, dieses Recht besitzen. Homosexuelle und polygame Lebensgemeinschaften sind davon weitestgehend ausgeschlossen. Okin und Kymlicka indes sind der Meinung, dass nichttraditionelle Gemeinschaften gestärkt werden müssen, um die „vorgeschriebene“ Heterosexualität einzuschränken. Kymlicka zeigt in diesem Zusammenhang allerdings einen Widerspruch in der Argumentation Okins auf, da sie eine sinnvolle Kindererziehung nur heterosexuellen Paaren unterstellt: Eine Familie soll in einer geschlechtsneutralen Gesellschaft wiederum nur von traditionellen Paaren, die untereinander die gleichen Rechte, Verantwortungen und Pflichten haben, gebildet werden. Kymlicka kritisiert diese Einstellung und verdeutlicht dies indem er kritisch zu einem Urteil des Obersten Gerichtshofes der USA Stellung nimmt, in dem Mormonen untersagt wird, Polygamie zu praktizieren. In diesem Zusammenhang stellt er die Frage, warum stabile polygame Ehen dem Sozialwesen und damit auch dem Wohlergehen der Kinder, mehr schaden sollten, als dies monogame Ehen tun.
Kymlicka kritisiert weiterhin, dass sich Okin nur zu den Pflichten der Männer in einer gleichberechtigten Beziehung und in der geschlechtsneutralen Gesellschaft äußert, nicht aber zu ihren Rechten. Eine vollkommene Gleichheit hätte seiner Meinung nach weitreichende und problematische Konsequenzen. Bei künstlichen Befruchtungen beispielsweise könnte der Mann sich weigern, Sperma zu spenden, um möglichen Unterhaltsforderungen zu entgehen und die Frau könnte es ablehnen, das Kind zu gebären, da sie die Erziehung des Kindes eventuell mit demjenigen teilen müsste, der das Sperma gespendet hat und ihr wohlmöglich unbekannt oder unsympathisch ist.
Eine weitere Frage, die in Bezug auf die Familie gestellt werden muss, ist nach der Ansicht von Kymlicka, welche Einschränkungen in der Familienplanung im Sinne des Liberalismus vorgenommen werden können. In diesem Zusammenhang erwähnt er die vertragliche Regelung verschiedener Lebensbereiche, im Speziellen den Ehevertrag. Solch ein Vertrag könnte das Sexualleben, die häusliche Arbeit und die Reproduktion regeln. Okin spricht sich gegen solch eine Interpretation des Liberalismus aus. Sie lehnt sowohl heutige Eheverträge ab, da sie die bestehende Ungleichheit zwischen Mann und Frau festigen, als auch einen Abkommen, welches das Sexualleben und die Fortpflanzung regelt, da dies den Kindern schaden könnte. Ihrer Meinung nach ist die Freiheit, Kinder zu gebären, weniger ein Recht oder eine Verpflichtung, als eine Vertrauensangelegenheit. Kymlicka greift in diesem Zusammenhang die Idee einer Lizenz für zukünftige Eltern von Hugh LaFolette auf. Da es nach John Stuart Mill kein natürliches Recht auf Fortpflanzung gibt, sollten Paare, die sich als ungeeignet zur Fortpflanzung und Erziehung erweisen keine Lizenz dafür erhalten. Kymlicka stimmt dieser Idee weitestgehend zu. Familien wären dadurch seiner Meinung nach wesentlich stabiler und würden dem Kind vermutlich weniger schaden, als dies schmerzhafte Scheidungs- und Sorgerechtsprozedere heute tun.
Kymlicka gelangt abschließend zu dem Fazit, dass die Thesen Okins zur Gleichstellung der Geschlechter im Ansatz richtig sind. Seiner Meinung nach sind ihre Ansichten aber nicht weit genug ausgearbeitet. Er unterstützt zwar Okins Forderungen nach einer stärkeren Berücksichtigung der Familien in den Theorien der Gerechtigkeit, befürwortet aber eine strikte Regelung in der ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau, sowie in der Beziehungen und Kindern.
Aufgabe 3. Interne Kritik an den beiden Texten
Der Text „ Rethinking the Family “ von Will Kymlicka lässt es gelegentlich für den Leser unklar erscheinen, ob er seinen eigenen oder den Standpunkt bzw. den Gedankengang eines anderen Autors vertritt. Außerdem springt er auch häufig in seinen Gedankengängen, so dass eine klare Gedankenführung nicht immer erkennbar ist.
Nun zu den einzelnen Kritikpunkten: Kymlicka schreibt (Rethinking the Family, S. 83), dass Susan Moller Okin fordert, nichttraditionelle Gruppen zu stärken und zu ermutigen, um damit die Gleichheit von Mann und Frau in der Gesellschaft zu erreichen. Mir ist es unklar geblieben, was die Stärkung von nichttraditionellen bzw. „nicht - heterosexuellen“ Gruppen mit der Emanzipation und der Gleichstellung der Frau zu tun hat.
Des weiteren schreibt Kymlicka: “For Example, Okin argues (following Chodorow) that female primary parenting leads to a greater capacities for empathy in girls, and to a greater tendency to self-definition and abstraction in boys, so that we can ‘expect to find two capacities better combined in children of both sexes who are reared by parents of both sexes.’ “ (Rethinking the Family, S. 90). Die Aussage dieses Satzes ist mir unklar geblieben. Konkret: Warum führt eine weiblich geführte Elternschaft zu einer größeren Kapazität an Einfühlungsvermögen bei Mädchen und zu einer größeren Tendenz der Selbstdefinition und Abstraktion bei Jungen?
Susan Moller kritisiert an der Theorie der Gerechtigkeit, dass hier eine potentielle Kritik an der Familie und an den genderspezifisch strukturierten sozialen Institutionen stecke. Diese Kritik ließe sich weiterführen, wenn man davon ausgeht, dass die Parteien im Urzustand nicht über das Geschlecht der von ihnen vertretenen Personen Bescheid wissen(Gerechtigkeit als Fairneß, S. 258). Diese Kritik bleibt mir insofern unklar, da es mir nicht deutlich wird, warum sie sich entfalten könnte, wenn die Parteien im Urzustand unwissend über das Geschlecht der sie vertretenden Personen wären. Auf diesen unklaren Punkt geht Rawls allerdings nicht weiter ein.
Aufgabe 4. Vergleich und Herausarbeitung der Unterschiede
Der wesentlichste Unterschied zwischen den beiden Texten liegt in der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Familie. Während Rawls sich in seiner Theorie mit dem Gesamtkonzept beschäftigt und sich dabei insbesondere mit der Grundstruktur der Gesellschaft befasst, gehen Will Kymlicka und die von ihm häufig zitierte Susan Moller Okin eher auf einzelne Details der Familienstrukturen ein.
In der Frage, welche Familienkonstellationen möglich sein sollen, gerade in Bezug auf die Erziehung der Kinder, gibt es ebenfalls Unterschiede: Rawls schreibt der Familienform keine große Bedeutung zu, solange die Regeneration der Gesellschaft sichergestellt und die Kultur für zukünftige Generationen erhalten wird (Gerechtigkeit als Fairness, S. 251). Kymlicka bezieht hierzu einen ähnlichen Standpunkt. Für ihn ist es durchaus denkbar, dass beispielsweise stabile polygame Familien ihren Kindern und der Gesellschaft genauso viel Schaden bzw. Nutzen zufügen können, wie dies stabile monogame Familien tun. Nichttraditionelle Partnerschaften haben seiner Meinung nach also durchaus eine Berechtigung, Kinder großzuziehen (Rethinking the Family, S.93 – 94). Die von Kymlicka oft zitierte Susan Moller Okin vertritt in diesem Punkt eine andere Auffassung. Sie hält die sogenannten nichttraditionellen Gruppen für durchaus legitim (Rethinking the Family, S. 83), die Kindererziehung sollte ihrer Meinung nach aber nur von traditionellen Partnerschaften, also von Mann und Frau, übernommen werden. Sie begründet ihre Forderung damit, dass die Kinder ansonsten keinen erforderlichen Sinn für Gerechtigkeit entwickeln könnten (Rethinking the Family, S. 84).
Auch in Bezug auf die innerfamiliären Handlungsspielräume beziehen die Autoren verschiedene Positionen. John Rawls spricht sich für eine weitgehende Handlungsfreiheit innerhalb der Familien aus. Die politischen Gerechtigkeitsprinzipien haben seiner Meinung nach verbindlich nichts im Innenleben der Familien zu suchen. Frauen und Kinder sollten natürlich vor Missbrauch und Vernachlässigung geschützt werden. In der Erziehung der Kinder ist laut Rawls allerdings irgendwann ein Punkt erreicht, an dem die Gesellschaft den Eltern in Bezug auf deren Liebe und Zuneigung vertrauen muss. Die Familie soll demnach also kein rechtsfreier Raum sein, aber dennoch in die Lage versetzt werden, autonome Entscheidungen zu treffen (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 254). Kymlicka vertritt in diesem Punkt eine gänzlich andere Meinung: Für ihn haben Eingriffe in den innerfamiliären Bereich durchaus Berechtigung. Die Einführung einer sogenannten Elternlizenz, bei der potentielle Eltern Auflagen erfüllen und ihre Fähigkeiten zur Erziehung von Kindern beweisen müssen, hält er für ein geeignetes Mittel, um stabilere Familien zu erzeugen und um Kinder vor den Unannehmlichkeiten eines Scheidungs- und Sorgerechtsstreits zu bewahren (Rethinking the Family, S. 94). Solch eine Maßnahme wäre ein massiver Eingriff in einer der zentralsten Bereiche des innerfamiliären Lebens, der Fortpflanzung. Dieser Standpunkt Kymlickas grenzt sich klar von der Auffassung Rawls ab. Das von Rawls angesprochene Vertrauen in die Eltern ist bei Kymlicka nicht vorhanden. Okin, auf deren Ausarbeitungen Kymlicka größtenteils seine Argumentation aufbaut, spricht sich gegen eine vertragliche Regelung der Elternschaft aus. Ähnlich wie Rawls vertritt sie die Auffassung, dass das Gebären und Erziehen von Kindern weniger ein Recht als vielmehr eine Verantwortung bzw. ein Vertrauenssache sei (Rethinking the Family, S. 89). Ihrer Meinung sollte dieses Vertrauensprinzip so angewendet werden, dass die Interessen der Kinder unter allen Umständen geschützt werden (Rethinking the Family, S.90).
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Rawls vertragliche Regelungen bis zu einem bestimmten Grad befürwortet, zum Beispiel um die Gleichstellung der Frau voranzubringen (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 257) und um die Grundrechte und Grundfreiheiten der Bürger zu schützen (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 252). Das Innenleben von Verbänden, in diesem Fall der Familie, soll jedoch, wie bereits oben erwähnt, nicht weiter beschränkt werden (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 254) . Susan Moller Okin vertritt eine ähnliche Meinungen und befürwortet vertragliche Regelungen und Beschränkungen auch nur bis zu einem bestimmten Grad, vor allen Dingen dann, wenn es um die Gleichstellung der Frau in der Familie geht (Rethinking the Family, S. 85). Zentrale Bereiche des innerfamiliären Leben sollen jedoch von Regelungen und Beschränkungen nicht betroffen werden (Rethinking the Family, S. 89). Kymlicka hingegen spricht sich für starke Eingriffe in die innerfamiliäre Sphäre aus (Rethinking the Family, S. 94).
Aufgabe 5. Externe Kritik
Die Positionen beider Autoren sind in zentralen Punkten, wie bereits in Aufgabe 4 dargestellt worden ist, durchaus unterschiedlich. Im Folgenden werde ich beide Positionen kritisch kommentieren.
Will Kymlicka befürwortet die Einführung einer Elternlizenz im Sinne Hugh LaFolettes. Paare die sich als ungeeignet zur Aufzucht und Erziehung von Kindern heraustellen, sollten keine Berechtigung zur Vermehrung erhalten (Rethinking the Family, S. 94). Diese Auffassung ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll und reglementiert den Bereich der Familie in extrem starker Art und Weise. Die Kriterien, gleich wie sie denn aussähen auf denen solch eine Elternlizenz beruhen würde, wären in meinen Augen immer rein willkürlich. Es ist unmöglich, objektiv zu entscheiden, welches Paar geeignet ist, Kinder zu bekommen und zu erziehen. Hier könnten nämlich nicht nur pädagogische Fähigkeiten, sondern auch finanzielle Aspekte und der soziale Status des jeweiligen Paares ausschlaggebend sein. Es würde außerdem zu Problemen in der Behandlung der Kindern kommen, die illegal, d.h. von nicht lizenzierten Paaren gezeugt und geboren worden wären. Außereheliche, bzw. illegal geborene Kinder wären dann nämlich, wie es bereits in der Vergangenheit durchaus die Regel war, gesellschaftlich geächtet bzw. benachteiligt. Vermutlich würden sie sogar von ihren leiblichen Eltern getrennt werden. Doch auch die Erziehung der Kinder, die legal geboren wären, wäre enorm eingeschränkt, weil vereinheitlicht. Auf die individuellen Stärken und Schwächen einzuwirken, wäre für Eltern äußerst schwierig, denn sie müssten vorab immer prüfen, ob ihre erzieherischen Maßnahmen im Einklang mit den Kriterien der Elternlizenz stünden und sich im Zweifel diesen Kriterien unterwerfen.
Ich stimme deshalb eher der Auffassung Rawls zu. Er schreibt, dass die Gesellschaft ab einem gewissen Punkt „der natürlichen Liebe und Zuneigung vertrauen muß.“ (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 254). Die innerfamiliäre Sphäre sollte seiner Meinung nach weitestgehend von Beschränkungen ausgenommen werden. Dem stimme ich voll und ganz zu, da der individuelle Charakter der Familie unter allen Umständen bewahrt werden sollte. Die Grundrechte der Familienmitglieder, vor allen Dingen die der Kinder, sollen aber natürlich geschützt werden, denn trotz allem, darf die Familie selbstverständlich keinen rechtsfreien Raum bilden.
John Rawls sieht ähnlich wie die von Will Kymlicka oft zitierte Susan Moller Okin die Frau als grundsätzlich benachteiligt an. Sie übernimmt in der Regel den größten Teil der Erziehung der Kinder und der häuslichen Arbeit (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 255). Er greift in diesem Zusammenhang den Vorschlag Okins auf, die Hälfte des Einkommens des Ehemannes der Frau zu übertragen und im Falle einer Scheidung das Familienvermögen zu teilen, um die Ehefrau für ihre nicht bezahlten Familienarbeiten entsprechend zu entschädigen. (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 257). Diesen Vorschlag finde ich sehr sinnvoll, da er nicht nur die finanzielle Abhängigkeit der Ehefrau weitesgehend beseitigt, sondern weil er die gesellschaftliche Stellung der Frau insgesamt verbessern würde. Der vollkommenen gesellschaftlichen und politischen Gleichberechtigung der Frau muss meiner Meinung nach die Gleichstellung der Frau innerhalb der Familie vorausgehen. Aus diesem Grund lehne ich auch die Auffassung Kymlickas ab, schwangeren Frauen gesetzlich Vorschriften zu machen (Rethinking the Family, S.90)., und sei es auch zum Schutz des ungeborenen Dies würde die Grundfreiheiten der Frau zu stark einschränken und sie sowohl gesellschaftlich als auch in der Familie benachteiligen: Gesellschaftlich, da sie eventuell etwas gegen ihren Willen tun oder lassen müssten, innerfamiliär, da dem Mann, während der Schwangerschaft seiner Ehefrau keine zusätzlichen Beschränkungen oder Pflichten auferlegt werden, wie zum Beispiel vermehrte Verrichtung von häuslichen Arbeiten oder dem zwischenzeitlichen Verzicht auf Rauchen oder dem Konsum von Alkohol.
Die Familienform spielt bei Rawls keine große Rolle. Solange die Familie bestimmte Aufgaben erfüllt, besitzt ihre Struktur kein Gewicht. Homosexuelle und polygame Lebensgemeinschaften wären demnach berechtigt eine Familie zu gründen (Gerechtigkeit als Fairneß, S. 251). Kymlicka vertritt in diesem Punkt eine ähnliche Meinung. Für ihn ist es durchaus denkbar, dass polygame Lebensgemeinschaften eine Familie gründen könnten (Rethinking the Family, S. 93) . Ich teile diese Position nicht, sondern vertrete eher die Auffassung Okins , dass eine vernünftige und effiziente Erziehung unter normalen Umständen nur von einer heterosexuellen, monogamen Familie gewährleistet werden kann (Rethinking the Family S. 84). Um einen normalen Umgang mit den beiden Geschlechtern zu erlernen, ist es meiner Meinung nach sinnvoll, dass den Kindern dies von ihren Eltern vorgelebt wird. Deshalb stehe ich einer gleichgeschlechtlichen Elternschaft kritisch gegenüber. Ähnliches gilt in meinen Augen auch für eine polygame Familie, in der zusätzlich die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau nicht gegeben ist. Nur dem Mann, nicht aber der Frau wird in dieser Familienform zugestanden, polygam zu leben.
Aufgabe 6. Schlussbemerkung
In der Schlussbemerkung soll folgende These begründet werden: In einer liberalen Gesellschaft muss der Familie ausreichend individueller Spielraum gelassen werden, da die Gesellschaft hier sonst ihren liberalen Charakter verlieren würde.. In einer liberalen, demokratischen Gesellschaft sind die persönlichen Freiheiten von großer Bedeutung. Da die Familie den Kern einer liberalen Gesellschaft ausmacht, sollten diese besonders für sie gelten. Wie bereits in der externen Kritik angedeutet, soll das nicht heißen, dass die Familie ein vollkommen rechtsfreier Raum sein soll, der von jeglicher Kontrolle ausgenommen ist. Die Wahrung und der Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten aller Familienmitglieder muss von der Gesellschaft garantiert werden. Weitergehende Beschränkungen sind meiner Meinung nach jedoch kontraproduktiv. Wenn eine Gesellschaft den potentiellen und den tatsächlichen Eltern so wenig traut, dass sie ihnen gravierende Einschränkungen auferlegt, wie dies von Will Kymlicka befürwortet wird, wendet sie meiner Meinung nach keine, im Rahmen des Liberalismus vertretbare Maßnahmen an. Das könnte dann weitreichende Folgen nach sich ziehen, da die Kinder in ihrem nahen sozialen Umfeld keine individuelle Erziehung mehr genießen könnten. Dieses Klima würde sich in den folgenden Generationen vermutlich auch auf die Gesellschaft als solche niederschlagen. Wenn Kinder in ihrem eigenen Elternhaus keine richtige innerfamiliäre Freiheit erleben können, sinken die Chancen, dass sie mündige Bürger werden. Wie soll man im Erwachsenenalter zu freiheitlichen Entscheidungen fähig sein, wenn man sie im Kindesalter im geschützten Raum der Familie nicht ausprobieren konnte . Dies kann weder im Sinne der Demokratie noch im Interesse des Liberalismus’ sein. Den Eltern sollte also die Möglichkeit gewährleistet werden, ihre Kinder weitestgehend individuell zu erziehen und die Schwerpunkte ihrer Erziehung selber zu wählen. Das geschieht auch zum Wohle der Kinder, da eine weitgehende einheitliche Erziehung ihre vielfältigen Stärken und Schwächen nicht berücksichtigen kann.
Abschließend möchte ich noch einmal hervorheben, dass eine strenge Beschränkung meinen Vorstellungen vom Liberalismus widerspricht und dass es in meinen Augen unvorstellbar ist, in einer liberalen Gesellschaft solche Beschränkungen durchzusetzen.
Bibliographie:
Hobbes, Thomas, Leviathan, oder Wesen, Form und Gewalt des kirchlichen und bürgerlichen Staates, Reinbek: Rowohlt, 1966
Kymlicka, Will, Rethinking the Family, Philosophy and Public Affairs 20 (1991), S.77-97.
Locke, John, Über die Regierung, Reinbek: Rowohlt , 1966
Rawls, John, Gerechtigkeit als Fairneß - Ein Neuentwurf , Hrsg. von Erin Kelly, aus dem Amerikan. von Joachim Schulte, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003
Rawls, John, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Übers. von Hermann Vetter, Sonderausgabe zum 30jährigen Bestehen der Reihe Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft; Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Analyse der Texte von Rawls und Kymlicka zur Familie?
Die Analyse vergleicht und kritisiert die Positionen von John Rawls und Will Kymlicka bezüglich der Rolle der Familie in einer liberalen Gesellschaft. Dabei werden insbesondere die Gerechtigkeitsprinzipien von Rawls, Kymlickas Auseinandersetzung mit Susan Moller Okin und deren unterschiedliche Ansichten zur Gleichberechtigung innerhalb der Familie sowie zu staatlichen Eingriffen in familiäre Angelegenheiten untersucht.
Welche Rolle spielt die Familie in Rawls' "Gerechtigkeit als Fairneß"?
Für Rawls ist die Familie eine Basisinstitution der Gesellschaft und Teil der Grundstruktur. Sie hat die Aufgabe, die geordnete Schaffung und Regeneration sowie die Erhaltung der Kultur für zukünftige Generationen sicherzustellen. Rawls betont, dass seine Gerechtigkeitsprinzipien, insbesondere das Prinzip der fairen Chancengleichheit, auch für die Familie gelten, jedoch nur indirekt, um die Familienmitglieder vor Schäden zu schützen. Er plädiert für eine weitgehende Handlungsfreiheit innerhalb der Familie, wobei die Gesellschaft auf die Liebe und die erzieherischen Fähigkeiten der Eltern vertrauen sollte.
Wie beurteilt Will Kymlicka die Bedeutung der Familie in einer liberalen Gesellschaft?
Kymlicka setzt sich intensiv mit den Thesen von Susan Moller Okin auseinander, die die Familie als Hauptursache für die Ungleichheit der Geschlechter sieht. Kymlicka diskutiert Fragen der Gleichberechtigung der Frau, nicht-traditionelle Beziehungsformen und die Regulierung der Ehe durch Verträge. Er befürwortet zwar Okins Forderungen nach einer stärkeren Berücksichtigung der Familie in Gerechtigkeitstheorien, plädiert aber im Gegensatz zu Rawls für eine striktere Regelung der ehelichen Beziehung und der Kindererziehung, einschließlich der Idee einer Elternlizenz.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen Rawls und Kymlicka in Bezug auf die Familie?
Der wesentlichste Unterschied liegt in der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Familie. Rawls betrachtet die Familie im gesamtgesellschaftlichen Kontext, während Kymlicka stärker auf einzelne Details der Familienstrukturen eingeht. Rawls befürwortet eine weitgehende Handlungsfreiheit innerhalb der Familie, während Kymlicka staatliche Eingriffe, wie z.B. die Einführung einer Elternlizenz, für gerechtfertigt hält, um stabilere Familien zu erzeugen und Kinder zu schützen. Auch in Bezug auf die Bedeutung der Familienform gibt es Unterschiede, wobei Rawls und Kymlicka offener für nicht-traditionelle Formen sind als Okin.
Welche Kritik wird an den Positionen von Rawls und Kymlicka geübt?
Kritisiert wird Kymlickas Befürwortung einer Elternlizenz, da die Kriterien für die Vergabe willkürlich wären und die freie Entfaltung der Kinder einschränken könnten. Rawls' Ansatz wird als zu wenig eingreifend kritisiert, da er die bestehenden Ungleichheiten innerhalb der Familie möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt. Es wird argumentiert, dass die Gleichstellung der Frau innerhalb der Familie der vollkommenen gesellschaftlichen und politischen Gleichberechtigung der Frau vorausgehen muss.
Welche Schlussfolgerung wird in Bezug auf die Familie in einer liberalen Gesellschaft gezogen?
Es wird argumentiert, dass einer Familie in einer liberalen Gesellschaft ausreichend individueller Spielraum gelassen werden muss, da die Gesellschaft sonst ihren liberalen Charakter verlieren würde. Gleichzeitig muss die Wahrung und der Schutz der Grundrechte aller Familienmitglieder gewährleistet sein. Weitergehende Beschränkungen, wie sie von Kymlicka befürwortet werden, werden als kontraproduktiv angesehen, da sie die individuelle Erziehung der Kinder und die freie Entfaltung der Persönlichkeit beeinträchtigen könnten.
- Quote paper
- Bertil Starke (Author), 2004, Gerechtigkeit inner- und außerhalb der Familie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110204