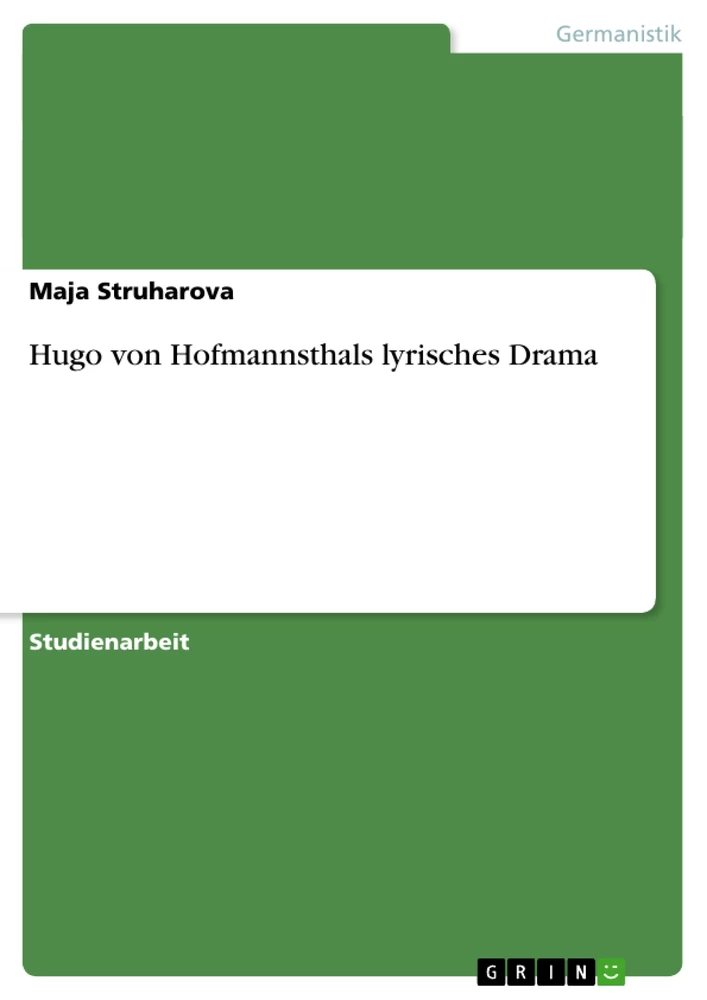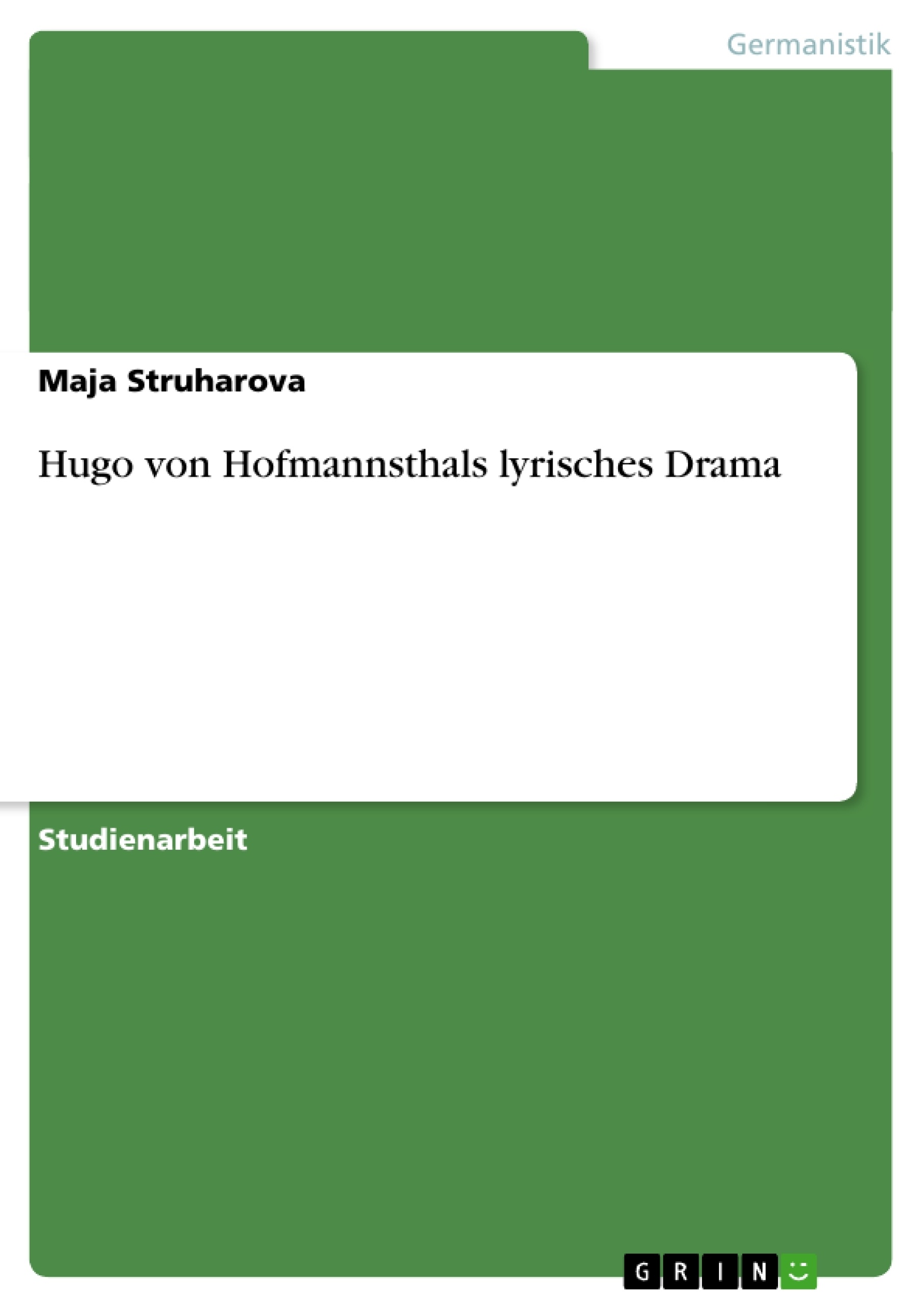Was bedeutet es, am Leben vorbeizuleben, gefangen in den Mauern der eigenen Unfähigkeit zur Hingabe? Hugo von Hofmannsthals Der Tor und der Tod und Der Tod des Tizian sind weit mehr als bloße Theaterstücke; sie sind Seelenlandschaften, in denen die Grenzen zwischen Leben und Kunst, Sein und Schein auf faszinierende Weise verschwimmen. Tauchen Sie ein in die Welt des Claudio, des Ästheten, der sich in seiner selbstgewählten Isolation verliert, unfähig, die wahren Freuden und Leiden des Lebens zu erfahren. Erleben Sie den Todeskampf des Tizian, umgeben von einer Schar von Jüngern, die in der Kunst eine höhere Form des Lebens suchen, doch von der Pest des Vergänglichen nicht verschont bleiben. Diese beiden Einakter, Meisterwerke des lyrischen Dramas, sind eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Fragen der Existenz, der Kunst und der Sterblichkeit. Hofmannsthals poetische Sprache, reich an Symbolik und musikalischem Klang, entführt den Leser in eine Sphäre der Kontemplation, in der Monologe die inneren Kämpfe der Figuren offenbaren und Dialoge die fragile Oberfläche ihrer Beziehungen erahnen lassen. Entdecken Sie, wie Hofmannsthal die Elemente von Lyrik und Drama meisterhaft vereint, um eine Welt zu erschaffen, in der die Schönheit der Kunst und die Tragik des Lebens untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Dramen sind ein Muss für jeden Liebhaber der klassischen Literatur, der sich auf eine introspektive Reise begeben und über die Bedeutung eines erfüllten Lebens nachdenken möchte. Begleiten Sie Claudio auf seiner Suche nach Erlösung und Tizian auf seinem letzten Weg, und lassen Sie sich von der zeitlosen Relevanz dieser Werke berühren. Erforschen Sie die Kritik am Ästhetizismus, die in diesen Dramen zum Ausdruck kommt, und stellen Sie sich die Frage, ob ein Leben, das ausschließlich der Kunst gewidmet ist, wirklich ein erfülltes Leben sein kann. Analysieren Sie die Charaktere, die Typen des Ästheten und des Toren verkörpern, und lassen Sie sich von ihrer Tragik und ihrer Weisheit inspirieren. Tauchen Sie ein in Hofmannsthals Welt, wo die Sprache zur Musik wird und die Bühne zum Spiegel der Seele. Erleben Sie, wie die Grenzen zwischen den Künsten verschwimmen und eine einzigartige ästhetische Erfahrung entsteht. Dies ist mehr als nur eine Lektüre; es ist eine Begegnung mit den großen Fragen der Menschheit.
Hugo von Hofmannsthals lyrisches Drama
Maja Struhar
III. Studienjahr
Novi Sad, den 26.4.2006
Das lyrische Drama der Moderne entstand im Symbolismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Die antinaturalistischen Strömungen der Zeit (Ästhetizismus, Dècadence, Jugendstil u.a.) haben aus unterschiedlichen Gründen zu dieser Gattung eine besondere Affinität entwickelt. Eben in dieser Zeit treten Hofmannsthals Bemühungen um das Drama in ein neues Stadium. Seine lyrischen Dramen sind: Gestern, Der Tor und der Tod, Der Kaiser und die Hexe, Der Tod des Tizian, Das kleine Welttheater, Der Abenteuer und die Sängerin, Das Bergwerk zu Falun, Weißen Fächer, Die Frau im Fenster, Die Hochzeit der Sobeide. Diese Dramen haben alle hier und da eine Aufführung erlebt, aber sie sind primär für die Lektüre oder den Vortrag geschaffen.
Die weiteren Vertreter dieser Gattung sind: Stèphane Mallarmè (Hèrodiade), Maurice Maeterlinck (L’Intruse, Les Aveugles), Rainer Maria Rilke (Die weiße Fürstin), William Butler Yeats (The Shadowy Waters, Deirdre).
Der Begriff lyrisches Drama hat in der deutschen Theatergeschichte zwei Bedeutungen: Einerseits sind lyrische Dramen im 18. Jahrhundert Textvorlagen für die Vertonung, dienen also als Grundlage für eine Oper oder ein Singspiel mit melodramatischen Themen, die das Gefühl stark in den Vordergrund stellen, so z.B. Goethes Proserpina.
Andererseits versteht man unter der Bezeichnung lyrisches Drama ein sehr handlungsarmes Schauspiel, das sich durch eine lyrisch-stilisierte Sprache auszeichnet und meist durch den Monolog einer Hauptperson tief in seelische Zustände blicken lässt.[1] Man begegnet hier keiner verwickelten dramatischen Handlung und keinen entschlossen agierenden Protagonisten.[2] Die formalen Kennzeichen des lyrischen Dramas sind: die Bevorzugung der dramatischen Kleinformen, die bloße Reihung von Monologen und die klangvolle Musikalität der dichterischen Sprache. Diese Dramen bedienen sich gerne der Form des Einakters.[3]
Nach Edgar Herderer beschreiben die lyrischen Dramen eine Art, in der Welt zu sein, die Traum ist, Schwebe vor der Existenz. Ohne äußere Aktion, ohne sich einem Du zu lassen, nichts ausschließend und nichts entscheidend, dem Schicksal entrückt, über allen Gegensätzen und ungebunden lebt der Träumer mit seiner gern gehorchenden Welt und weiß vor aller Erfahrung.[4] Nach Wolfgang Nehring verbindet sich in lyrischen Dramen die lyrische Bewußtseinshaltung des Dichters mit den theatralischen Mitteln von Dialog, Kostüm und Bewegung zu dramatischen Dichtungen, die in ihrer Art einzig in der deutschen Literatur dastehen.[5]
Die beiden Dramen, die hier behandelt werden, also Der Tod des Tizian und Der Tor und der Tod, enthalten sowohl lyrische als auch dramatische Elemente und beide sind Einakter. Geht man von der genannten Definition des lyrischen Dramas aus, so kann man sehr wenig Handlung und Aktion in beiden Dramen bemerken. Gerade dieser Mangel an Handlung ist für die Lyrik charakteristisch. Doch, es geht zweifellos um Dramen, weil sie die klassischen formalen Elemente eines Dramas haben: am Anfang steht das Personenverzeichnis, es gibt Dialoge zwischen Personen z.B.:
„ Batista Er schläft?
Gianino Nein, er ist wach und phantasiert
Und hat die Staffelei begehrt.
Antonio Allein
Man darf sie ihm nicht geben, nicht wahr, nein?
Gianino Ja, sagt der Arzt, wir sollen ihn nicht quälen
Und geben, was er will, in seine Hände.“[6] ;
und Regieanweisungen wie:
„Die Diener sind indessen über die Bühne gegangen, an der Treppe holt sie der Page ein. Tizianello geht auf den Fußspitzen, leise den Vorhang aufhebend, hinein. Die anderen gehen unruhig auf und nieder.“[7]
Die Zeit und der Ort der Handlung sind in beiden Dramen angegeben, was die nächste Charakteristik des Dramas ist, aber es fehlt der klassische Handlungsverlauf, der aus Exposition, Komplikation, Höhepunkt, Umschwung und Auflösung besteht. Schon am Anfang weiß der Leser, wie die Dramen enden werden-mit dem Tod der Hauptfigur-weil das schon der Titel andeutet. Aus diesem Grund besteht keine dramatische Spannung.
Eine weitere Charakteristik der Lyrik stellt die Sprache dar. Der Text der beiden Dramen ist keine Prosa, sondern ein lyrischer Text, der die traditionellen Merkmale eines Liedes hat: Vers, Reim und Metrum. Das kann man an folgenden Beispielen sehen:
„Jetzt ist er wieder ruhig, und es strahlt
Aus seiner Blässe, und er malt und malt.
In seinen Augen ist ein guter Schimmer.
Und mit Mädchen plaudert er wie immer.“[8]
Hier geht es um Paarreim und in der folgenden Strophe um Kreuzreim:
„Jetzt zünden sie die Lichter an und haben
In engen Wänden eine dumpfe Welt
Mit allen Rausch-und Tränengaben
Und was noch sonst ein Herz gefangenhält.“[9]
Die linguistischen Merkmale der poetischen Sprache, d.h. die poetischen Satzkonstruktionen und die rhetorischen Figuren lassen sich durch folgende Beispiele darstellen:
-poetische Satzkonstruktionen: „Und wie des Dunkles leiser Atemzug
Den Duft des Gartens um die Stirn mir trug...“[10]
Oder: „Er sprach schon früher, was ich nicht verstand,
Gebietend ausgestreckt die blasse Hand“[11]
-rhetorische Figuren: Epitheton: die schlanke Schönheit; das tote, taube, dürre Weitersein. Metapher: Jetzt rückt der goldne Ball und er versinkt/In fernster Meere grünlichem Kristall; der leise Puls des stummen Lebens schlägt. Personifikation: ihn martert jeder Pulsschlag; es erwachten schwere Harmonien. Vergleich: Da schwebte durch die Nacht ein süßes Tönen/als hörte man die Flöte leise stöhnen; Unendlich Hoffen scheints zu sein/Als strömte von den alten, stillen Mauern/Mein Leben flutend und verklärt herein. Methonymie: wohl schlief die Stadt. Apostrophe: Ihr Becher; Ihr alten Lauten.
Obwohl es schon angegeben wurde, dass die Dramen Dialoge enthalten, muss man betonen, dass es mehr Monologe gibt. „Das Sprechen der Figuren ist überwiegend monologisch; sie sagen sich selber aus, ohne einem Partner zu begegnen oder in den anderen Gestalten wirkliche Partner zu erkennen.“[12] Hier ein Beispiel:
„ Paris ebenso Das ist die Lehre der verschlungenen Gänge.
Batista ebenso Das ist die große Kunst des Hintergrundes
Und das Geheimnis zweifelhafter Lichter.
Tizianello mit geschlossenen Augen
Das macht so schön die halbverwehten Klänge,
So schön die dunklen Worte toter Dichter
Und alle Dinge, denen wir entsagen.
Paris Das ist der Zauber auf versunknen Tagen
Und ist der Quell des grenzenlosen Schönen,
Denn wir ersticken, wo wir uns gewöhnen.“[13]
Für die Lyrik ist auch der Ausdruck von Gefühlen, von Subjektivität charakteristich. Diese Merkmale findet man auch in diesen zwei Dramen. Claudio leidet, weil er sich nicht hingeben kann. Er redet über seine Gefühle:
„Es scheint mein ganzes so versäumtes Leben
Verlorne Lust und nie geweinte Tränen
Um diese Gassen, dieses Haus zu weben
Und ewig sinnlos Suchen, wirres Sehnen.“
Und: „Ich hab von allen lieben Lippen
Den wahren Trank des Lebens nie gesogen,
Bin nie von wahrem Schmerz durchschüttert,
Die Straße einsam, schluchzend, nie! gezogen.
Wenn ich von guten Gaben der Natur
Je eine Regung, einen Hauch erfuhr,
So nannte ihn mein überwacher Sinn
Unfähig des Vergessens, grell beim Namen
Und wie dann tausende Vergleiche kamen,
War das Vertrauen, war das Glück dahin.
Und auch das Leid! zerfasert und zerfressen
Vom Denken, abgeblaßt und ausgelaugt!“[14]
Tizianello sagt über seinen Schmerz Folgendes:
„Als ob der Schmerz denn etwas anders wär
Als dieses ewige Dran-denken-Müssen,
Bis es am Ende farblos wird und leer...
So laß mich nur in den Gedanken wühlen,
Denn von den Leiden und von den Genüssen
Hab längst ich abgestreift das bunte Kleid,
Das um sie webt die Unbefangenheit,
Und einfach hab ich schon verlernt zu fühlen.“[15]
Die Figuren in diesen Hofmannsthals Dramen sind keine Individuen, sondern Typen. Ihre individuellen Eigenschaften sind nicht wichtig; sie sollen nur die Botschaft des Autors übertragen. Der Autor wollte den Ästhetizismus kritisieren, also er hat den Typ des Ästheten gestaltet. „Claudio ist der Typus des bloß zuschauenden Ästheten, der sich nie voll dem Leben hingibt, der im Genusse der Kunst den Genuss des Lebens verloren hat, der nicht das Leben durch die Kunst steigert und erhöht, sondern vielmehr in der Kunst allein lebt.“[16] Alle Figuren in Der Tod des Tizian sind auch Ästheten. Richard Alewyn beschreibt sie folgendermaßen: „Ästheten nannten sie sich, und l’art pour l’art schrieben sie auf ihre Fahnen [...]. Es war die Kunst, die sie von dem gemeinen Leben trennte und über die gewöhnlichen Menschen erhob, es war die Kunst, die sie mit köstlichen Gnaden und überschwenglichen Seligkeiten belohnte-Vorrechte freilich, für die sie auch wiederum mit ungewöhnlichen Leiden zu zahlen hatten.“[17]
Die ganze Zweideutigkeit eines Lebens, das allein auf das Ästhetische gestellt wurde, wird in den Dramen schonungslos enthüllt. Claudio hat versucht, sich durch die Kunst ins Leben einweihen zu lassen. Er hat sich umgeben mit alten, edlen Dingen: Bildern, Figuren und Geräten. Er sagt:
„Ich hab mich so an Künstliches verloren
Dass ich die Sonne sah aus toten Augen
Und nicht mehr hörte als durch tote Ohren.“[18]
Geht man von der Behauptung aus, dass der Autor den Ästhetizismus kritisieren wollte, so kann man Herderers Worte benutzen und sagen: „Hofmannsthals Plan war es [in Tod des Tizian], in die Atmosphäre der von der Kunst trunkenen Epigonen die Pest einbrechen zu lassen, mit Leiden und Tod den üppigen Wahn zu zerstören.“[19] Doch, das Werk blieb fragmentarisch und die Schüler Tizians sind von der Nähe des Todes verschont geblieben.
Die Hauptfigur des Dramas Der Tor und der Tod, Claudio, ist nicht nur der Typ des Ästheten, sondern auch der Typ des Toren. Die Figur des Toren beschreibt Alewyn folgendermaßen: „Der wahre Schmerz ist ihm so sehr versagt wie die tiefe Lust, des Hassens ist er sowenig fähig wie des Liebens, des Bösen sowenig wie des Guten. […] Aus Angst, sich zu verlieren, hat er sich nie hingegeben und eben darum sich auch nie wahrhaft wiederempfangen. […] Unfähig, etwas zu erleben, weder ein Ding noch ein Du, unfähig zu handeln, unfähig auch nur zu genießen, lebt er ohne Welt und ohne Schicksal in dem Kerker seines Ich dahin. Das schöne Leben verkehrt sich aus einem Segen in einen Fluch.“[20] Claudio leidet und sein Leiden ist das ungelebte Leben. Er beschließt den Tag in müder Gleichgültigkeit. Er selbst sagt:
“Was weiß denn ich vom Menschenleben?
Bin freilich scheinbar drin gestanden,
Aber ich hab es höchstens verstanden,
Konnte mich nie darein verweben.
Hab mich niemals daran verloren.
Wo andre nehmen, andre geben,
Blieb ich beiseit, im Innern stummgeboren.“[21]
Die Lehre des Autors in diesem Drama hat Alewyn so verstanden: „Hätte er [Claudio] das Leben verstanden, dann hätte er den Tod verstanden. Dann wüsste er, dass das Leben ein solches ist, das mit dem Tod ein Ende hat, und dass es nur ein Ende hat und darum auch nur einen Anfang. Und dass, weil das Leben von seinem Anfang unaufhaltsam zu seinem Ende wächst, auch jedes Stück des Lebens unwiederholbar ist.“[22]
Diese Seminararbeit sollte darstellen, wie sich die lyrischen und die dramatischen Elemente in Hofmannsthals Dramen Der Tod des Tizian und Der Tor und der Tod mischen. Man kann bemerken, dass die Form und der Inhalt dieser zwei Dramen der am Anfang gennanten Definition des lyrischen Dramas entsprechen. Beide Dramen sind Einakter, beide sind arm an Handlung und an dramatischer Spannung. Ein weiteres lyrisches Element stellt die Sprache dar. Sie ist keine Prosa sondern eine lyrisch-stilisierte Sprache mit Vers, Reim, Metrum und mit den linguistischen Merkmalen wie rhetorischen Figuren und poetischen Satzkonstruktionen.
Das Sprechen der Figuren ist überwiegend monologisch und korrespondiert mit ihren Gefühlen und Gedanken. Die Figuren treten keinem wirklichen Partner gegenüber und dieser Mangel an Dialogen stellt auch der Mangel an dramatischen Konflikten dar. Das Drama sollte wesentlich aus Interaktion bestehen, die die Handlung in Gang setzt, aber hier fehlt die Interaktion und deshalb ist auch die Handlung so arm. Außerdem fehlt der klassische Handlungsverlauf, also Exposition, Komplikation, Höhepunkt, Umschwung und Auflösung. Der Ausdruck von Gefühlen, von Subjektivität ist ein weiteres Element, das für Lyrik charakteristisch ist, welches aber auch diese Hofmannsthals Dramen enthalten. Mit Hilfe der Monologe äußern die Figuren ihre Gefühle, ihre Hoffnungen, Ängste und Gedanken. So reden Tizians Schüler über ihre tiefe Trauer wegen des Todes ihres Lehrers und Vaters und so äußert Claudio seine Überlegungen über sein eigenes Leben.
Dass es doch um Dramen geht, beweisen die formalen Kennzeichen wie Personenverzeichnis am Anfang, Regieanweisungen und auch die wenigen Dialoge. Die Zeit und der Ort der Handlung sind auch gleich am Anfang angegeben. Die Figuren dieser Dramen sind Typen, keine Individuen, die die Lehre des Autors auf die Leser übertragen sollen. In Der Tod des Tizian geht es um den Typ des Ästheten und in Der Tor und der Tod genauso um diesen Typ aber auch um den Typ des Toren. Die zwei Typen des Ästheten sind aber nicht identisch. Sulger-Gebing ist der Meinung: „Auch er [Claudio] hat sich seine Welt gebaut außerhalb des Lebens und neben dem Leben, wie Tizian, aber nicht wie dieser über dem Leben und nicht wie dieser als eigenes höheres Leben schaffender Künstler; er hat seine Lebenszeit nur verträumt, und nun, da der unerbittliche letzte Gläubiger seine verfallene Schuld eintreiben will, nun sagt er: „Jetzt fühl’ ich-laß mich-dass ich leben kann!“[23] Die Kunst trennt die Ästheten von dem gemeinen Leben und von den gemeinen Menschen. In Der Tod des Tizian werden Künstler als Lehrer des Lebens und als das Höchste der Welt gepriesen. Claudio dagegen lebt in der Kunst allein. Er ist der Typ des bloß zuschauenden Ästheten und er sucht in den künstlichen Dingen nur eine Ersatzbefriedigung.
Die Figur des Claudio erscheint auch als Tor. Ein Tor ist unfähig, etwas zu erleben, unfähig zu handeln, zu genießen. Er lebt am Lebendigen vorbei und beschließt den Tag in müder Gleichgültigkeit. Schon die Zeitgenossen haben in diesem Drama den Dichter und die Probleme der eigenen Generation abgespielt gefunden. In Hofmannsthals Dramen sieht man seinen Versuch, die Probleme seiner Helden aber auch seiner Zeitgenossen zu lösen; denn auf Lösung von Konflikten zielt seine Dichtung von Anfang an, meint Wolfgang Nehring.[24] Claudio hat sein Leben verfehlt und dieses ungelebte Leben ist sein Leiden. Denn, nach Alewyn hat „Leben immer noch eine zweite Bedeutung, neben der vitalen eine moralische. Es handelt sich nicht nur um das Leben, das man ,hat’ (oder nicht hat), sondern auch um das Leben, das man führt. In diesem Lichte aber ist ungelebtes Leben nicht nur ein Leiden, sondern auch eine Schuld. Wer den ihm zugewiesenen Lebensraum unerfüllt gelassen hat, hat seine Aufgabe versäumt, und seine Krankheit ist nicht nur ein Symptom, sondern auch schon die Strafe.“[25]
Der Autor hat also in diesen zwei lyrischen Dramen sein Ziel erreicht. Er hat nämlich das nur auf das ästhetisch gegründete Leben kritisiert und an Claudios Beispiel gezeigt, wie man gestraft wird, wenn er sein Leben nicht genug schätzt. Hermann Bahr hatte Recht, als er sagte: „Will man ihn [Hofmannsthal] schon in ein ,Kastl’ stecken, so würde er eher zu den Moralisten gehören. Ich kenne kaum ein Vers von ihm, der nicht eine moralische Frage, eine moralische Sorge aussprechen würde.“[26]
Stichpunkte
- Lyrisches Drama-ein sehr handlungsarmes Schauspiel, das sich durch eine lyrisch-stilisierte Sprache auszeichnet und meist durch den Monolog einer Hauptperson tief in seelische Zustände blicken lässt.
- Die formalen Kennzeichen: die Bevorzugung der dramatischen Kleinformen, die bloße Reihung von Monologen und die klangvolle Musikalität der dichterischen Sprache.
- Hofmannsthals lyrische Dramen: Gestern, Der Tor und der Tod, Der Kaiser und die Hexe, Der Tod des Tizian, Das kleine Welttheater, Der Abenteuer und die Sängerin, Das Bergwerk zu Falun, Weißen Fächer, Die Frau im Fenster, Die Hochzeit der Sobeide.
- Das lyrische Drama der Moderne entstand im Symbolismus am Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Gegensatz zu den naturalistischen Milieudramen.
- Merkmale der Lyrik: arme Handlung
lyrischer, nicht Prosatext
(Vers, Reim, Metrum, rhetorische Figuren, poetische Satzkonstruktionen)
kein klassischer Handlungsverlauf
(Exposition, Komplikation, Höhepunkt, Umschwung und Auflösung)
keine dramatische Spannung
Ausdruck von Gefühlen, von Subjektivität
mehr Monologe als Dialoge
- Merkmale des Dramas: Personenverzeichnis
Dialoge
Regieanweisungen
Zeit und Ort der Handlung angegeben
Figuren sind Typen→“Ästhet“
→“Tor“
→sollen die Lehre des Autors übertragen
Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Hofmannsthal, Hugo von: Ausgewählte Werke in zwei Bänder. Bd.1: Gedichte und Dramen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1957.
http://gutenberg.spiegel.de/hofmanns/tor_tod/tor_tod.htm (26.10.2005)
Sekundärliteratur:
Alewyn, Richard: Über Hugo von Hofmannsthal. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1958.
Herderer, Edgar: Hugo von Hofmannsthal. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1960.
Hinck, Walter (Hg): Handbuch des deutschen Dramas. August Bagel Verlag, Düsseldorf, 1980.
Kohlschmidt, Werner; Mohr, Wolfgang (Hg): Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Bd.2. Walter de Gruyter&Co., Berlin, 1965.
Steinecke, Hartmut (Hg): Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1996.
Sulger-Gebing, Emil: Hugo von Hofmannsthal. Eine literarische Studie. Max Hesses Verlag, Leipzig, 1905.
www.uni-essen.de (26.10.2005)
www.ruhr-uni-bochum.de (26.10.2005)
[...]
[1] Vgl. www.uni-essen.de (26.10.2005)
[2] Vgl. www.ruhr-uni-bochum.de (26.10.2005)
[3] Vgl. Werner Kohlschmidt und Wolfgang Mohr (Hg.): Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte. Bd. 2. Walter de Gruyter&Co., Berlin, 1965, S. 253.
[4] Vgl. Edgar Herderer: Hugo von Hofmannsthal. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1960, S.108.
[5] Vgl. Walter Hinck (Hg): Handbuch des deutschen Dramas. August Bagel Verlag, Düsseldorf, 1980, S. 344.
[6] Hugo von Hofmannsthal: Ausgewählte Werke in zwei Bänder. Bd.1: Gedichte und Dramen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1957, S. 59.
[7] Ebd., S. 60.
[8] Hugo von Hofmannsthal: Ausgewählte Werke in zwei Bänder. Bd.1: Gedichte und Dramen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1957, S. 61.
[9] http://gutenberg.spiegel.de/hofmanns/tor_tod/tor_tod.htm (26.10.2005)
[10] Hugo von Hofmannsthal: Ausgewählte Werke in zwei Bänder. Bd.1: Gedichte und Dramen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1957, S. 62.
[11] Ebd., S. 61.
[12] Hartmut Steinecke(Hg.): Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1996, S. 104.
[13] Hugo von Hofmannsthal: Ausgewählte Werke in zwei Bänder. Bd.1: Gedichte und Dramen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1957, S. 64.
[14] http://gutenberg.spiegel.de/hofmanns/tor_tod/tor_tod.htm (26.10.2005)
[15] Hugo von Hofmannsthal: Ausgewählte Werke in zwei Bänder. Bd.1: Gedichte und Dramen. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1957, S. 64-65.
[16] Emil Sulger-Gebing: Hugo von Hofmannsthal. Eine literarische Studie. Max Hesses Verlag, Leipzig, 1905, S. 53.
[17] Richard Alewyn: Über Hugo von Hofmannsthal. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1958, S. 65.
[18] http://gutenberg.spiegel.de/hofmanns/tor_tod/tor_tod.htm (26.10.2005)
[19] Edgar Herderer: Hugo von Hofmannsthal. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1960, S. 112.
[20] Vgl. Richard Alewyn: Über Hugo von Hofmannsthal. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1958, S.68.
[21] http://gutenberg.spiegel.de/hofmanns/tor_tod/tor_tod.htm (26.10.2005)
[22] Richard Alewyn: Über Hugo von Hofmannsthal. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1958, S.72.
[23] Emil Sulger-Gebing: Hugo von Hofmannsthal. Eine literarische Studie. Max Hesses Verlag, Leipzig, 1905, S. 55.
[24] Hartmut Steinecke(Hg.): Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1996, S. 105.
[25] Richard Alewyn: Über Hugo von Hofmannsthal. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen, 1958, S. 71.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Analyse von Hofmannsthals lyrischen Dramen?
Diese Analyse konzentriert sich auf die lyrischen und dramatischen Elemente in Hugo von Hofmannsthals Dramen "Der Tod des Tizian" und "Der Tor und der Tod". Sie untersucht, wie sich diese Elemente vermischen und wie sie zur Gesamtbedeutung der Werke beitragen.
Was sind die Merkmale eines lyrischen Dramas?
Ein lyrisches Drama ist ein Schauspiel mit wenig Handlung, das sich durch eine lyrisch-stilisierte Sprache auszeichnet und oft den Monolog einer Hauptperson nutzt, um tiefe seelische Zustände zu erkunden. Formale Kennzeichen sind kurze dramatische Formen, eine Reihe von Monologen und eine klangvolle, musikalische Sprache.
Welche lyrischen Dramen hat Hofmannsthal geschrieben?
Hofmannsthal verfasste eine Reihe lyrischer Dramen, darunter "Gestern", "Der Tor und der Tod", "Der Kaiser und die Hexe", "Der Tod des Tizian", "Das kleine Welttheater", "Der Abenteuer und die Sängerin", "Das Bergwerk zu Falun", "Weißen Fächer", "Die Frau im Fenster" und "Die Hochzeit der Sobeide".
Wie entstand das lyrische Drama der Moderne?
Das lyrische Drama der Moderne entstand im Symbolismus am Ende des 19. Jahrhunderts als Gegenbewegung zu den naturalistischen Milieudramen.
Was sind die Merkmale von Lyrik, die in diesen Dramen vorkommen?
Die lyrischen Elemente in "Der Tod des Tizian" und "Der Tor und der Tod" umfassen eine arme Handlung, lyrische Texte anstelle von Prosa (mit Versen, Reim, Metrum, rhetorischen Figuren und poetischen Satzkonstruktionen), keinen klassischen Handlungsverlauf (Exposition, Komplikation, Höhepunkt, Umschwung und Auflösung), keine dramatische Spannung, den Ausdruck von Gefühlen und Subjektivität sowie mehr Monologe als Dialoge.
Was sind die dramatischen Merkmale in diesen Dramen?
Die dramatischen Elemente umfassen ein Personenverzeichnis, Dialoge (obwohl begrenzt), Regieanweisungen, die Angabe von Zeit und Ort der Handlung und Figuren, die eher Typen (wie der Ästhet oder der Tor) als Individuen sind, um die Lehre des Autors zu vermitteln.
Welche Rolle spielt der Ästhetizismus in Hofmannsthals Dramen?
Hofmannsthal kritisiert den Ästhetizismus in seinen Dramen. Die Figuren, insbesondere Claudio in "Der Tor und der Tod", verkörpern den Typus des Ästheten, der sich vom Leben entfremdet hat und in einer künstlichen Welt lebt. Die Dramen enthüllen die Ambivalenz eines Lebens, das nur auf Ästhetik basiert.
Wer ist Claudio in "Der Tor und der Tod"?
Claudio ist die Hauptfigur in "Der Tor und der Tod". Er ist ein Ästhet, aber auch ein Tor, unfähig, das Leben wirklich zu erleben. Er hat sich nie ganz dem Leben hingegeben, sich nie verloren, sich nie in die Welt eingewoben. Dies führt zu seinem Leiden und dem Gefühl eines ungelebten Lebens.
Was ist die Botschaft von Hofmannsthal in diesen Dramen?
Hofmannsthal kritisiert das Leben, das nur auf dem Ästhetischen basiert, und zeigt an Claudios Beispiel, wie man bestraft wird, wenn man das Leben nicht genügend schätzt. Er betont die Bedeutung des Engagements im Leben und der Anerkennung der eigenen Sterblichkeit.
Welche Sekundärliteratur wird für diese Analyse verwendet?
Für diese Analyse wurden unter anderem Werke von Richard Alewyn, Edgar Herderer, Walter Hinck, Werner Kohlschmidt, Wolfgang Mohr, Hartmut Steinecke und Emil Sulger-Gebing verwendet.
- Quote paper
- Maja Struharova (Author), 2006, Hugo von Hofmannsthals lyrisches Drama, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110148