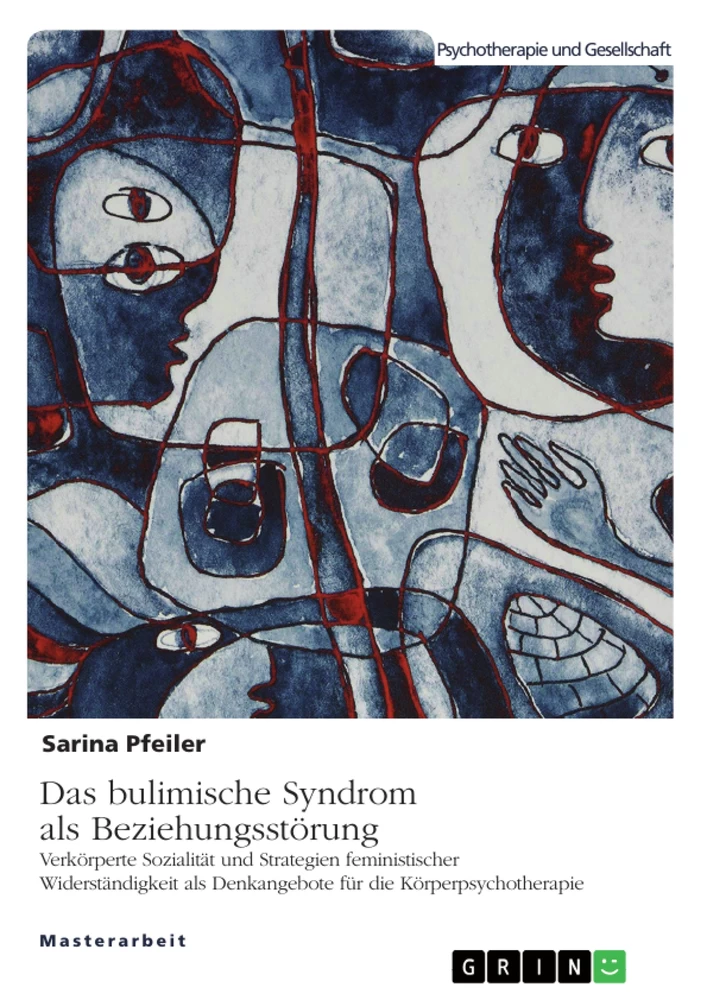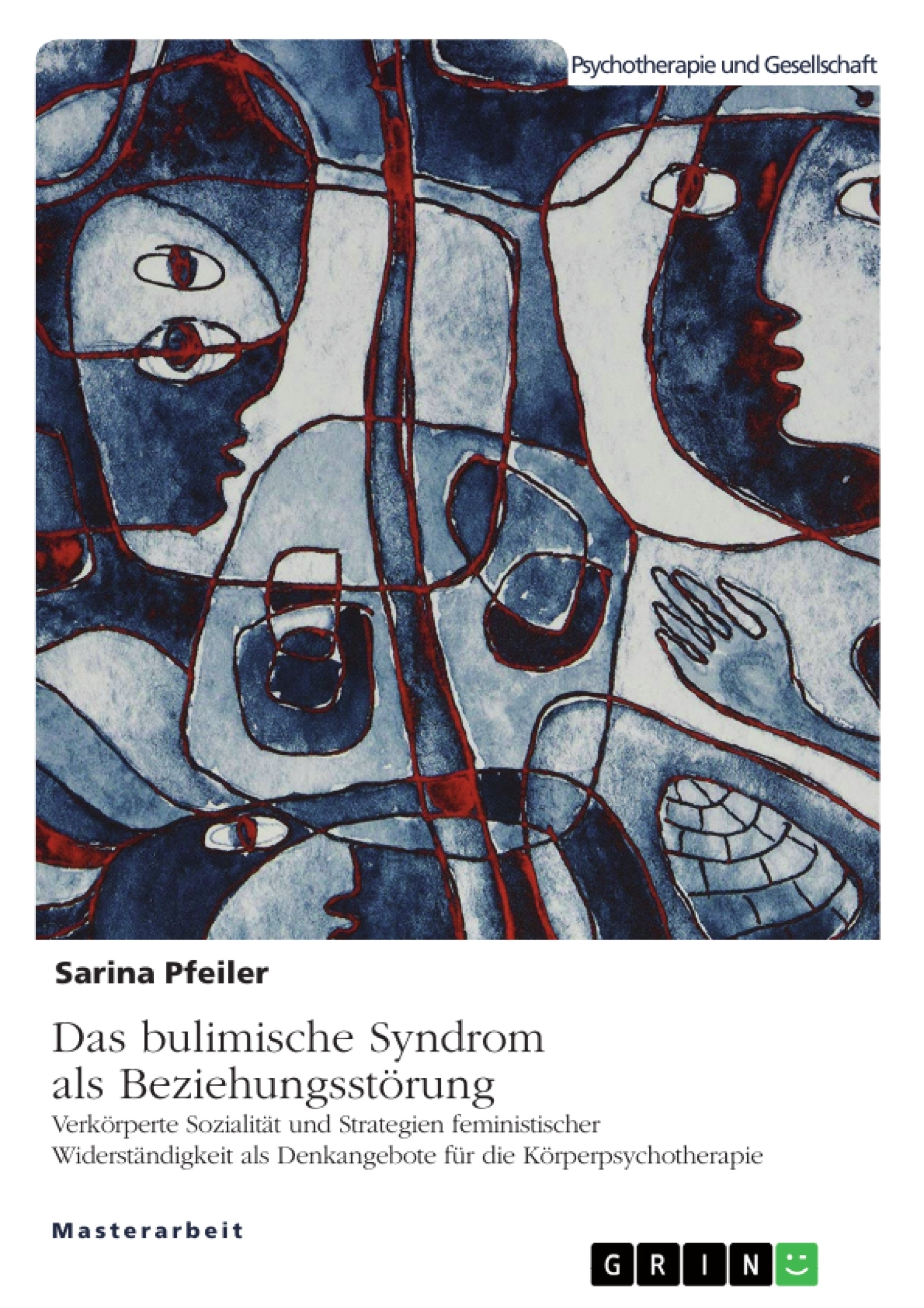Ist die Bulimie eine Beziehungsstörung, die feministischen Widerstand übt? In dieser Masterarbeit wird das bulimische Syndrom als Beziehungsstörung zum Selbst, zum eigenen Körper sowie zu anderen Menschen betrachtet. Dafür wird die Frage gestellt, inwiefern das Syndrom in den Kontext verkörperter Sozialität gestellt und als feministische Widerständigkeit gedeutet werden kann. Durch eine psychodynamisch informierte Perspektive wird das Syndrom als Kompensation intrusiver Verletzung narzisstischer Integrität von Frauen* interpretiert. Die Genderspezifität des Syndroms wird in den Kontext gesellschaftlich bedingter weiblicher* Verletzbarkeit, Abhängigkeit und selektiver Unterdrückungsdynamiken gesetzt.
Dafür werden zum einen psychodynamische Internalisierungsprozesse dargestellt und verkörperte Einschreibungen des Sozialen angenommen. Zum anderen wird das Syndrom als Strategie feministischer Widerständigkeit gegenüber gesellschaftlich normalisierter gewaltvoller Beziehungsgestaltung dechiffriert. Gleichzeitig werden die Erkenntnisse als Denkangebote für die Körperpsychotherapie aufgezeigt. Diese Masterarbeit richtet sich an Menschen, die (körperpsycho-)therapeutisch arbeiten und forschen, sowie an solche, die an der Schnittstelle zwischen Körper(-ausdruck) und Sozialität (akademisch) interessiert sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Psychiatrische Kriterien des bulimischen Syndroms
- 2.1. Diagnostische Einordnung
- 2.2. Prävalenz und Epidemiologie
- 2.3. Komorbidität
- 2.4. Verlauf und Remission der Bulimie
- 3. Die psychodynamische Spezifität des bulimischen Syndroms
- 3.1. Kriterium A: Der Essanfall
- 3.2. Kriterium B: Unangemessene Kompensation - Erbrechen
- 3.3. Die „Bulimie-Familie“ und das rigide Kindimago
- 3.4. Die Bulimie als Beziehungsstörung
- 4. Verkörperte Sozialität
- 4.1. Das bulimische Syndrom als weibliche (Über-)Lebensstrategie
- 4.2. Wandelnde Erwartungshaltung gegenüber der weiblichen* Geschlechtsrolle im 20. Jahrhundert
- 4.3. Internalisierte Sozialität im Rahmen der Konfliktverarbeitung nach Focks
- 4.4. Die vergeschlechtlichte Flucht vor Verletzbarkeit bei Bergoffen
- 4.5. Die Bulimie als Reaktion auf weibliche Abhängigkeit
- 5. Die Bulimie als feministischer Widerstand
- 5.1. Die Beziehungsstörung – Aufbegehren als feministische Widerständigkeit
- 5.2. Leibliche Selbstbehauptung und Sprache des Leibes
- 6. Denkangebote für die Körperpsychotherapie als Ausblick
- 6.1. Verkörperte Sozialität in der KPT
- 7. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das bulimische Syndrom als Beziehungsstörung, indem sie die Beziehung des Individuums zu sich selbst, seinem Körper und anderen Menschen in den Fokus stellt. Die Arbeit erforscht den Zusammenhang zwischen Bulimie und verkörperter Sozialität und interpretiert das Syndrom unter feministischen Aspekten als mögliche Widerstandsstrategie. Die psychodynamischen Prozesse und gesellschaftlichen Einflüsse auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Bulimie werden beleuchtet.
- Das bulimische Syndrom als Beziehungsstörung
- Verkörperte Sozialität und Bulimie
- Bulimie als feministische Widerstandsstrategie
- Psychodynamische Interpretation des Syndroms
- Implikationen für die Körperpsychotherapie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Masterarbeit ein und skizziert die Forschungsfrage, welche die Beziehung zwischen dem bulimischen Syndrom, verkörperter Sozialität und feministischer Widerständigkeit untersucht. Sie umreißt den methodischen Ansatz und die Zielsetzung der Arbeit.
2. Psychiatrische Kriterien des bulimischen Syndroms: Dieses Kapitel beschreibt die psychiatrischen Kriterien des bulimischen Syndroms gemäß DSM und ICD, einschließlich diagnostischer Einordnung, Prävalenz, Epidemiologie, Komorbidität und Verlauf. Es liefert die notwendigen medizinischen Grundlagen für die nachfolgende psychodynamische und sozialwissenschaftliche Analyse.
3. Die psychodynamische Spezifität des bulimischen Syndroms: Dieses Kapitel analysiert das bulimische Syndrom aus psychodynamischer Perspektive. Es betrachtet die Kriterien des Essanfalls und der unangemessenen Kompensation (Erbrechen) im Detail. Die „Bulimie-Familie“ und das rigide Kindimago werden als zentrale Einflussfaktoren untersucht, und das Syndrom wird als Beziehungsstörung interpretiert, die auf narzisstische Verletzungen reagiert.
4. Verkörperte Sozialität: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen dem bulimischen Syndrom und verkörperter Sozialität. Es analysiert das Syndrom als weibliche Überlebensstrategie im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen an Frauen und deren Abhängigkeit. Internalisierungsprozesse und die vergeschlechtlichte Flucht vor Verletzbarkeit werden diskutiert, und die Bulimie wird als Reaktion auf weibliche Abhängigkeit gedeutet.
5. Die Bulimie als feministischer Widerstand: Dieses Kapitel interpretiert das bulimische Syndrom als eine Form feministischen Widerstands gegen gesellschaftlich normalisierte Gewalt in Beziehungen. Es betrachtet die leibliche Selbstbehauptung und die „Sprache des Leibes“ als Ausdruck von Widerstand und Aufbegehren.
6. Denkangebote für die Körperpsychotherapie als Ausblick: Dieses Kapitel bietet Denkanstöße für die Körperpsychotherapie und integriert die Erkenntnisse der Arbeit in die therapeutische Praxis. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von verkörperter Sozialität in der Körperpsychotherapie.
Schlüsselwörter
Bulimisches Syndrom, Beziehungsstörung, Verkörperte Sozialität, Feministischer Widerstand, Körperpsychotherapie, Psychodynamik, Weibliche Verletzbarkeit, Gesellschaftliche Abhängigkeit, Internalisierungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Das bulimische Syndrom als Beziehungsstörung – Eine feministische Perspektive
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Arbeit untersucht das bulimische Syndrom umfassend, indem sie die Beziehung des Individuums zu sich selbst, seinem Körper und anderen Menschen in den Mittelpunkt stellt. Sie erforscht den Zusammenhang zwischen Bulimie, verkörperter Sozialität und feministischen Aspekten, interpretiert Bulimie als mögliche Widerstandsstrategie und beleuchtet psychodynamische Prozesse sowie gesellschaftliche Einflüsse auf Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit fokussiert auf das bulimische Syndrom als Beziehungsstörung, den Zusammenhang zwischen Bulimie und verkörperter Sozialität, Bulimie als feministische Widerstandsstrategie, die psychodynamische Interpretation des Syndroms und die Implikationen für die Körperpsychotherapie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, psychiatrische Kriterien des bulimischen Syndroms, psychodynamische Spezifität des Syndroms, verkörperte Sozialität, Bulimie als feministischer Widerstand, Denkangebote für die Körperpsychotherapie und Zusammenfassung/Ausblick. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik, beginnend mit den medizinischen Grundlagen und fortfahrend zu sozialwissenschaftlichen und psychodynamischen Interpretationen.
Welche psychiatrischen Aspekte der Bulimie werden betrachtet?
Kapitel 2 beschreibt die psychiatrischen Kriterien des bulimischen Syndroms gemäß DSM und ICD, einschließlich diagnostischer Einordnung, Prävalenz, Epidemiologie, Komorbidität und Verlauf. Es liefert die medizinischen Grundlagen für die anschließende Analyse.
Wie wird die Bulimie psychodynamisch interpretiert?
Kapitel 3 analysiert das bulimische Syndrom psychodynamisch, betrachtet die Kriterien des Essanfalls und der unangemessenen Kompensation (Erbrechen) im Detail und untersucht die „Bulimie-Familie“ und das rigide Kindimago als Einflussfaktoren. Das Syndrom wird als Reaktion auf narzisstische Verletzungen interpretiert.
Welche Rolle spielt die verkörperte Sozialität?
Kapitel 4 untersucht den Zusammenhang zwischen Bulimie und verkörperter Sozialität. Es analysiert das Syndrom als weibliche Überlebensstrategie im Kontext gesellschaftlicher Erwartungen an Frauen und deren Abhängigkeit. Internalisierungsprozesse und die vergeschlechtlichte Flucht vor Verletzbarkeit werden diskutiert.
Wie wird Bulimie im Kontext des Feminismus interpretiert?
Kapitel 5 interpretiert das bulimische Syndrom als feministischen Widerstand gegen gesellschaftlich normalisierte Gewalt in Beziehungen. Die leibliche Selbstbehauptung und die „Sprache des Leibes“ werden als Ausdruck von Widerstand und Aufbegehren betrachtet.
Welche Implikationen ergeben sich für die Körperpsychotherapie?
Kapitel 6 bietet Denkanstöße für die Körperpsychotherapie und integriert die Erkenntnisse der Arbeit in die therapeutische Praxis. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von verkörperter Sozialität in der Körperpsychotherapie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Bulimisches Syndrom, Beziehungsstörung, Verkörperte Sozialität, Feministischer Widerstand, Körperpsychotherapie, Psychodynamik, Weibliche Verletzbarkeit, Gesellschaftliche Abhängigkeit, Internalisierungsprozesse.
- Quote paper
- Sarina Pfeiler (Author), 2021, Das bulimische Syndrom als Beziehungsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1101166