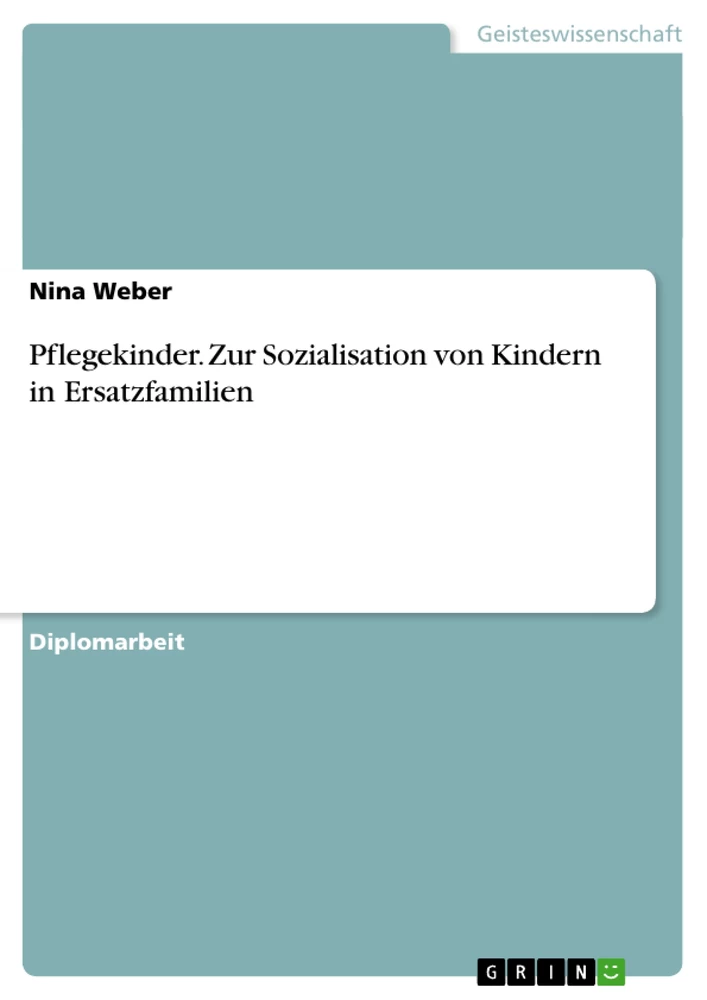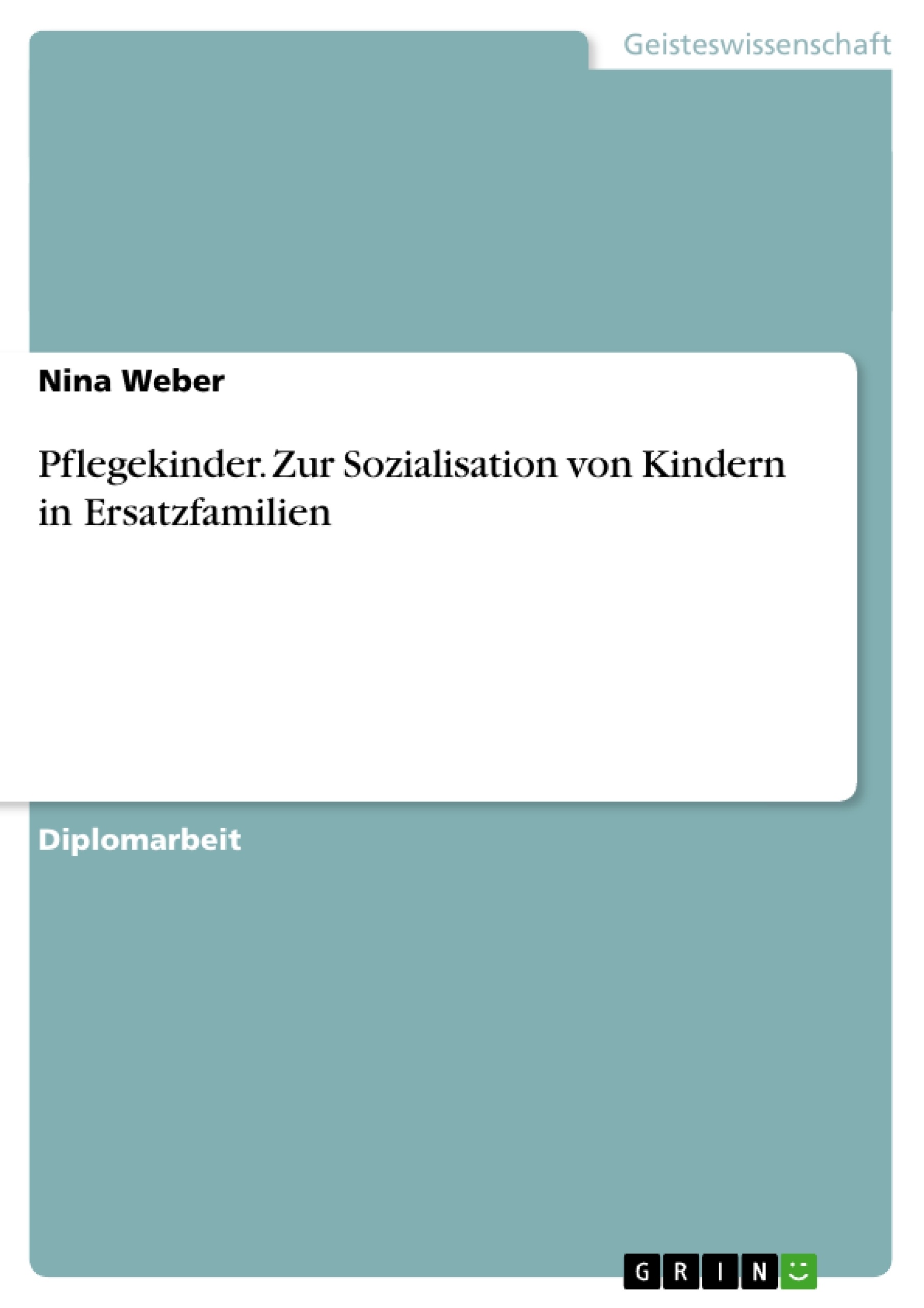Die vorliegende Arbeit beleuchtet die Sozialisation von Pflegekindern in Ersatzfamilien.
In diesem Zusammenhang ist die maßgebende Fragestellung der Diplomarbeit, welche Faktoren eine positive bzw. negative Sozialisation eines Kindes in einer Pflegefamilie beeinflussen. Ein solcher Faktor ist unter anderem das Handeln des Jugendamtes bzw. des Pflegekinderdienstes, insbesondere bei der Vorbereitung, Vermittlung und Unterstützung von leiblichen Eltern, Pflegekind und Pflegefamilie vor und während des Pflegeprozesses. Es wird untersucht, welche Einstellungen, Motivationen und Eigenschaften Pflegefamilien aufweisen sollten, die zum Gelingen einer guten Sozialisation in einer Pflegefamilie beitragen. Des weiteren geht die Arbeit darauf ein, welche Verhaltensweisen der Herkunftsfamilie die Sozialisation positiv oder negativ beeinflussen können. Untersuchungsziel ist es, herauszufinden welche von den einzelnen am Pflegeprozess beteiligten Personen ausgehenden Faktoren, auch in ihrem Zusammenspiel, zu einer positiven oder negativen Sozialisation eines Kindes in einer Pflegefamilie führen.
In Kapitel 2 wird zunächst auf die historische Entwicklung des Pflegekinderwesens seit dem Mittelalter unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung im 20. Jahrhundert eingegangen. Dabei wird deutlich, dass sich die Fremdplatzierung von Kindern seit langer Zeit in den zwei Grundformen der Pflegefamilienerziehung und der Anstalts- bzw. Heimerziehung vollzieht. Diese beiden Formen der Fremdunterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie sind ihrerseits jeweils einem stetigen Wandel unterlegen und standen, bzw. stehen in einem als Konkurrenz zu bezeichnenden Verhältnis zueinander. Die jeder der beiden Unterbringungsarten innewohnenden Vor- und Nachteile sowie die deren Abgrenzung voneinander lassen sich erst durch das Verständnis ihrer historischen Entwicklung umfassend begreifen. Aus diesem Grunde wurde die geschichtliche Entwicklung des Pflegekinderwesens der Darstellung der heutigen Situation vorangestellt.
Das dritte Kapitel dieser Arbeit befasst sich mit dem Gegenstandsbereich der Arbeit. Dieser besteht grundsätzlich allgemein in der Sozialisation von Pflegekindern in Ersatzfamilien. Besonderes Augenmerk wird jedoch auf Dauer- bzw. Vollzeitpflegeverhältnisse gelegt, da sich hierbei der Sozialisationsort des Pflegekindes vornehmlich in der Pflegefamilie befindet [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2 Historische Entwicklung des Pflegekinderwesens
- 2.1 Pflegefamilien als traditionelle Form der Fremdunterbringung
- 2.2 Familienpflege versus Anstaltserziehung
- 3. Gegenstandsbereich und Definitionen
- 3.1 Definition der Vollzeitpflege
- 3.2 Ergänzende Definitionen zur Vollzeitpflege
- 3.2.1 Definition des Pflegekindbegriffs
- 3.2.2 Definition der Begriffe Familienpflege, Pflegefamilie und Pflegeperson
- 3.2.3 Definition des Begriffs Pflegekinderwesen
- 3.3 Unterschiede zwischen Pflegekindschaft und Adoption
- 4. Statistische Daten zum Pflegekinderwesen
- 4.1 Pflegekinder in der Bundesrepublik Deutschland
- 4.2 Alter der Kinder bei der Inpflegegabe
- 4.3 Dauer von Pflegeverhältnissen
- 5. Rechtliche Grundlagen des Pflegekinderwesens
- 5.1 Grundlegende Rechte des Kindes und der Eltern
- 5.2 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz und die Vollzeitpflege
- 5.3 Die Vollzeitpflege gemäß § 33 KJHG
- 5.3.1 Mitwirkung der beteiligten Personen und Hilfeplanung
- 5.3.2 Zusammenarbeit, Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie und Pflegefamilie
- 5.3.3 Konsensarbeit bei der Ausübung der Personensorge
- 5.3.4 Pflegegeld
- 5.3.5 Krankenhilfe
- 5.3.5 Pflegeerlaubnis
- 5.4 Das Recht der Pflegekindschaft im Bürgerlichen Gesetzbuch
- 5.4.1 Die Unterbringung eines Kindes in einer Pflegefamilie
- 5.4.2 Das Entscheidungsrecht der Pflegeeltern in Angelegenheiten des täglichen Lebens; §1688 BGB
- 5.4.3 Übertragung von Angelegenheiten der elterlichen Sorge auf die Pflegeperson; § 1630 BGB
- 5.4.4 Schutz des Pflegekindes bei einem Herausgabeverlangen der leiblichen Eltern; § 1632 BGB
- 6. Aufgaben des Jugendamtes im Pflegekinderwesen
- 6.1 Organisation und Rahmenbedingungen
- 6.2 Gründe für eine Inpflegegabe
- 6.3 Indikation für die Unterbringung in einer Pflegefamilie
- 6.4 Erstellung und Überprüfung eines Hilfeplanes
- 6.5 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
- 6.6 Auswahl und Eignung von Pflegeeltern
- 6.7 Vorbereitung von Pflegefamilien
- 6.8 Vermittlung von Pflegekindern
- 6.9 Unterstützung und Beratung von Pflegeverhältnissen
- 6.10 Vorbereitung und Anbahnung einer Rückführung in die Herkunftsfamilie
- 6.11 Zusammenfassung
- 7. Die Sozialisation in der Pflegefamilie
- 7.1 Die Bedeutung der Familie im Sozialisationsprozess
- 7.1.1 Spezifische Vorteile der Pflegefamilienerziehung
- 7.1.2 (Pflege-) Familien im gesellschaftlichen Wandel
- 7.2 Die Situation der Pflegefamilie
- 7.2.1 Struktur und sozialer Status von Pflegefamilien
- 7.2.2 Motivation und Selbstkonzept der Pflegeeltern
- 7.2.3 Problematiken der Pflegeelternschaft
- 7.3 Die Situation der Herkunftsfamilie
- 7.4 Die Situation des Pflegekindes
- 7.5 Exkurs: Bindung und Trennung in der Kindheit
- 7.5.1 Die Bedeutung beständiger und kontinuierlicher Bindungen für das Gelingen der Frühsozialisation
- 7.5.2 Mutterentbehrung und Deprivation in der frühen Kindheit und ihre Auswirkungen auf die Sozialisation
- 7.6 Integration und Neuaufbau von Beziehungen in der Pflegefamilie
- 7.6.1 Gestaltung der Trennungssituation
- 7.6.2 Prozess der Integration in die Pflegefamilie
- 7.6.3 Erfolgreiches Handeln von Pflegepersonen
- 7.7 Beziehungen und Kontakte zu den Herkunftsfamilien
- 7.8 Ersatzfamilie versus Ergänzungsfamilie
- 7.9 Positive Bedingungen für das Gelingen eines Pflegeverhältnisses
- 7.1 Die Bedeutung der Familie im Sozialisationsprozess
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Sozialisation von Pflegekindern in Ersatzfamilien. Das Hauptziel ist die Identifizierung von Faktoren, die eine positive oder negative Sozialisation beeinflussen. Hierbei werden die Rolle des Jugendamtes, die Eigenschaften erfolgreicher Pflegefamilien und das Verhalten der Herkunftsfamilien berücksichtigt.
- Einfluss des Jugendamtes auf den Pflegeprozess
- Charakteristika erfolgreicher Pflegefamilien
- Auswirkungen des Verhaltens der Herkunftsfamilie auf die Sozialisation des Kindes
- Historische Entwicklung des Pflegekinderwesens
- Rechtliche Grundlagen der Vollzeitpflege
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sozialisation von Pflegekindern ein und formuliert die zentrale Forschungsfrage nach den Faktoren, die eine positive oder negative Sozialisation beeinflussen. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und hebt die Bedeutung der historischen Entwicklung und der rechtlichen Rahmenbedingungen hervor.
2 Historische Entwicklung des Pflegekinderwesens: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Pflegekinderwesens, unterscheidet zwischen Familienpflege und Anstaltserziehung und zeigt deren Konkurrenzverhältnis auf. Die Analyse der historischen Entwicklung liefert den Kontext für das Verständnis der heutigen Situation im Pflegekinderwesen und die jeweiligen Vor- und Nachteile der verschiedenen Unterbringungsformen.
3. Gegenstandsbereich und Definitionen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Vollzeitpflege, Pflegekind, Pflegefamilie und Pflegekinderwesen. Es legt den Fokus auf die Vollzeitpflege und berücksichtigt dabei insbesondere juristische Aspekte. Die präzisen Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der Fachterminologie und geben einen ersten Einblick in die Thematik.
4. Statistische Daten zum Pflegekinderwesen: Dieses Kapitel präsentiert statistische Daten zum Pflegekinderwesen in Deutschland, betrachtet das Alter der Kinder bei der Inpflegegabe und die Dauer der Pflegeverhältnisse. Diese Daten liefern wichtige quantitative Informationen zur aktuellen Situation im Pflegekinderwesen.
5. Rechtliche Grundlagen des Pflegekinderwesens: Dieses Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen des Pflegekinderwesens, insbesondere das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Es analysiert die Rechte von Kindern und Eltern, die Verfahren der Vollzeitpflege nach § 33 KJHG und den rechtlichen Schutz des Pflegekindes. Die detaillierte Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist essenziell für das Verständnis des gesamten Pflegeprozesses.
6. Aufgaben des Jugendamtes im Pflegekinderwesen: Dieses Kapitel beschreibt die Aufgaben des Jugendamtes im Pflegekinderwesen. Es beleuchtet die Organisation, die Gründe für Inpflegegaben, die Auswahl und Vorbereitung von Pflegeeltern sowie die Begleitung und Unterstützung der Pflegeverhältnisse. Der Fokus liegt auf der Rolle des Jugendamtes als zentrale Instanz im Pflegeprozess.
7. Die Sozialisation in der Pflegefamilie: Dieses Kapitel untersucht die Sozialisation von Pflegekindern innerhalb der Pflegefamilie. Es betrachtet die Bedeutung der Familie für den Sozialisationsprozess, die Situation der Pflege- und Herkunftsfamilien sowie die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration des Pflegekindes in die Pflegefamilie. Eine zentrale Rolle spielt hier die Bedeutung von Bindung und Trennung in der Kindheit.
Schlüsselwörter
Pflegekinder, Sozialisation, Ersatzfamilien, Familienpflege, Anstaltserziehung, Jugendamt, Pflegekinderdienst, Vollzeitpflege, Rechtliche Grundlagen, KJHG, BGB, Integration, Bindung, Trennung, Herkunftsfamilie, Pflegefamilie, Pflegeeltern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Sozialisation von Pflegekindern in Ersatzfamilien
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Sozialisation von Pflegekindern in Ersatzfamilien. Das zentrale Forschungsziel ist die Identifizierung von Faktoren, die eine positive oder negative Sozialisation beeinflussen. Die Arbeit berücksichtigt dabei die Rolle des Jugendamtes, die Eigenschaften erfolgreicher Pflegefamilien und das Verhalten der Herkunftsfamilien.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine umfassende Auseinandersetzung mit der Sozialisation von Pflegekindern, einschließlich der historischen Entwicklung des Pflegekinderwesens, der rechtlichen Grundlagen der Vollzeitpflege (KJHG, BGB), der Aufgaben des Jugendamtes, der Situation von Pflegefamilien und Herkunftsfamilien, sowie der Bedeutung von Bindung und Trennung für die Entwicklung der Kinder. Statistische Daten zum Pflegekinderwesen in Deutschland werden ebenfalls präsentiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Historische Entwicklung des Pflegekinderwesens, Gegenstandsbereich und Definitionen, Statistische Daten zum Pflegekinderwesen, Rechtliche Grundlagen des Pflegekinderwesens, Aufgaben des Jugendamtes im Pflegekinderwesen, Die Sozialisation in der Pflegefamilie und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik und baut auf den vorherigen Kapiteln auf.
Wie werden zentrale Begriffe definiert?
Die Arbeit definiert präzise zentrale Begriffe wie Vollzeitpflege, Pflegekind, Pflegefamilie und Pflegekinderwesen. Die Definitionen berücksichtigen insbesondere juristische Aspekte und bilden die Grundlage für das Verständnis der Fachterminologie.
Welche Rolle spielt das Jugendamt?
Die Arbeit beschreibt ausführlich die Aufgaben des Jugendamtes im Pflegekinderwesen, von der Organisation und den Rahmenbedingungen über die Auswahl und Vorbereitung von Pflegeeltern bis hin zur Begleitung und Unterstützung der Pflegeverhältnisse. Das Jugendamt wird als zentrale Instanz im Pflegeprozess dargestellt.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die relevanten rechtlichen Grundlagen des Pflegekinderwesens, insbesondere das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Sie behandelt die Rechte von Kindern und Eltern, die Verfahren der Vollzeitpflege nach § 33 KJHG und den rechtlichen Schutz des Pflegekindes.
Wie wird die Sozialisation in der Pflegefamilie untersucht?
Die Arbeit untersucht die Sozialisation von Pflegekindern in der Pflegefamilie, betrachtet die Bedeutung der Familie für den Sozialisationsprozess, die Situation der Pflege- und Herkunftsfamilien und die Herausforderungen und Möglichkeiten der Integration des Pflegekindes. Die Bedeutung von Bindung und Trennung in der Kindheit spielt eine zentrale Rolle.
Welche Faktoren beeinflussen die Sozialisation von Pflegekindern?
Die Arbeit identifiziert Faktoren, die die Sozialisation von Pflegekindern positiv oder negativ beeinflussen. Diese Faktoren umfassen die Rolle des Jugendamtes, die Eigenschaften erfolgreicher Pflegefamilien, das Verhalten der Herkunftsfamilien sowie die Bedeutung stabiler Bindungen und die Bewältigung von Trennungssituationen.
Welche statistischen Daten werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zum Pflegekinderwesen in Deutschland, betrachtet das Alter der Kinder bei der Inpflegegabe und die Dauer der Pflegeverhältnisse. Diese Daten liefern quantitative Informationen zur aktuellen Situation.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter zur Beschreibung der Arbeit sind: Pflegekinder, Sozialisation, Ersatzfamilien, Familienpflege, Anstaltserziehung, Jugendamt, Pflegekinderdienst, Vollzeitpflege, Rechtliche Grundlagen, KJHG, BGB, Integration, Bindung, Trennung, Herkunftsfamilie, Pflegefamilie, Pflegeeltern.
- Quote paper
- Nina Weber (Author), 2002, Pflegekinder. Zur Sozialisation von Kindern in Ersatzfamilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11009