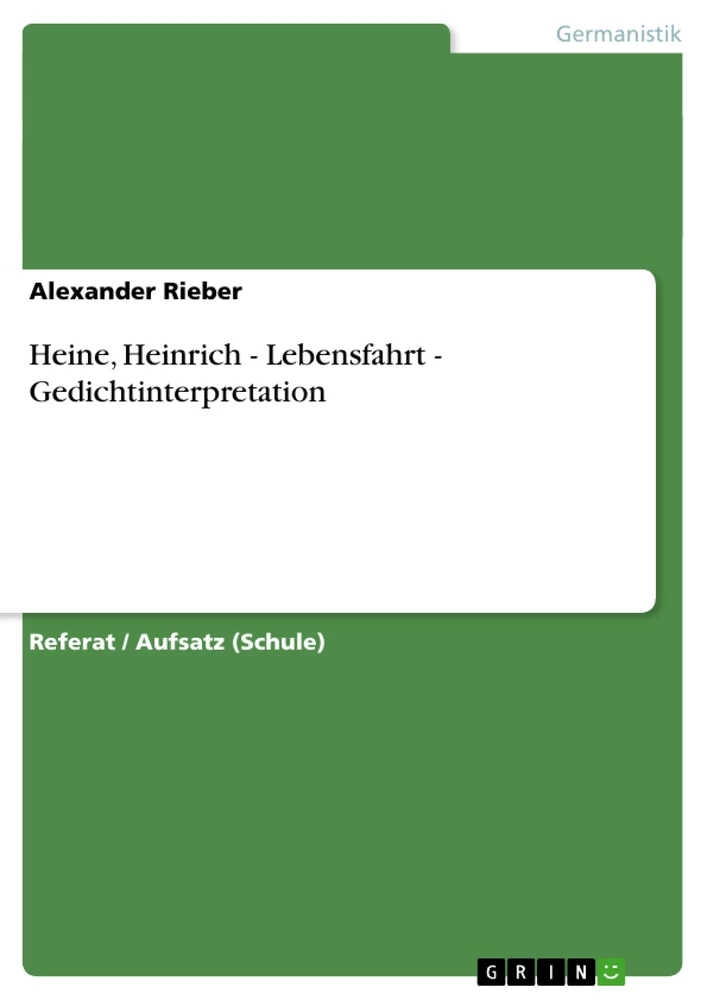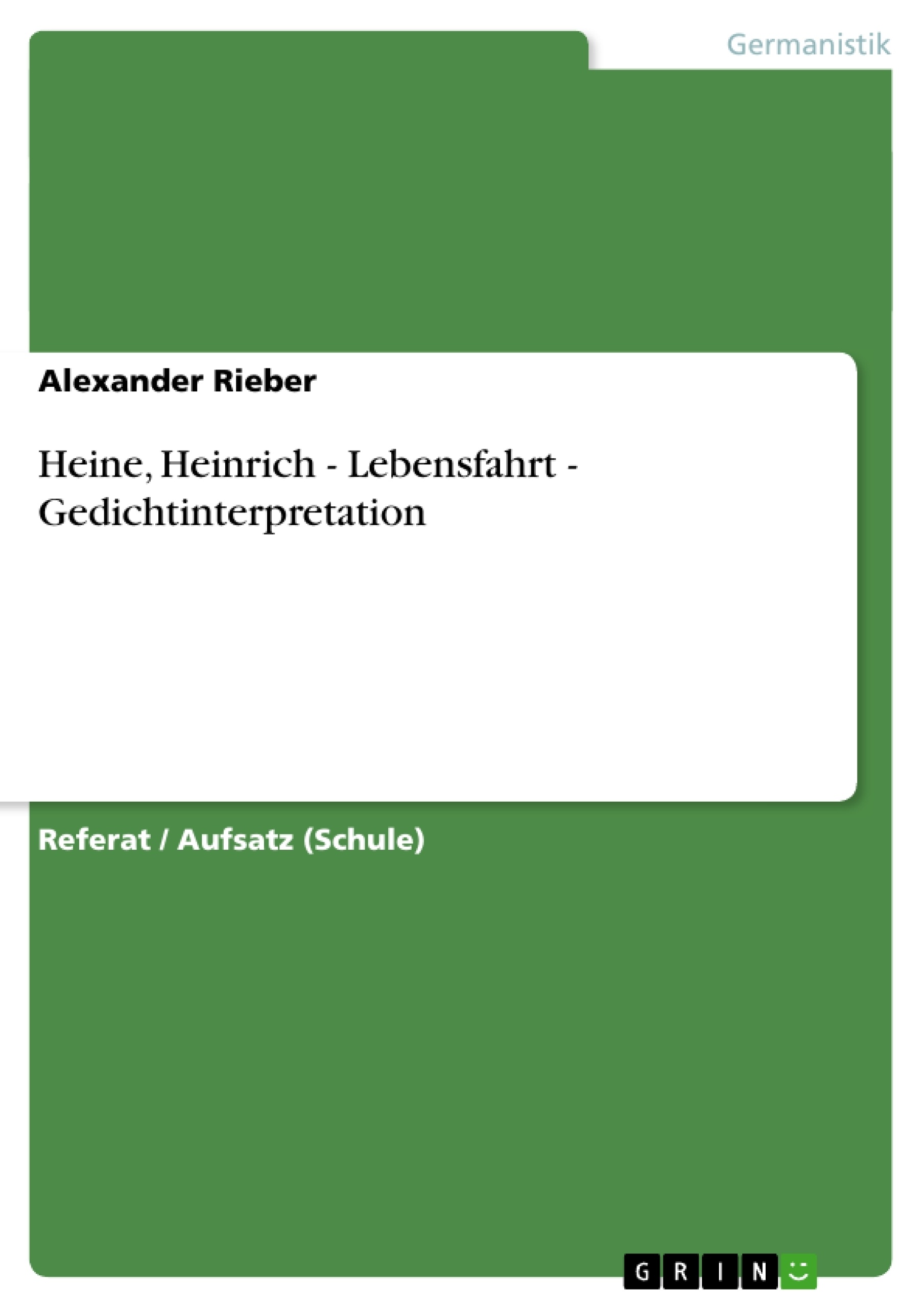Aus Heinrich Heines Exilzeit in Frankreich stammt auch das Gedicht „Lebensfahrt“. Das lyrische Ich beschreibt sich darin einem „lustigen Kahn“ (Z.3) zugehörig, der jedoch „zerbrach“ (Z.5). Bei diesem Unglück gingen seine Freunde unter, doch er konnte sich, vom Sturm getragen, an einen Strand retten. All dies konnte ihn jedoch nicht davon abhalten ein „neues Schiff“ zu besteigen, das wieder von Wellen geschüttelt in die Nacht hinausfährt, nichtsdestotrotz vermisst er seine Heimat.
Das Gedicht besteht aus 4 Quartetten, die durch Paarreime miteinander in Verbindung stehen.
Gedichtinterpretation des Gedichtes „Lebensfahrt“ von Heinrich Heine
In dem Volkslied „Lebensfahrt“ geschrieben 1843 thematisiert Heine sein Exilleben und die Missstände in seinem Vaterland, Deutschland. Heine, der von 1797-1856 lebte, fällt in die Epoche der Romantik, von der er sich in seinen Gedichten unentwegt ironisch abzusetzen versucht. Geschichtlich wird seine Wirkungs,- bzw. Schaffenszeit als Vormärz bezeichnet, da Deutschland vor der Märzrevolution 1848 in einem totalitären Polizeistaat organisiert war, in dem keine freie Meinungsäußerung gestattet und die Presse sowie sonstige Schriften einer starken Zensur unterlagen. Heine verkörpert den literarischen Revolutionär, der sich nicht an Straßenbarrikaden,- oder –kämpfen beteiligt, sondern dies als schändlich und aufhetzend abtut. Doch er kritisiert die Obrigkeit, bzw. die konservative gestimmten Bürger in seinen Gedichten oftmals sehr scharf. Diesen Tatsachen verdankt er auch, dass er 1831 ins Exil nach Paris gehen musste, da ihn die Obrigkeit wegen seiner Schriften verfolgte und die Revolutionäre wegen seiner „zur Schau“ gestellten Angriffslust, bzw. Kritik an der Obrigkeit, die sich in seinen Gedichten widerspiegelte, hasste.
Aus seiner Exilzeit in Frankreich stammt auch das Gedicht „Lebensfahrt“. Das lyrische Ich beschreibt sich darin einem „lustigen Kahn“ (Z.3) zugehörig, der jedoch „zerbrach“ (Z.5). Bei diesem Unglück gingen seine Freunde unter, doch er konnte sich, vom Sturm getragen, an einen Strand retten. All dies konnte ihn jedoch nicht davon abhalten ein „neues Schiff“ zu besteigen, das wieder von Wellen geschüttelt in die Nacht hinausfährt, nichtsdestotrotz vermisst er seine Heimat.
Das Gedicht besteht aus 4 Quartetten, die durch Paarreime miteinander in Verbindung stehen.
Der Titel „Lebensfahrt“ lässt verschiedene Assoziationsmöglichkeiten offen, die erst im Gedicht näher spezifiziert werden können. Zum einen könnte Heine damit sein Leben revué passieren lassen, er könnten doch einmal eine „Fahrt“ durch sein Leben unternehmen, zum anderen könnte er den Lauf der Dinge beschreiben, d.h. wie sich die Dinge entwickelten und wahrscheinlich noch entwickeln werden. Doch was wollte Heine uns mit „Lebensfahrt“ eigentlich sagen?
Sicherlich wollte er auf gesellschaftliche Missstände hinweisen, indem die Allegorie der Schifffahrt, die das lyrische Ich durchlebt, für die Gesellschaft in Deutschland in Strophe 1 und 2 und für das Exil in Frankreich Strophe 3 und 4, in dem er ein „neues Schiff“ (Z.9) bestiegen hat, steht. Die erste Strophe ist in romantisch, verklärtem Stil verfasst, womit sich Heine als zwiespältig zeigt, da er am romantischen Stil hängt, ihn jedoch nicht das ganze Gedicht über durchhalten kann und will. Er entlarvt ihn sogar zeitweise als Klischee. Diese Entlarvung wird beispielsweise in Z.6 deutlich, als er in lapidarem Tonfall das lyrische Ich sagen lässt: „Die Freunde waren schlechte Schwimmer“. Die biedermeierliche Welt aus friedvoller Natur wird in den Strophen 2-4 ironisch-kritischer beleuchtet gezeigt, denn wenn es in Z.2 noch heißt: Die Wellen schaukeln“, so beschreibt er die Naturgewalten in Z.14: „Es pfeift der Wind, die Planken krachen“ schon kritischer und weitaus naturgetreuer.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Gedichts "Lebensfahrt" von Heinrich Heine?
Das Gedicht "Lebensfahrt", geschrieben 1843, thematisiert Heinrich Heines Exilleben und die Missstände in seinem Vaterland, Deutschland, zur Zeit des Vormärz.
In welche Epoche fällt Heinrich Heines Werk?
Heinrich Heine fällt in die Epoche der Romantik, obwohl er sich in seinen Gedichten oft ironisch davon distanziert.
Warum ging Heine ins Exil nach Paris?
Heine musste 1831 ins Exil nach Paris gehen, weil er aufgrund seiner Schriften von der Obrigkeit verfolgt wurde und von Revolutionären wegen seiner Kritik an der Obrigkeit gehasst wurde.
Was beschreibt das lyrische Ich im Gedicht "Lebensfahrt"?
Das lyrische Ich beschreibt sich als Teil eines "lustigen Kahns", der zerbrach. Nach dem Verlust seiner Freunde rettete es sich an einen Strand und besteigt später ein "neues Schiff", wobei es aber seine Heimat vermisst.
Wie ist das Gedicht "Lebensfahrt" aufgebaut?
Das Gedicht besteht aus 4 Quartetten, die durch Paarreime miteinander verbunden sind.
Welche Bedeutung hat der Titel "Lebensfahrt"?
Der Titel "Lebensfahrt" lässt verschiedene Interpretationen zu, darunter eine Rückschau auf Heines Leben, eine Beschreibung des Laufs der Dinge und eine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Missständen.
Welche Allegorie verwendet Heine im Gedicht?
Heine verwendet die Allegorie der Schifffahrt, um die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland (Strophen 1 und 2) und sein Exil in Frankreich (Strophen 3 und 4) darzustellen.
Wie zeigt sich Heines Zwiespältigkeit im Gedicht?
Heines Zwiespältigkeit zeigt sich im Wechsel zwischen romantisch-verklärtem Stil und ironisch-kritischer Beleuchtung der Verhältnisse, sowie in der Hin- und Hergerissenheit zwischen der alten Heimat Deutschland und der neuen Heimat Frankreich.
Welche Rolle spielt das Metrum im Gedicht?
Heine verwendet kein festes Metrum, sondern wechselt zwischen Daktylus und Jambus, um die Zerrissenheit in sich auszudrücken. Der Daktylus dominiert in der ersten und letzten Strophe, um eine gewisse Geschlossenheit zu suggerieren, während der Jambus in den Strophen 2 und 3 die Dramatik erhöht.
Welche sprachlichen Mittel setzt Heine ein?
Heine setzt verschiedene sprachliche Mittel wie Alliterationen, Metaphern und Personifikationen ein, um seine Aussagen zu verstärken und die Dramaturgie der Szene zu verdeutlichen.
Was symbolisiert der "lustige Kahn" im Gedicht?
Der "lustige Kahn" steht als Personifikation für die Dichterunion "Junges Deutschland".
Was bedeutet das "Zerbrechen" des Kahns?
Das "Zerbrechen" des Kahns symbolisiert das Verbot des "Jungen Deutschland" und Heines Flucht ins Exil. Die "eitel Trümmer" stehen für das damalige Deutschland.
Was symbolisiert der "Sturm" und der "Seinestrand"?
Der "Sturm" ist eine Metapher für die Unruhen, die Heine und das "Junge Deutschland" ausgelöst haben. Der "Seinestrand" steht für Frankreich.
Was bedeutet das "neue Schiff" im Gedicht?
Das "neue Schiff" steht allegorisch für ein neues Leben und neue Chancen in Frankreich. "Neue Genossen" bezeichnen neue Freunde und Bekanntschaften, die Heine in Frankreich schließt.
Was drückt Heine in den Zeilen "Wie fern die Heimat! mein Herz wie schwer!" aus?
In diesen Zeilen drückt Heine sein Heimweh aus und verstärkt seine Aussage durch den Chiasmus dieser zwei Zeilen. Er sehnt sich nach der Heimat, aber sein Schlusswort zeigt auf, dass die Heimat immer mehr in die Ferne rückt.
Was wollte Heine mit dem Gedicht "Lebensfahrt" dem Leser darlegen?
Heine wollte mit seinem Gedicht dem Leser darlegen, warum er ein so großer Freund der Franzosen ist, da sie ihm eine neue Heimat gewährten. Außerdem wollte er zeigen, wie es ihn im Leben "gebeutelt" hat und seine "Lebensfahrt" von statten ging.
- Quote paper
- Alexander Rieber (Author), 2006, Heine, Heinrich - Lebensfahrt - Gedichtinterpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110014