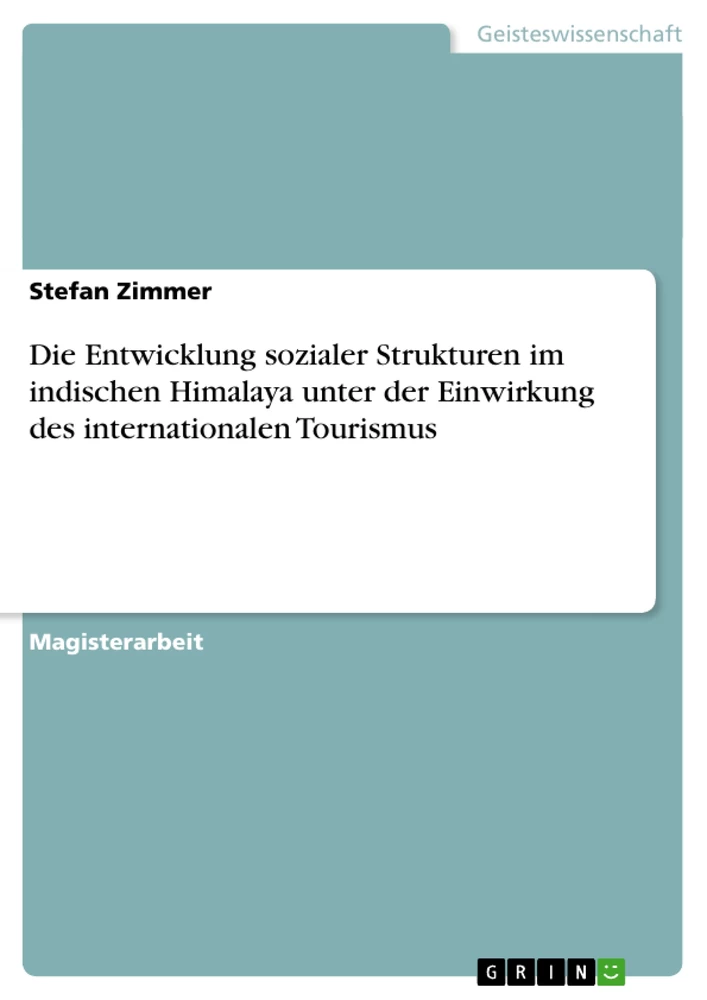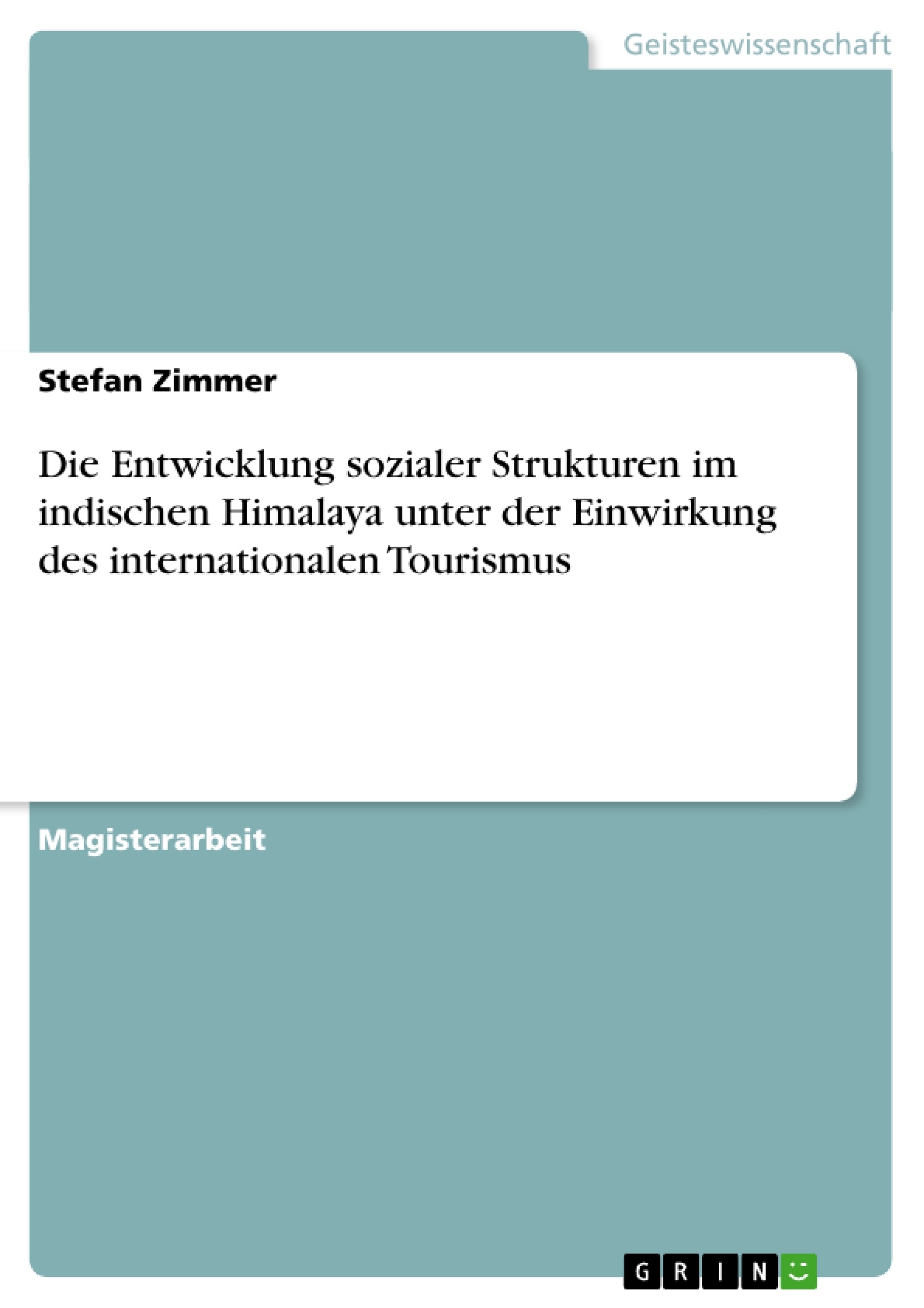2. Theoretische Grundlagen und Konzepte
2.1. Die entwicklungstheoretische Diskussion
Die Frage der Auswirkungen des internationalen Tourismus bezüglich der Entwicklung der bereisten Gebiete in der „Dritten Welt“[1] ist eng mit der entwicklungstheoretischen Diskussion verbunden. Folgende Fragen interessieren hier besonders: Was heißt Entwicklung, welche Entwicklungsstrategien werden diskutiert und auf welchen theoretischen Grundlagen beruhen diese?
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Tourismus wurde dieser einerseits als Entwicklungsstrategie für bestimmte Regionen dargestellt, auf der anderen Seite aber auch als Entwicklungshemmnis oder als Ursache für unerwünschte Fehlentwicklungen identifiziert, was in eine allgemeine Tourismuskritik und in spezifische Entwicklungsstrategien für diesen mündete. Um in einer Fallstudie hierzu sinnvolle Aussagen zu treffen, ist es daher unerlässlich, sich mit der Entwicklungstheorie zu befassen, um einen theoretischen Maßstab bei der Hand zu haben, mit dem die empirischen Ergebnisse eingeordnet werden können.
Nach MENZEL (vgl. 1992: 131) soll eine Entwicklungstheorie „gesamtgesellschaftliche, welthistorische Prozesse des wirtschaftlichen und sozialen Wandels“ erklären. Die Ergebnisse dieser theoretischen Auseinandersetzung sollen dann in Entwicklungsstrategien umgesetzt werden. Somit haben die Theorien in der Entwicklungsdiskussion wie in der Entwicklungssoziologie neben ihrer deskriptiv-analytischen Funktion auch immer einen normativ-politischen Aspekt, da sie in konkrete Entwicklungsstrategien münden (vgl. MENZEL 1991: 5; LÜHR / SCHULZ 1997: 10; THIEL 1999: 10f.). Anfänglich, in den 50er Jahren, dominierten die Wirtschaftswissenschaften weitgehend die Diskussion, weshalb bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts Entwicklungstheorien immer als ökonomische Wachstumstheorien gedacht wurden, in den Modernisierungs- und Dependenciatheorien ebenso wie im sozialistischen Entwicklungsmodell (vgl. Menzel 1992: 131ff.). Im Verlauf der Diskussion wurde sie jedoch zunehmend aus einer interdisziplinären Perspektive geführt, in der die Bedeutung der sozio-kulturellen und politischen Dimensionen der Entwicklung auch Beachtung fanden. Die Entwicklungssoziologie als eine spezielle Perspektive in der Entwicklungsdebatte beschreibt ihren Gegenstand als die „Aneignung unserer äußeren und inneren Natur sowie den gesellschaftlichen Problemen, die sich aus diesem Prozeß ergeben" (LÜHR / SCHULZ 1997: 10). Aufgrund der interdisziplinären Verschränkung der Diskussion um Entwicklung sind die verschiedenen Ansätze jedoch teilweise nur schwer einer Disziplin zuzuweisen (vgl. ebd.: 10). Das europäische Modell dieser Aneignung wird in der Soziologie als Modernisierung beschrieben, das im Verlauf der europäischen Expansion zum globalen Muster der gesellschaftlichen Entwicklung geworden ist. Während sich nun die Stammdisziplin seit ihrem Bestehen mit den Prozessen, der Entwicklung und später mit der Struktur dieses europäischen Modells in den Industriegesellschaften befasst (vgl. BERGER 1988: 224), hat die interdisziplinäre Diskussion der Entwicklungstheorien neben einem starken Praxisbezug auch einen räumlich global gefassten Bezugsrahmen. Sie entstand nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Hintergrund des entstehenden Ost-West-Konflikts und der wieder erlangten Souveränität der entkolonialisierten Gebiete in Asien und später in Afrika.
So konkurrierten nun weltweit zwei Entwicklungsmodelle miteinander, das europäisch-nordamerikanische Modell der Modernisierung mit dessen Basisinstitutionen[2] der Konkurrenzdemokratie, der kapitalistischen Marktwirtschaft, dem Wohlfahrtsstaat und dem Massenkonsum (vgl. ZAPF 1997: 31) auf der einen Seite, das sozialistische Modell der Sowjetunion und ihrer Blockstaaten mit dem politischen Monopol bei der kommunistischen Partei, einer Planwirtschaft und der staatlich organisierten Umverteilung auf der anderen Seite. Die Modernisierungstheorie, die in den modernen westlichen Staaten entstand, sollte das eigene Modell theoretisch legitimieren und Grundlage für Entwicklungsstrategien sein, die man den neuen Ländern der „Dritten Welt“ anbieten konnte, um sie von dem sozialistischen Entwicklungsmodell abzuhalten (vgl. Menzel 1992: 137). Dieter GOETZE (vgl. 1997: 427) formuliert als das Verdienst der wissenschaftlichen Diskussion aber auch den Versuch, alternative Strategien zu entwickeln, die unabhängig von einer Blockzugehörigkeit funktionieren sollen.
Der Begriff der Dritten Welt entstand ebenfalls vor diesem Hintergrund und bezog sich anfänglich auf einen dritten Entwicklungsweg zwischen Sozialismus und Kapitalismus, den die blockfreien Staaten in Asien und Afrika beschreiten wollten. Mitte der 60er Jahre kam eine ökonomische Dimension hinzu, da mit der 1. UNCTAD-Konferenz nun die gemeinsame Interessenlage der Entwicklungsländer hinsichtlich ihrer Stellung auf dem Weltmarkt und in dem hier sichtbar werdenden Nord-Süd-Konflikt in den Vordergrund rückte. Julius NYERERE definierte „Dritte Welt“ denn auch als die „Opfer und Ohnmächtigen der Weltwirtschaft“ (vgl. nach NOHLEN / NUSCHELER 1992: 17f.). Der Begriff ist heute nicht mehr unbestritten, da die stark unterschiedlichen Interessen und Entwicklungen in diesen Ländern kaum mehr erlauben, von einer „Dritten Welt“ zu sprechen, und mit der Auflösung des Ostblocks auch der begründende Ost-West-Gegensatz wegfiel (vgl. Goetze 1997: 428). Als Begriff zur Abgrenzung gegenüber den westlichen Industrieländern, die in der Soziologie als moderne Gesellschaften beschrieben werden, eignet sich daher die Bezeichnung Entwicklungsländer besser. Hier kommen die starken Differenzen dieser Staatengruppe eher zum Ausdruck, und auch wenn dieser Begriff ebenfalls nicht unumstritten ist, wird er doch von den internationalen Institutionen (wie IWF, Weltbank, UN) benutzt. Ich werde daher diesen Begriff für alle ehemaligen Kolonien verwenden, die das westliche Modell der Moderne noch nicht völlig umgesetzt haben und sich gegenwärtig auf unterschiedlichen Entwicklungswegen befinden.
Seit dem Ende des Kalten Krieges und wegen der bis heute lediglich begrenzt erfolgreichen Entwicklungspolitik, aber auch völlig unterschiedlichen Entwicklungen in den verschiedenen Staaten und Regionen ist nach Ulrich MENZEL der Anspruch einer generelle Erklärungen liefernden Theorie der Entwicklung weitestgehend aufgegeben worden (vgl. nach Altvater 1997: 79; Thiel 1999: 9f.). Die bisherigen großen Theorien der Entwicklungsdiskussion konnten durch empirische Befunde genauso be- als auch widerlegt werden, was auf ein Erklärungsdefizit hinsichtlich unterschiedlicher Entwicklungen hinweist (vgl. Lühr / Schulz 1997: 8f.). Da die wissenschaftliche Diskussion um den Tourismus aber auch vor dem Hintergrund der entwicklungstheoretischen Debatte zu sehen ist, soll diese im Folgenden dargestellt werden. Im anschließenden Abschnitt werden darauf aufbauend neue Ansätze in der Entwicklungsdiskussion in Bezug auf die Wirkungen des Tourismus vorgestellt.
2.1.1. Modernisierungs- und Dependenztheorie
Als Gegenentwurf zur sozialistischen Entwicklung wurde aufbauend auf Max WEBERS Modernitätsbegriff in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts für die jungen Entwicklungsstaaten die Modernisierungstheorie[3] begründet (vgl. Menzel 1991: 23). Hier wird die westliche Modernisierung als global gültiges Interpretationsraster für Entwicklung benutzt (vgl. Scherrer 1986: 146). Die Soziologie lieferte dafür die theoretischen Grundlagen durch ihre Analyse der Modernisierung der Gesellschaften in Europa. Dieser Prozess wird als eine „Unterscheidung und Abgrenzung gegen die Vergangenheit“ (Berger 1988: 226) analysiert. Die Tradition, welche bis dahin als gesellschaftsstiftendes Element vorherrschend war, müsse abgeschafft werden, damit die politischen, sozialen und vor allem ökonomischen Kräfte den enormen Wandel der Gesellschaft bewirken können (vgl. ebd.: 226). In der Systemtheorie von Talcott PARSONS wird das Ziel aller gesellschaftlichen Entwicklung als bessere Anpassungsfähigkeit des Systems an seine Umwelt definiert. Das geschieht durch weitere Unterscheidungen der Gesellschaft in verschiedene Subsysteme, was er „funktionale Differenzierung“ nennt (vgl. PARSONS 1986: 43ff.). Dies lässt sich am besten an der Ausdifferenzierung des ökonomischen Systems, also der Trennung von Politik und Wirtschaft, erkennen. In den funktionalen Subsystemen, die sich nicht auf die Sphären der Politik und Ökonomie beschränken, läuft jeweils ein nach ihrer spezifischen Logik geregelter Rationalisierungsprozess ab, so dass dort eine Leistungssteigerung erreicht wird. Diese Rationalisierung der einzelnen Bereiche setzt dadurch die immense Dynamik der modernen Gesellschaften frei. (vgl. Berger 1988: 226f.). Wolfgang ZAPF (vgl. 1997: 32ff.) beschreibt den Ertrag dieser Dynamik als „Freiheit, Wachstum und Wohlfahrt“, was jedoch auch mit den Kosten einer mangelnden Integrationsfähigkeit der sich verselbstständigenden Subsysteme verbunden ist, so dass die Modernisierung immer das „einheitsstiftende `soziale Band´ zur Disposition“ (BERGER 1988: 224) stellt.
Die Ursachen und Bedingungen für erfolgreiche Entwicklung im Sinne der Modernisierung sind also bei endogenen Faktoren zu finden. Die traditionellen Elemente der Gesellschaft mit ihrem oft irrationalen Charakter werden als Entwicklungshemmnis gesehen. Sie müssen durch Modernisierung der einzelnen Gesellschaftsbereiche überwunden werden (vgl. Wood 1993: 51), das heißt, die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft an ihre Umwelt wird erhöht. Die notwendigen Wandlungsprozesse wurden im kulturellen Bereich als Säkularisierung und Rationalisierung der traditionellen Lebensbereiche, Differenzierung und Verwissenschaftlichung, im politischen Bereich als Institutionalisierung gesellschaftlicher Konflikte, Partizipation und Stärkung der Staatsautorität und im individualpsychologischen Bereich als Empathiesteigerung und Leistungsmotivation analysiert (vgl. Menzel 1991: 24; Nohlen / Nuscheler: 1992: 34). 1960 formulierte Walt ROSTOW ein Fünf-Stadien-Gesetz, nach dem die ökonomische Entwicklung allgemein ablaufe, was derzeit noch weitgehend mit allgemein gesellschaftlichem Fortschritt gleichgesetzt wurde. Dieses Entwicklungsmodell basierte weitgehend auf der soziologischen Analyse der Modernisierung und machte somit die europäisch-nordamerikanische Industrialisierung zur weltweiten Vorlage der wirtschaftlichen Entwicklung. In der politischen Dimension wurde, ebenfalls unter den gesellschaftlichen Voraussetzungen der Moderne, ein ähnliches Phasenmodell der Entwicklung angenommen, dass die Stadien der Staatenbildung, Nationbuilding, Demokratisierung und Umverteilung durchlaufen würde (vgl. Zapf 1997: 33f.). Die Frage nach den Gründen der Unterentwicklung der Entwicklungsstaaten wurde gar nicht gestellt, da sich diese pauschal noch in den Anfangsstadien der Entwicklung befanden (vgl. Maurer 1992: 32; Nohlen / Nuscheler 1992: 35). Strategien für eine nachholende Entwicklung, die auf modernisierungstheoretischen Annahmen basierten, blieben vorerst auch weitgehend auf das Teilgebiet der Ökonomie beschränkt, da angenommen wurde, dass sich in den anderen Teilsystemen, im Zuge des ökonomischen Wachstums und der Industrialisierung, ebenfalls Modernisierungsprozesse in Gang setzen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es auf diesem Gebiet zwei Paradigmen, die Einfluss auf die Entwicklungsstrategien ausübten. Zum einen war das die neoklassische Theorie, die durch die Nutzung der komparativen Kostenvorteile durch private Unternehmer, mit den daraus resultierenden Prinzipien der Internationalen Arbeitsteilung und des Freihandels, welche seit der Gründung der Bretton-Woods-Institutionen 1944 auch die Weltwirtschaftsordnung dominieren, den größtmöglichen Wohlfahrtsgewinn für alle Beteiligten postuliert (vgl. Altvater / Mahnkopf 1997: 82f.). Zum anderen entstand der Keynesianismus als Entwicklungsstrategie aufgrund der Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise von 1929, als das Exportwachstumsmodell des Freihandels versagt hatte. Hier wird im Gegensatz zur neoklassischen Theorie die Selbstregulation der Wirtschaft angezweifelt und daher staatliches Eingreifen in Form von Anreizen zur Erhöhung der Spar- und Investitionsrate empfohlen. Dabei wird eine steigende Ungleichverteilung der Einkommen in Kauf genommen, da die Empfänger mit höheren Einkünften auch ein höheres Sparaufkommen haben[4]. Zudem solle der Staat vor allem in den schwerindustriellen Sektor investieren und durch protektionistische Maßnahmen den Binnenmarkt aufbauen, um die Konzentration auf die Primärgüterproduktion für den Weltmarkt zu überwinden. Nachdem ein moderner industrieller Sektor aufgebaut sei, würde es dann auch zu Durchsickerungseffekten kommen, so dass auch die breite Bevölkerung vom steigenden Wohlstand profitieren würde. Vor allem in Lateinamerika wurde diese Strategie durch eine importsubstituierende Industrialisierung während der 50er und 60er Jahre umgesetzt (vgl. Menzel 1992: 135f.). Der Tourismus wurde vor dem Hintergrund dieser Annahmen auch als entwicklungspolitisches Instrument gewertet, um zum einen die komparativen Kostenvorteile vieler Entwicklungsländer optimal zu nutzen und zum anderen die Konzentration auf den primären Sektor zu überwinden (vgl. VORLAUFER 1996: 127ff.). In diesem Zusammenhang ist auch die Dualismustheorie zu nennen, die in einem modernisierungstheoretischen Verständnis von der Existenz eines traditionellen und eines modernen Sektors ausgeht, die relativ unabhängig nebeneinander bestehen. Wobei letzterer im Zuge der Entwicklung den traditionellen Sektor verdrängen würde. In den späteren Dependenztheorien wird hingegen nicht von einer Homogenisierung der Gesellschaft und Durchsetzung des modernen Sektors ausgegangen, sondern von dem Fortbestehen des Dualismus, da der moderne den traditionellen Sektor benötige (vgl. NOHLEN / NUSCHELER 1992: 42ff.).
Als diese Entwicklungsstrategien jedoch keine Wirkung zeigten, sondern sich der Abstand in der Entwicklung zwischen den Industrie- und den Entwicklungsstaaten zunehmend vergrößerte, nahm auch die Kritik an der Modernisierungstheorie zu.
Raul PREBISCH und Hans SINGER stellten noch im Rahmen der Modernisierungstheorien und einer importsubstituierenden Wirtschaftspolitik eine Tendenz der Verschlechterung der Austauschbeziehungen (Terms of Trade[5] ) fest und zweifelten bereits in den 1950er Jahren den Wohlfahrtsgewinn für die Entwicklungsländer an, den diese durch die Integration in den Weltmarkt erzielen sollten. Paul BARAN und Paul SWEEZY verorteten nun auf der Grundlage der Imperialismustheorien die Ursachen der Unterentwicklung grundsätzlich bei exogenen, außenwirtschaftlichen Faktoren. Als ihre zentrale These analysierten sie die Ursachen für die mangelnde Dynamik in den Entwicklungsländern als den ständigen Transfer von Surplus der Produktion in die Industrienationen und der unproduktiven Verwendung der verbleibenden Überschüsse. Über dieses Argument der internationalen Ausbeutung gingen Johan GALTUNG und Osvaldo SUNKEL hinaus, indem sie die Struktur des internationalen Systems zum Objekt ihrer Analyse machten. Diese sei von einer Dominanz der Industrieländer auf allen Ebenen des Systems (Politik, Wirtschaft, Militär, Kultur und Kommunikation) geprägt. Die hierarchische Unterteilung des internationalen Systems in Metropolen und Peripherie würde zu einer strukturellen Deformation in den peripheren Entwicklungsländern führen[6] (vgl. Menzel 1991: 27f.). In Bezug auf den Tourismus könnte man diesen ebenfalls als Ebene analysieren, auf der die Industrienationen eine dominante Rolle einnehmen.
Aus diesen drei Theoriesträngen entwickelte sich in Lateinamerika ab Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts die Dependenztheorie[7]. Die dichotome Unterscheidung in Tradition und Moderne wurde kritisiert, da sie in Modernisierungsstrategien mündete, die eine unreflektierte Übernahme von Teilen der westlichen, kapitalistischen Industriegesellschaften propagierten. Die aus der Übertragung resultierende Kombination von traditionellen und modernen Elementen, dem Dualismus, würde zu dem Gegenteil von Entwicklung führen. Die Rolle der Kultur in der Entwicklung wurde so stärker in Betracht gezogen, da traditionelle Kultur nicht mehr pauschal als Entwicklungshemmnis beurteilt, sondern deren Modifizierung als ein Mittel der eigenständigen Entwicklung anerkannt wurde (vgl. Wood 1993: 52f.). Dennoch ist beiden großen Theorien vorzuwerfen, dass sie sich auf die wirtschaftliche Dimension der Entwicklung konzentrierten und die kulturellen Unterschiede vernachlässigten (vgl. BLISS 1999: 72). Der Streit zwischen den beiden großen Theorien (Modernisierungs- und Dependenztheorie) drehte sich in erster Linie um die Frage, ob die Bedingungen für Entwicklung beziehungsweise die Ursachen der Unterentwicklung vorwiegend endogener oder exogener Natur seien (Maurer 1992: 33). Die Dependenztheoretiker forderten daher auch das völlige Abkoppeln der Entwicklungsländer von dem durch die Industrienationen beherrschten Weltmarkt als Voraussetzung und Mittel für eine erfolgreiche eigenständige Entwicklung. Die Strategie der autozentrierten Entwicklung[8] formulierte Dieter SENGHAAS als Dissoziation für bestimmte Zeit, interne Restrukturierung der Ökonomie und Gesellschaft und regionale Kooperation zwischen den Entwicklungsländern (vgl. nach Menzel 1992: 145f.). Auf den Tourismus bezogen, würde dies eine Schließung gegenüber ausländischen Touristen bedeuten, was Laos, Kambodscha, Vietnam oder Kuba auch lange Zeit als Strategie umsetzten (vgl. VORLAUFER 1996: 22ff.). Da diese Strategie aber in China, Nordkorea oder Albanien auch nicht zu dem erhofften Wohlfahrtsgewinn führte, und die Ostasiatischen Tigerstaaten durch Exportorientierung innerhalb des Weltmarktes sogar eine rasante Industrialisierung vollzogen, gerieten die Dependenciatheorien ebenfalls in einen Erklärungsnotstand (vgl. Nohlen / Nuscheler 1992: 45ff.; Menzel 1992: 147).
Die dargestellte Aufteilung der Entwicklungstheorien in diese zwei Paradigmen stellt eine starke Vereinfachung der tatsächlichen Diskussion dar, da sich beide Theorien im Verlauf der Kontroverse in verschiedene Diskussionsstränge aufspalteten, ebenso wie die tatsächlich verfolgten Strategien vor allem in den 70er Jahren meistens Kompromisslösungen zwischen den einzelnen Ansätzen darstellten. Als Hintergrund der Analyse der Auswirkungen des Tourismus auf Entwicklung soll diese grobe Darstellung der großen Theorien aber ausreichen. Auch wenn heute der Anspruch weitgehend aufgegeben wurde, mit einer Theorie gesellschaftliche Entwicklung generell erklären zu können, enthalten die Modernisierungs- und Dependenztheorie doch brauchbare Bestandteile zur Behandlung der hier gestellten Frage, da der von außen kommende Tourismus, als Teil der Weltmarktbeziehungen, sowohl ein exogener Faktor ist, als auch Wirkungen auf endogene Faktoren wie der sozialen, ökonomischen und kulturellen Subsysteme hat. Im folgenden Kapitel sollen nun aufbauend auf die klassischen Entwicklungsparadigmen neuere Ansätze der Entwicklungstheorie dargestellt werden, welche zur Analyse und Beurteilung des tourismusinduzierten Wandels als aktueller theoretischer Bezugsrahmen verwendet werden können.
2.1.2. Gegenwärtiger Stand der Entwicklungsdiskussion
Seit dem Ende des kalten Krieges, Ende der 80er Jahre, haben sich die globalen Rahmenbedingungen der Entwicklung grundlegend geändert, da das Konkurrenzmodell der westlichen Modernisierung mit dem Scheitern des sozialistischen Entwicklungsweges ausgeschieden ist. Die Einführung der Marktwirtschaft in den vormals sozialistischen Staaten hat zu einem neuen Stadium der Marktexpansion geführt, was gemeinhin als „Globalisierung der Märkte“ beschrieben wird (vgl. EVERS 1997: 213). Außerdem ist mit dem Aufstieg der ostasiatischen Tigerstaaten ein ökonomisches Modell der nachholenden Entwicklung vollzogen worden, während weite Teile Afrikas hinsichtlich der Weltwirtschaft weitgehend marginalisiert wurden (vgl. BREDOW / JÄGER / KÜMMEL 1997: 7ff.). Dieser Wandel der realen Rahmenbedingungen hatte auf die Theoriediskussion weitreichende Folgen, da sie sich nun fundamental neu orientieren muss. Ulrich MENZEL (vgl. 1999: 379) stellt das „Scheitern der großen Theorien“ fest, was er mit dem Zerfall des Gegenstandes einer einheitlichen Entwicklung der Ditten Welt, sowie dem Zerfall der Staatlichkeit in einigen dieser Länder begründet. Andere Autoren, wie zum Beispiel Franz NUSCHELER (vgl. 1999: 389ff.) konstatieren hingegen die dringliche Notwendigkeit von Entwicklungstheorien, vor dem Hintergrund der neuen Weltlage. Diese müssen aber die erheblichen Differenzen in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anerkennen, und somit den Anspruch aufgeben, Entwicklungen global erklären zu können. Die Entwicklungsdiskussion brachte aus diesem Grund seit her nur neue Theoreme mittlerer Reichweite hervor, nicht jedoch neue umfassende Entwicklungstheorien, welche die entstandene theoretische Lücke schließen könnten.
Neben dem Streit über das richtige Entwicklungsmodell für eine nachholende Industrialisierung wurde dieses Entwicklungsziel nun auch grundsätzlich in Frage gestellt und auf der UN-Konferenz in Rio de Janeiro 1992 das Entwicklungskonzept der nachhaltigen Entwicklung als globales Entwicklungsziel formuliert. Dieses basiert auf der Erkenntnis der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen und empfiehlt daher eine ausgewogene Entwicklung, die in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht die Lebensfähigkeit der zukünftigen Generationen nicht beeinträchtigen darf. Über die Frage, wie eine derartige Entwicklung eingeleitet werden kann, besteht jedoch ebenso wenig Konsens wie zuvor über das richtige Entwicklungsmodell. Modernisierungskritische Autoren heben die Unvereinbarkeit der auf Wachstum basierenden westlichen Modernisierung mit ihrem enormen Ressourcenverbrauch und dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung hervor, während Modernisierungstheoretiker das Modell der westlichen, modernen Gesellschaft aufgrund seiner Innovationsfähigkeit am ehesten für geeignet halten, eine nachhaltige Entwicklung zu vollziehen (vgl. KOPFMÜLLER 1996: 125ff.).
Im Folgenden werden nun verschiedene theoretische Ansätze der neueren Diskussion vorgestellt, um dennoch einen erweiterten analytischen Rahmen zur Seite zu haben, der jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit der gegenwärtigen Diskussionslage erhebt. Damit sollen dann im 6. Kapitel die Wirkungen des Tourismus auf die Entwicklung als Modernisierungsfördernd oder als verstärkte Abhängigkeit und Fehlentwicklung interpretiert werden.
Analog zum vorherigen Abschnitt möchte ich vorerst auf die weiterentwickelten Modernisierungstheorien eingehen. Wolfgang ZAPF (vgl. 1997: 36ff.) betont nach wie vor die starke Erklärungskraft der Modernisierungstheorien, die durch den Zusatz der Innovationstheorie erweitert werden müssen, um zu einem Verständnis unregelmäßiger und unterschiedlicher Entwicklungen zu kommen. Innovationen sind demnach wichtiger Bestandteil für eine erfolgreiche Modernisierung, womit durch ihr Ausbleiben auch fehlende Entwicklung oder Unterentwicklung erklärt wird. Nachholende Entwicklung im Sinne der Modernisierung kann nur zu dem Ziel der Übernahme der modernen Basisinstitutionen führen, wenn sie nicht auf reiner Imitation westlicher Strukturen und Prozesse beruht, sondern auch durch eigene Innovationen und Nacherfindungen getragen wird. Diese Innovationen müssen sich allerdings gegen den Widerstand träger, komplexer Systeme wehren, die auf etablierten Interessen und kollektiven Normensystemen basieren, weshalb nachholende Modernisierung immer einen längeren Prozess darstellt. Des Weiteren bewirken Innovationen auch immer nicht-intendierte Folgen, die zu berücksichtigen sind, da Entwicklung somit immer einen kontingenten Prozess darstellt. Die Frage, inwieweit diese Modernisierung durch eigene Innovationen zum gewünschten Erfolg einer besseren Anpassungsfähigkeit an die Systemumwelt führt, ist nach dem Theorem der moving targets aber auch von exogenen Faktoren abhängig, da sich die Systemumwelt ebenfalls ständig verändert. Dennoch ist Entwicklung primär durch endogene Bedingungen begründet.
Die Vorstellung einer linearen Entwicklung von Gesellschaften, welche dabei notwendig aufeinander folgende Stadien durchlaufen, wird hier also nun weitgehend aufgegeben, während die Wirkungen exogener Bedingungen für den Entwicklungsprozess auch anerkannt werden. Dennoch hält ZAPF die daraus abgeleitete Strategie einer „weitergehenden Modernisierung“, basierend auf der Innovationsfähigkeit der vier Basisinstitutionen, für alternativlos und daher für das geeignetste Konzept, die gegenwärtigen, zum Teil aus der Modernisierung resultierenden Probleme im Sinne der Nachhaltigkeit zu lösen. Sein Fazit der gegenwärtigen Diskussionslage postuliert daher lediglich mehrere Entwicklungswege hin zu dem alternativlosen Entwicklungsziel der modernen Gesellschaft, deren Basisinstitutionen allerdings in verschiedenen Gesellschaften unterschiedliche Ausprägungen erhalten können (ebd.: 38f.).
Eine derartig erweiterte Modernisierungstheorie würde daher eine Tourismusentwicklung propagieren, die sich neben der Nachfrageorientierung der westlichen Tourismusmärkte (also der Imitation der Entwicklung europäischer Reiseziele) auch an den spezifischen regionalen Bedingungen der gesellschaftlichen Subsysteme ausrichtet, um durch Innovationen eine angepasste Tourismusentwicklung voranzutreiben.
Da der Tourismus als gesellschaftliches Phänomen neben dem Kulturkontakt in erster Linie eine ökonomische Branche darstellt und daher Tourismuspromotoren, welche sich auf modernisierungstheoretische Annahmen berufen, immer seine wirtschaftsfördernden Wirkungen betonen (vgl. MAURER 1992: 54), folgen nun auch ökonomische Ansätze aus der Entwicklungsdiskussion.
Als neue Spielart der Modernisierungstheorie sieht Reinold THIEL (vgl. 1999: 12) die Renaissance der neoklassischen Theorie des Freihandels, die seit den frühen 80er Jahren die weltweit verfolgten Entwicklungsstrategien dominiert. Gründe für die Wiederkehr des alten entwicklungsökonomischen Paradigmas sieht MENZEL (vgl. 1991: 42) in den misslungenen importsubstituierenden Entwicklungsmodellen in Lateinamerika sowie in den Erfolgen der exportorientierten Strategien der ostasiatischen Tigerstaaten. Hinzu kam die Verschärfung des Ost-West-Konfliktes in den frühen 80er Jahren, wodurch jede Unterstützung der westlichen Industrienationen für im weitesten Sinne sozialistischen Entwicklungsmodelle zurückgefahren wurde. Schließlich ist das Alternativmodell der westlichen Modernisierung mit dem Versagen des sozialistischen Entwicklungsweges Ende der 80er Jahre ausgeschieden, was dem neoliberalen Ansatz nochmals weiteren Auftrieb verlieh.
Als neues Theorieelement kam das Neofaktorproprotionentheorem von Bela BALASSA hinzu, welches auf eine Stärkung der komparativen Kostenvorteile durch technologischen Wandel und vor allem durch eine Verbesserung des Humankapitals[9] hinweist (vgl. ebd.: 42; MENZEL 1992: 152ff.). Das Wissen der Bevölkerung wird hier als dritter Produktionsfaktor neben dem Kapital und der Arbeit betrachtet, welcher sowohl dauerhaftes Wirtschaftswachstum bei wachsendem Humankapital, als auch fortdauernde Unterentwicklung erklären kann, wenn Investitionen in diesen Produktionsfaktor ausbleiben (vgl. GUNDLACH 1999: 179ff.). Nico STEHR betrachtet Wissen ebenfalls als einen Produktionsfaktor mit wachsender Bedeutung und spricht ihm sogar eine konstitutive Funktion in den modernen Gesellschaften zu. „(...) es kommt eine neue Eigenschaft, das Wissen, hinzu und konkurriert gewissermaßen mit Eigentum und Arbeit als Strukturierungsmechanismen der modernen Industriegesellschaft“ (STEHR 2000: 55). Er versteht Wissen hier als Handlungsoption und versucht daher „den Modernisierungsprozeß als einen Prozeß der Extension und Rekonfiguration von Handlungsmöglichkeiten zu begreifen“ (ebd.: 48).
Im Hinblick auf den Tourismus würde dieser die Entwicklung nur fördern, wenn seine Erträge direkt in das Humankapital der bereisten Bevölkerung investiert werden, um auf diese Weise deren Handlungsoptionen zu erhöhen. Für die Branche selber hat das Wissen als Produktionsfaktor allerdings eine geringe Bedeutung, da hier ein allgemein niedriges Qualifikationsprofil ausreichend ist. Die Konzentration auf den Tourismus kann daher auch langfristig die Steigerung des Humankapitals behindern, da er nur eine geringe Nachfrage nach Wissen erzeugt.
Die analytische Funktion der Neoklassik bleibt allerdings nach wie vor relativ dürftig, da weder die Ursachen der Unterentwicklung gesondert untersucht werden, noch die begangenen Fehler der Entwicklungsstrategien oder die spezifischen kulturellen Bedingungen einzelner Gesellschaften in die Betrachtung eingehen (vgl. BLISS 1999: 74). Hier wird also nach wie vor von der primären Notwendigkeit des ökonomischen Wachstums ausgegangen, das auf der Ausnutzung der komparativen Kostenvorteile jeder Volkswirtschaft auf dem Weltmarkt beruht.
Vor dem Hintergrund der mit der Globalisierung der Wirtschaft einhergehenden Lokalisierung ist das Konzept der systemischen Wettbewerbsfähigkeit zu sehen. Hier wird auf die zunehmende Konkurrenz verschiedener Wirtschaftsstandorte abgezielt und daher auf die Ebene einzelner Regionen heruntergegangen. Im Gegensatz zu neoliberalen Politikempfehlungen wird hier davon ausgegangen, dass die Stabilisierung makroökonomischer Rahmenbedingungen für Entwicklung unter den Weltmarktbedingungen nicht ausreicht. Auf der Mikroebene einzelner Unternehmen muss die interne Organisation, sowie Netzwerke zwischen verschiedenen Unternehmen weiter entwickelt werden, um innovationsfähig und flexibel für sich wandelnde Umweltbedingungen zu sein. Zusätzlich werden noch zwei weitere Ebenen der Meso- und Metaebene eingeführt. Auf der Metaebene sind Prozesse der gesellschaftlichen Strukturbildung notwendig, um die gesellschaftliche Lern- und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Dazu muss zwischen den autonomen Elementen des Staates, der Wirtschaft und sozialer Akteursgruppen ein reger Dialog möglich sein. Die Mesoebene entspricht den einzelnen Regionen, die ebenfalls eine Institutionsstruktur entwickeln müssen, welche die Kommunikation verschiedener regionaler Akteursgruppen unterstützt, um so die regionale Lernfähigkeit zu erhöhen (vgl. EßER / HILLEBRAND / MESSNER / MEYER-STAMER 1999: 147ff.).
Im Hinblick auf die hier behandelte Fallstudie ist daher zu überprüfen, inwieweit die Region Kullu – Manali systemische Wettbewerbsfähigkeit aufweist und in welchem Maße der Tourismus hierfür einen Beitrag leisten konnte.
Der analytische Gehalt der Dependenztheorie kann ebenfalls erhöht werden, wenn der Fokus auf den Faktor der Systemumwelt aufgegeben wird, um weitere Entwicklungsbedingungen mit in die Betrachtung aufzunehmen. Ich möchte im Folgenden jedoch nur zwei Ansätze aus diesem Spektrum vorstellen, um die Übersichtlichkeit zwischen den entwicklungstheoretischen Paradigmen zu bewahren.
Gerhard HAUCK (vgl. 1997: 68) verbindet Ansätze verschiedener Kritiker zu einer erneuerten Dependenztheorie, die Entwicklung aufgrund mehrerer interdependenter (exogener wie indogener) Faktoren erklären will. Das sind zum einen interne Voraussetzungen für eine kapitalistische Entwicklung und zum anderen externe Mechanismen des Werttransfers von den peripheren Regionen in die Zentren. Kapitalistische Entwicklung sei demnach nur aufgrund freier Lohnarbeit sowie frei verfügbarer Produktionsmittel möglich, um die Produktionsfaktoren am effektivsten einsetzen zu können. Auch muss das politische und wirtschaftliche System voneinander getrennt, also ausdifferenziert sein, um Rechtssicherheit für das ökonomische Handeln zu gewährleisten. Als externen Faktoren nennt er die Ausbeutung des Subsistenzsektors durch den formalen Sektor, da in Gesellschaften mit dualen Ökonomien die Funktionen des Lohnes teilweise auf die Subsistenzwirtschaft abgeschoben werden, um den komparativen Kostenvorteil niedriger Löhne langfristig zu behalten. Des weiteren findet mit Hilfe nichtmarktförmiger Eingriffe (wie zum Beispiel Marktmonopole, Lizenzen und Patentrechte, Subventionen oder Zölle) in die Weltwirtschaft eine Verlagerung der Wettbewerbsvorteile zugunsten der dominanten Industrienationen statt. Und letztlich gebe es durch das Engagement transnationaler Konzerne aus den Industrienationen in den Entwicklungsländern einen Werttransfer der Gewinne zurück in die Metropolen.
Diese Zusammenfassung verschiedener Ansätze aus dem Dependenztheoretischen Feld bleibt aber erneut bei einer Konzentration auf ökonomische Bedingungen der Entwicklung stehen und lässt soziokulturelle Rahmenbedingungen, wie auch politische Institutionalisierung weiterhin außer acht. Vor dem Hinterngrund der ökonomischen Globalisierung soll dennoch der Einfluss dieser wirtschaftlichen Voraussetzungen und externen Faktoren auf die Entwicklung an dem hier behandelnden Fallbeispiel überprüft werden.
Ein umfassenderes Konzept zur Erklärung von Entwicklung und den dafür notwendigen Bedingungen gibt Elmar ALTVATER und Birgit MAHNKOPF (vgl. 1997: 77ff.) mit ihrer Theorie der Globalisierung. Zum einen sei gegenwärtig das Modell der modernen, westlichen Gesellschaft alternativlos, während zum anderen seine Verallgemeinerung mit einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung nicht vereinbar sei. Um diese allgemeine Verunsicherung in der Wissenschaft wie auch der Entwicklungspolitik zu beheben, entwirft er vier theoretische Kategorien.
Entwicklung verläuft demnach immer auf gewissen Attraktorbahnen, da ein Gesellschaftsmodell, welches zu einem gegebenen Zeitpunkt und in einem bestimmten territorialen Raum in sich stimmig ist und die Bedürfnisse der Menschen gut erfüllt, Attraktivität auf andere Gesellschaften ausübt. Eine Bedingung für die Attraktivität ist jedoch die relative Exklusivität des Modells, wie gegenwärtig die moderne Gesellschaft mit ihren Basisinstitutionen, die ihre Attraktivität daher schnell verlieren würde, wenn sie global verwirklicht werden würde.
Um gesellschaftliche Entwicklung vor Ort (in einem territorialen Raum) voranzutreiben, muss Kohärenz zwischen, sowie in den funktionalen Räumen hergestellt werden. Indem die Grenzen des geographischen Raumes durch politische Institutionen gesetzt werden, können „Störfaktoren der systemischen Kohärenz“ nach außen verlagert werden, weshalb auch die besten Entwicklungserfolge der vergangenen Jahrzehnte in territorial kleinen Räumen erzielt wurden. Im gesellschaftlichen Raum bedeuten kohärente Verhältnisse gesellschaftliche Solidarität, also das Vorhandensein von sozialen Bindungen, die auf gemeinsamen Normen basieren. Konkret bedeutet dies die Institutionalisierung von Konflikten und Netzwerke der Zivilgesellschaft, um einen sozialen Konsens (Gesellschaftsvertrag) zu erzielen (ebd.: 55ff.).
Da jedoch mit der Globalisierung der ökonomische Raum seiner territorialen Grenzen enthoben wird, können diese Störfaktoren nicht mehr externalisiert werden. Die Kohärenz kann in diesem Raum daher nur durch Anpassung an das durchschnittliche Rentabilitätsniveau des Weltmarktes erreicht werden, was aber in vielen Entwicklungsgesellschaften für die gesamte Wirtschaft kaum zu erreichen ist. Aus diesem Grund werden hier häufig nur der formelle Sektor der Ökonomie an das Weltmarktniveau angepasst, während andere Sektoren in die Informalität abgedrängt werden. Da die einzelnen Funktionsräume jedoch auch miteinander verbunden sind, zieht die Herstellung von Kohärenz im Wirtschaftsraum meist die Exklusion großer Teile der Gesellschaft von der Entwicklung nach sich[10] (Duale Gesellschaft) (vgl. ALTVATER 1999: 40f.).
Weiterhin wird Entwicklung aber auch von äußeren Restriktionen bestimmt, wie im Wirtschaftsraum der Zwang zur Orientierung an der Weltmarktzinsrate. Für die anderen Funktionsräume bedeuten solche äußeren Restriktionen eine Angleichung an die Niveaus der attraktiven Modelle (wie beispielsweise Produktivität, Arbeitsformen, Löhne, Ausgestaltung des Sozialstaates). Somit muss sich Entwicklung neben den spezifischen Bedingungen der Kohärenz in einem geographischen Raum auch an sehr allgemeinen Regeln global-gesellschaftlicher (in erster Linie ökonomischer) Restriktionen orientieren. Diese äußeren Restriktionen können im Gegensatz zur Herstellung der Kohärenz auf nationalstaatlicher Ebene nicht mehr reguliert werden. Die entwicklungspolitischen Handlungsmöglichkeiten der Entwicklungsländer werden also von den Kräften der Weltwirtschaft konditioniert, die nur von den Industrienationen und den von ihnen dominierten internationalen Wirtschaftsinstitutionen beeinflussbar sind (vgl. ALTVATER / MAHNKOPF 1997: 92ff.; ALTVATER 1999: 42ff.).
Die vierte Kategorie nennt ALTVATER die Interdependenzen zwischen den einzelnen Prozessen der Globalisierung, was an die Aussagen über die Zusammenhänge im Weltsystem der Dependenztheorien anknüpft. Im Gegensatz zu der alten eindimensionalen Theorie geht er jedoch von mehreren sich teilweise zuwiderlaufenden, aber zusammengehörenden Tendenzen der ökonomischen Globalisierung aus. Zum einen finde eine weltweite Vereinheitlichung statt, was sich in erster Linie auf den ökonomischen Bereich bezieht[11]. So kommt es zu vereinheitlichten Preisen innerhalb einer Branche und zu einer Angleichung der Renditen zwischen verschiedenen Branchen, weshalb die internationalen Institutionen auch vereinheitlichten Regeln der Strukturanpassung folgen, um einzelne Gesellschaften für freies Kapital (wieder) attraktiv zu gestalten. Diese Vereinheitlichung wird durch einen Prozess der Fraktalisierung[12] strukturiert, da sich auf verschiedenen Ebenen der Weltgesellschaft Institutionen und Funktionsabläufe nach dem Prinzip der Selbstähnlichkeit (Fraktale) reproduzieren würden. Diesem Prozess steht die Fragmentierung und Fraktionierung gegenüber, womit die weiter bestehende und widerkehrende Inkohärenz gesellschaftlicher Strukturen beschrieben wird. Mit Fragmentierung sind hier Prozesse der Vereinzelung mancher Gesellschaften (oder einzelner Segmente) gemeint, die für die Funktionslogik des gesamten Systems überflüssig geworden sind und daher weitgehend ausgeschlossen werden. Fraktionierung bedeutet dagegen die Unterteilung des Weltkapitals in einzelne Fraktionen, welche miteinander konkurrieren und den Kräften des Weltmarktes ausgesetzt sind (vgl. ALTVATER / MAHNKOPF 1997: 94ff.). Wichtig an dieser sehr komplexen Analyse der globalen Entwicklungstendenzen ist der Hinweis, dass diese Prozesse auch umschlagen können. Einzelne Gesellschaften können von einer Fraktion zu einem losen Fragment umschlagen, genauso wie bestehende kohärente Verhältnisse wieder in Unordnung verfallen können oder umgekehrt.
Die empirischen Daten der Fallstudie sind nach dieser Theorie also auf die Kohärenz in den einzelnen Funktionsräumen der untersuchten Region hin zu untersuchen, ebenso wie äußere Restriktionen auf die Entwicklung berücksichtigt werden müssen. Um die Entwicklung Manalis insgesamt einschätzen zu können, sollte diskutiert werden, inwieweit hier eine Tendenz der Fragmentierung oder Fraktionierung überwiegt und welche Prozesse der Fraktalisierung zu beobachten sind.
2.2. Kulturwandel und Akkulturation
2.2.1. Kulturbegriff
In der Modernisierungstheorie wird Kultur als ein Subsystem der Gesellschaft aufgefasst, das im Zuge der Entwicklung – also der Modernisierung – der Säkularisierung, Differenzierungs- und Rationalisierungsprozessen unterliegt und sich so von der Tradition abtrennt (vgl. LÜEM 1985: 35ff.). Unterentwicklung ist daher als Stadium der Kultur aufzufassen, wobei Kultur hier auf Werte- und Normensysteme reduziert verstanden wird. Bei den Dependenztheoretikern wird Tradition in den Kulturen der Entwicklungsländer hingegen nicht in Gegensatz zu Modernität gesetzt, sondern als ebenso modern, eben als Kehrseite desselben Entwicklungsprozesses. Das Erklärungsdefizit hinsichtlich stark unterschiedlicher Entwicklungen liegt jedoch bei beiden Theorien in der Vernachlässigung der Kultur als Rahmenbedingung im Prozess sozialen Wandels (vgl. WOOD 1993: 53f.). Da der Tourismus jedoch in vielen Fällen einen kulturellen Wandel bewirkt und somit die Rahmenbedingung der gesellschaftlichen Entwicklung verändert, soll hier ein Exkurs über Kulturwandel im Allgemeinen und Akkulturation im Besonderen vorgenommen werden.
In den meisten Studien zu den Auswirkungen des Tourismus auf Kultur und deren Wandel wurden in den letzten beiden Jahrzehnten weiter gefasste Kulturbegriffe verwendet, die oft aus der Kulturanthropologie stammen und in denen Gesellschaft, verstanden als soziale Struktur, nur ein Teilaspekt der Kultur darstellt (vgl. LÜEM 1985: 32f.). Diese hier zu diskutieren würde den Rahmen dieser Arbeit überschreiten[13], daher möchte ich nur kurz auf generelle Merkmale der so verstandenen Kultur eingehen, um den Begriff für diese Arbeit zu definieren.
Ganz allgemein wird Kultur so als die „Art und Weise, wie die Menschen leben und was sie aus sich selbst und ihrer Welt machen“ (MALETZKE 1996: 16), verstanden. Darin sind drei wichtige Aspekte der Kultur enthalten, die in den meisten Definitionen angesprochen werden. „Die Art und Weise, wie die Menschen leben“, bezieht sich auf das Verhalten der Menschen untereinander, also auf deren sozialen Beziehungen und Ausdrucksformen, die durch kulturelle Regeln bestimmt werden. „Was sie aus sich selbst“ machen, impliziert die immaterielle Seite der Kultur in Form von Ideen, Konzepten und Werten, und mit dem Ausdruck „ihrer Welt“ ist die Beziehung der Kultur zu ihrer Umwelt[14] angesprochen, die einem ständigen Anpassungsprozess unterliegt. Das Element der Tradition wird in dieser Definition jedoch gar nicht explizit angesprochen, obwohl es im Prozess des Kulturwandels eine zentrale Stellung einnimmt. Kultur ist aber in der räumlichen und zeitlichen Dimension mit einem bestimmten Raum verbunden, auch wenn dessen Grenzen schwer auszumachen sind, da Kultur ein immaterielles Phänomen darstellt, dass sich in materiellen, messbaren Erscheinungen lediglich äußert. Innerhalb des regionalen Raumes wird Kultur nun von einer Generation an die nächste weitergegeben, wobei sie einem ständigen Wandel unterliegt (vgl. LÜEM 1985: 31f.). WOOD weist hier darauf hin, dass die Definition von traditionellen Kulturelementen ebenfalls einem Wandel unterliegt, und diese somit keine feste Einheit bilden. „...tradition is always symbolically constructed in the present, not a `thing´ handed down from the past“ (WOOD 1993: 58).
Im Folgenden sollen nun verschiedene Theorieansätze zum Kulturwandel durch Tourismus kurz vorgestellt werden, um die verschiedenen Aspekte dieses komplexen Phänomens aufzuzeigen.
2.2.2. Kulturwandel
Da sich Kulturen durch ihre fortwährenden Anpassungsprozesse in einem ständigen Wandel befinden, unterscheidet LÜEM (vgl. 1985: 46ff.) nach den Ausgangspunkten der Veränderungen endogenen und exogenen Kulturwandel. Unter endogen verursachtem Wandel werden Innovationen in einem Kulturbereich verstanden, die nicht auf Impulse von außen reagieren, sondern von Kulturträgern initiiert wurden. Demgegenüber beruht exogener Wandel auf Kulturkontakten mit anderen Kulturen, infolgedessen einzelne Kulturelemente übernommen werden, die interdependent auf die anderen Kulturbereiche wirken. Erst wenn die neuen Kulturmuster von einer Mehrheit der Mitglieder übernommen wurden, wird von Kulturwandel gesprochen. Er merkt hierzu an, dass exogener Wandel in allen Kulturen einen größeren Stellenwert hat, da diesen somit die Aufgabe eigener Innovationen in diesem Bereich abgenommen und so die Entwicklung der Kultur beschleunigt wird. In den meisten Kulturen seien daher nur wenige Elemente auf eigene Erfindungen und Neuerungen zurückzuführen, was einer Theorie von nacheinander zu durchlaufenden Kulturstufen widerspricht.
Die lokale Partizipation an der Tourismusentwicklung hat nach COHEN (vgl. 1993: 70f.) entscheidenden Einfluss auf die Art des kulturellen Wandels. Er unterscheidet hier zwischen organischer und induzierter Entwicklung der Branche, wobei Erstere von Einheimischen initiiert, also von der lokalen Bevölkerung kontrolliert wird. Unter Letzterer versteht er eine Entwicklung, die in erster Linie auf die Initiative von Unternehmern außerhalb der Region ausgeht, weshalb hier die Einheimischen weniger Einflussmöglichkeiten besitzen. Der kulturelle Wandel ist im zweiten Fall daher ausgeprägter, da er exogen motiviert wird. Ähnlich argumentiert auch Dennison NASH, indem er eine Verbindung zwischen Tourismus und Imperialismus herstellt. Der kulturelle Wandel hängt von der Machtverteilung innerhalb des Tourismus ab, die meist zugunsten der Touristen ausfällt. Wird die touristische Entwicklung aber zusätzlich noch exogen von den nationalen wie internationalen Metropolen induziert, fällt die Orientierung der lokalen Bevölkerung an fremden Werten noch stärker aus (vgl. NASH nach PLATZ 1995: 30).
Den Unterschied zwischen dem ständig ablaufenden und dem durch Tourismus verursachten Kulturwandel sehen Theron NUNEZ und James LETT ebenfalls in den auslösenden Akteuren. „Innovatoren bei langsamen kulturellem Wandel sind die traditionellen Führer, während bei tourismusinduziertem Wandel (...) die sogenannten marginal men die entscheidende Rolle spielen“ (NUNEZ / LETT nach PLATZ 1995: 31). Diese marginal men sind Außenseiter oder Randfiguren der Gesellschaft, welche nicht so stark in die kulturellen Werte- und Normensysteme eingebunden sind.
Robert WOOD (vgl. 1993: 51ff.) wendet sich gegen die aus der Modernisierungstheorie stammende Aussage, dass Modernisierung Traditionen abschaffe und daher das Bewahren der Traditionen mit Modernisierung nicht vereinbar sei. Er weist auf verschiedene Fälle hin, in denen der Tourismus zu einer stärkeren Beachtung der Kultur und Wiederbelebung traditioneller Praktiken in der einheimischen Bevölkerung geführt habe. Wenn die eigene Kultur und Traditionen als touristisches Potential erkannt werden, kann dies durchaus sogar zu einer Stärkung der kulturellen Identität führen. Ähnlich argumentiert Michael FLITNER (vgl. 1997: 87ff.), wenn er hervorhebt, dass Tourismus sowohl modernisierende als auch traditionserhaltende Wirkungen haben kann, wobei die Vorstellung der kulturzerstörenden Wirkung des Tourismus ohnehin nicht unproblematisch ist, da sie eine eurozentrische Denkfigur aus der Zeit der europäischen Expansion mit transportiert. Die Zuschreibung von Tradition, natürlicher Lebensweise oder authentischen Kulturen, welche von den modernen Kulturen Europas zerstört werden, impliziert eine Degradierung zu unterlegenen, verletzlichen und passiven Gesellschaften[15]. „In der Bewunderung eines >Naturvolkes< ist die Verachtung ob seiner Machtlosigkeit schon mitgedacht“ (ebd.: 87).
2.2.3. Akkulturation
Nach der Beschreibung verschiedener Bedingungen und Formen des Kulturwandels im Zusammenhang mit Tourismus soll nun genauer auf den Prozess dieses Wandels eingegangen werden, der in der Literatur meist mit Akkulturation umschrieben wird. Der Begriff geht auf Richard THURNWALD zurück, der 1932 Akkulturation als einen Anpassungsprozess definierte und damit die breitere Diskussion in den Geisteswissenschaften um dieses Phänomen auslöste. Viele Studien zu diesem Thema beziehen sich auf eine Definition von REDFIELD, LINTON und HERSKOVITS, die vier Jahre später eine Definition im „Memorandum for the Study of Acculturation“ festlegten: „Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continous first-hand contact, with subsequent changes in the original culture patterns of either or both groups“ (REDFIELD / LINTON / HERSKOVITS nach WAHRLICH 1984: 48f.; PLATZ 1995: 50; LÜEM 1985: 49).
Damit handelt es sich bei der Akkulturation immer um einen exogenen Kulturwandel, der nach WAHRLICH durch „ein länger andauerndes Zusammenwirken“ (WAHRLICH 1984: 49) der beteiligten Kulturen hervorgerufen wird. Im Gegensatz zu dieser Definition werden aber bei WAHRLICH (1984: 49) und bei PLATZ (1995: 50f.), mit Verweis auf RUDOLPH, auch Wandlungsprozesse als Akkulturation verstanden, die nicht durch einen direkten, zusammenhängenden Kontakt entstehen. Teilweise wird der Begriff auf Phänomene eingeschränkt, die zwischen zwei heterogenen Kulturen auftreten, bei denen eine gegenüber der anderen dominant ist (vgl. PLATZ 1995: 51), oder noch spezieller auf Kulturwandel durch das Einwirken der westlichen Welt auf Entwicklungsländer[16] (vgl. LÜEM 1985: 52f.). Dieses Verständnis von Akkulturation liegt auch dieser Arbeit zugrunde, da der internationale Tourismus nach Entwicklungsländern als komplexes Phänomen einen derartigen Kulturkontakt darstellt. MAURER (1992: 88) unterscheidet weiterhin noch in passive und aktive Akkulturation, wobei Erstere die Aufnahme von fremden Kulturelementen unter Beibehaltung der grundlegenden Werte- und Normenstrukturen bedeutet. Im zweiten Fall wird ein komplett neues System übernommen, welches das Alte ersetzt.
Die Form der Akkulturation, also aktive oder passive, und das Ausmaß des Kulturwandels wird von Rahmenbedingungen des Akkulturationsprozesses bestimmt, wozu Lüem (vgl. 1985: 54f.) die Kontaktsituation und die Kontaktart zählt. Als Situation werden hier die ökologische Umwelt, die Beziehung der Kultur zur Natur, der Ort des Kontaktes, demographische Merkmale der involvierten Bevölkerung und deren ökonomische Struktur verstanden, was direkten Einfluss auf die Häufigkeit und Intensität der Kontakte hat. Unter Kontaktart werden die Intentionen und Motive, und damit in Zusammenhang die übernommenen sozialen Rollen der beteiligten Kulturträger verstanden. Bei einer Betrachtung der Rahmenbedingungen im Ferntourismus wird nun ersichtlich, dass hier nur bestimmte Ausschnitte der beteiligten Kulturen interagieren.
Um diesen Aspekt zu veranschaulichen, hat Marion THIEM (1994: 37ff.) einen Ansatz von JAFARI erweitert und stellt die interkulturelle Interaktion im Ferntourismus in einem Vier-Kulturen-Schema dar. Demnach treten im Tourismus nicht einfach die Kulturen der Herkunftsstaaten und der Zielregionen miteinander in Kontakt, sondern eine Ferienkultur, die sich aus den Kulturen der Industriegesellschaften entwickelt, trifft auf eine Dienstleistungskultur der Einheimischen, welche vom Tourismus betroffen sind. Dieses Konzept berücksichtigt daher sowohl die besonderen Rollen der Touristen während ihrer Reise, als auch das Verhalten der Einheimischen, die aus ökonomischen Gründen versuchen, erwartete Stereotypen und Wunschvorstellungen ihrer Gäste zu erfüllen. Die Größe der einzelnen Kulturen und deren Schnittmengen miteinander stellen die Rahmenbedingungen dar, innerhalb derer es zu Akkulturationsprozessen kommt. Auf den Unterschied der Rollenkonzepte der interagierenden Kulturträger zu deren Alltagsrollen zielt auch Heinz-Günter VESTER (vgl. 1997: 68ff.) ab, wenn er die Theorie der Selbstdarstellung im Alltag von Erving GOFFMAN auf die Situation im internationalen Tourismus überträgt. Demnach wird für die Reisenden auf der Vorderbühne der touristischen Situation die Kultur der Einheimischen inszeniert, was auf der Hinterbühne des Alltags der Bereisten mühevoll vorbereitet wird. Die Hinterbühne wird jedoch durch starke Expansion des Tourismus zunehmend von der Vorderbühne beeinflusst, wodurch Elemente der Dienstleistungskultur Eingang in die ursprüngliche Kultur der Zielregion finden (vgl. LUGER 2001: 10f.). Die Hinterbühne stellt aber für die Bevölkerung der Zielregion auch eine Art Schutzzone dar, in die gerade im Ferntourismus von Touristen auf der Suche nach Authentizität oft eingedrungen wird. Erik COHEN (vgl. 1995: 17f.) sieht daher auch in der Aufrechterhaltung dieser Vorder-/ Hinterbühnenunterscheidung ein Instrument zur Bewahrung indigener Kulturen.
Die verschiedenen Teilprozesse, die im Verlauf der Akkulturation vorkommen können, hat LÜEM (vgl. 1985: 63ff.) in Bezug auf den Ferntourismus eingehender untersucht und inhaltlich sowie in der zeitlichen Abfolge gegeneinander abgegrenzt. Der Akkulturationsprozess wird durch die bewusste oder unbewusste Demonstration der kulturellen Differenz von Seiten der Touristen initiiert. Das beginnt bereits bei der bloßen physischen Präsenz und zeigt sich vor allem durch das besondere Rollenverhalten der Reisenden als Träger ihrer Ferienkultur. Das besonders luxuriöse Konsumverhalten und die auf Vergnügen ausgerichteten Aktivitäten verstärken den Abstand zum Alltagsleben der Einheimischen über bereits bestehende ökonomische Ungleichheiten hinaus.
Durch eine Selbstreflexion der Bereisten hinsichtlich ihrer eigenen Situation im Vergleich zu den fremdartigen Lebensstilen ihrer Besucher entsteht ein Demonstrationseffekt, der sich in einem Inferioritätskomplex der bereisten Bevölkerung äußern kann. Nach LÜEM
„umfasst der Demonstrationseffekt im Prinzip nur die Bewusstwerdung kultureller Unterschiede bei Einheimischen, impliziert aber noch keine direkten oder indirekten sozio-kulturellen Veränderungen der eigenen Kultur, sondern er bereitet nur das Klima dafür vor“ (ebd.: 68).
Sowohl die Demonstration wie auch die daraus resultierenden Effekte beziehen sich jedoch in erster Linie auf äußerliche Kulturelemente, die von dem Verhalten der Touristen ableitbar sind (siehe Abbildung 2.1).
Abbildung 2.1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Treten als Demonstrationseffekt derartige Unterlegenheitsgefühle auf, wie es im Ferntourismus aufgrund der starken ökonomischen Unterschiede zwischen den beteiligten Individuen häufig vorkommt, versuchen Einheimische durch Imitation der äußerlichen Merkmale und Verhaltensmuster ihre eigene Position aufzuwerten. Davon sind besonders die Jugendlichen der Zielgebiete betroffen, da sie sich selbst noch in der Sozialisation befinden und die eigenen Kulturelemente noch nicht vollständig internalisiert haben.
Als Imitationseffekte zeigen sich besonders bei Jugendlichen Spannungen aufgrund von Fehlanpassungen zwischen einzelnen Kulturelementen, was auch im Erwachsenenalter als kulturelle Orientierungsschwäche erhalten bleibt. Da diese Imitationen nur von einem Teil der Bevölkerung vorgenommen werden und allgemein oberflächlichen Charakter haben, tritt als Imitationseffekt auch eine Schwächung der kulturellen Homogenität ein.
Eine Steigerung des Imitationseffektes ist der Identifikationseffekt, bei dem nicht mehr nur relativ zufällig einzelne, äußerliche Kulturelemente übernommen werden, sondern eine vollkommene Identifikation mit der überlegenen Kultur erfolgt. Kulturelle Normen und Wertesysteme der eigenen Kultur werden dabei vollständig aufgegeben, weshalb dies den extremsten Effekt der Akkulturation darstellt, der jedoch nur gelegentlich festzustellen ist und nicht dem Tourismus allein angerechnet werden kann.
Neben diesen drei Unterarten von Akkulturationserscheinungen stehen die Akkulturationseffekte, zu denen LÜEM alle sozio-kulturellen Wandlungen zählt, welche nicht durch eine direkte Begegnung mit Trägern anderer Kulturen initiiert werden. Das sind alle Wirkungen auf die Kultur, die nicht direkt von dem Verhalten der Touristen ausgehen, jedoch als Folgen des Tourismus gelten, wie beispielsweise Veränderungen der Architektur, oder kommerzielle Aufführungen traditioneller Rituale.
Wie in diesem Kapitel deutlich wurde, nimmt der Kulturwandel im Prozess gesellschaftlicher Entwicklung eine zentrale Stellung ein. Die Vernachlässigung der kulturellen Unterschiede verschiedener Gesellschaften wird beiden großen Entwicklungstheorien angelastet und führte zu den erheblichen Erklärungsdefiziten hinsichtlich unterschiedlicher Entwicklungen, trotz ähnlicher ökonomischer Rahmenbedingungen. Daher muss in einer Fallstudie über tourismusinduzierte Wirkungen auf Entwicklung einer Region der Kontaktsituation und –art, sowie der Form des Kulturwandels besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dabei ist zu prüfen, ob der Kulturwandel in einem modernisierungstheoretischen Sinn entwicklungshemmende Traditionen abschafft und zu Modernisierung und Entwicklung der Gesellschaft führt, oder ob durch den exogenen Kulturwandel dependenztheoretisch kulturelle Fehlanpassungen erzeugt werden, die teilweise zur Übernahme der westlichen Kultur führen und in verstärkte Unterentwicklung der Gesellschaft münden.
[...]
[1] Dieser Begriff ist gerade in der entwicklungstheoretischen Diskussion nicht unumstritten, daher werde ich mich in diesem Kapitel auch noch speziell damit beschäftigen. Bis dahin bleibt er aber in Anführungszeichen gesetzt.
[2] Den Begriff dieser Basisinstitutionen leitet ZAPF von den evolutionären Universalien einer Gesellschaft bei PARSONS ab.
[3] Als Vertreter werden von SCHERRER und MENZEL v.a. Walt ROSTOW; bei MENZEL aber u.a. auch Max WEBER, Talcott PARSONS, Samuel EISENSTADT; Reinhard BENDIX genannt. Wolfgang ZAPF zählt auch S. ROKKAN, R. ARON und R. DAHRENDORF hinzu.
[4] Dieses Argument geht auf die U-Hypothese Simon KUZNETS zurück, welche besagt, daß die Ungleichheit der Einkommensverteilung zu Beginn der Industrialisierung stärker wird, in deren Verlauf aber wieder zurück geht (vgl. Menzel 1992: 135f.).
[5] Darunter wird der Quotient verstanden, der sich aus dem Verhältnis zwischen dem Index der Ausfuhrpreise und dem der Einfuhrpreisen bildet (vgl. KLIMA 1995: 674).
[6] Siehe zu diesem Punkt auch in Kapitel 2.2. die Ausführungen zu Akkulturationstheorien.
[7] Die Hauptvertreter werden bei MENZEL in André Gunder FRANK, sowie in Fernando CARDOSO und Enzo FALETTO gesehen. SCHERRER ordnet diese der marxistischen Hauptströmung zu, der er eine fortschrittliche, bürgerliche und nationalistische Strömung gegenüberstellt. Diese wird hier von FURTADO und Osvaldo SUNKEL vertreten.
[8] Ein entwicklungsstrategisches Konzept von Samir AMIN.
[9] Als Humankapital werden die menschlichen Fähigkeiten (Wissen) bezeichnet, welche durch Bildung verbessert werden können und die im Verwertungsprozess der Arbeit in monetäre Erträge umsetzbar sind (vgl. KRAUSE 1995: 281).
[10] Zum Beispiel innerhalb der Gesellschaft ein ungleicher Abbau der Sozialleistungen oder der Verlust von Arbeitsplätzen (vgl. ALTVATER / MAHNKOPF 1997: 50f.).
[11] Der kulturelle Bereich wird zwar auch von Vereinheitlichungstendenzen geprägt, was sich zum Beispiel an globalisierten Konsummustern zeigt. ALTVATER stellt jedoch fest, dass eine „kulturelle Vereinheitlichung auf Erden (...) trotz Weltmarkt und globaler Medien bis heute nicht erfolgt“ (ders. 1997: 46) ist, da nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung in diese integriert wurde, während der größere Teil davon Ausgeschlossen bleibt.
[12] Der Begriff „Fraktalisierung“ weist auch auf die Einfachheit der einzelnen Elemente des Weltsystems hin, während deren Zusammenspiel höchst komplexer Natur ist (vgl. ALTVATER / MAHNKOPF 1997: 106).
[13] Zu weiteren Diskussion der Kultur und des Kulturwandels im Zusammenhang mit Tourismus: Roland Platz, 1995; Marion Thiem 1994; Thomas Lüem 1985.
[14] Mit Umwelt ist hier im Sinne der Systemtheorie neben der natürlichen Welt auch die Technologie, die ökonomische und politische Organisation und Religion gemeint.
[15] In Bezug auf diesen Kritikpunkt hält TIBI die Aussage der Überlegenheit einer industriellen gegenüber einer vorindustriellen Kultur nicht für ein Werturteil, sondern für eine Faktizität (vgl. TIBI nach LÜEM 1985:52f.).
Häufig gestellte Fragen
Was sind die theoretischen Grundlagen und Konzepte, die in Bezug auf Tourismus und Entwicklung diskutiert werden?
Der Text befasst sich mit den theoretischen Grundlagen und Konzepten im Zusammenhang mit den Auswirkungen des internationalen Tourismus auf die Entwicklung von Regionen, insbesondere in der "Dritten Welt". Es werden entwicklungstheoretische Diskussionen, Modernisierungs- und Dependenztheorien, aktuelle Ansätze in der Entwicklungsdiskussion sowie Kulturwandel und Akkulturation behandelt.
Was ist die entwicklungstheoretische Diskussion im Kontext des Tourismus?
Die entwicklungstheoretische Diskussion untersucht die Auswirkungen des internationalen Tourismus auf die Entwicklung von bereisten Gebieten. Dabei werden Fragen nach der Definition von Entwicklung, diskutierten Entwicklungsstrategien und den zugrunde liegenden theoretischen Grundlagen gestellt. Der Tourismus wird sowohl als Entwicklungsstrategie als auch als Entwicklungshemmnis betrachtet.
Was sind Modernisierungs- und Dependenztheorien?
Die Modernisierungstheorie, basierend auf Max Webers Modernitätsbegriff, sieht die westliche Modernisierung als global gültiges Modell für Entwicklung. Die Dependenztheorie kritisiert dies und argumentiert, dass die Ursachen der Unterentwicklung in exogenen Faktoren, insbesondere den Beziehungen zum Weltmarkt, liegen.
Was sind die Hauptkritikpunkte an Modernisierungs- und Dependenztheorien?
Beide Theorien werden kritisiert, weil sie sich hauptsächlich auf die wirtschaftliche Dimension der Entwicklung konzentrieren und kulturelle Unterschiede vernachlässigen. Die Modernisierungstheorie wird kritisiert für ihre eurozentrische Sichtweise, während die Dependenztheorie in Erklärungsnot gerät, wenn Länder trotz Abkoppelung vom Weltmarkt keine positive Entwicklung erfahren.
Was ist der gegenwärtige Stand der Entwicklungsdiskussion?
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Scheitern des sozialistischen Entwicklungsmodells hat sich die Entwicklungsdiskussion neu orientiert. Es gibt keinen Konsens über ein allgemeingültiges Entwicklungsmodell mehr, und es werden vermehrt nachhaltige Entwicklungskonzepte diskutiert.
Welche neueren theoretischen Ansätze werden in der Entwicklungsdiskussion behandelt?
Der Text geht auf weiterentwickelte Modernisierungstheorien, neoklassische Theorien des Freihandels, das Neofaktorproportientheorem, das Konzept der systemischen Wettbewerbsfähigkeit sowie erneuerte Dependenztheorien und die Theorie der Globalisierung ein.
Wie wird Kultur im Kontext von Tourismus und Entwicklung definiert?
Kultur wird als die Art und Weise, wie Menschen leben und was sie aus sich selbst und ihrer Welt machen, verstanden. Dazu gehören Verhaltensweisen, soziale Beziehungen, Ideen, Konzepte, Werte und die Beziehung zur Umwelt. Der Text betont, dass die Definition von Traditionellen Kulturelementen einem Wandel unterliegt und somit keine feste Einheit bildet.
Was sind Kulturwandel und Akkulturation?
Kulturwandel beschreibt die fortwährenden Anpassungsprozesse von Kulturen. Er kann endogen (durch Innovationen innerhalb einer Kultur) oder exogen (durch Kulturkontakte) verursacht werden. Akkulturation ist ein spezieller Fall von Kulturwandel, der durch den Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen entsteht, wobei eine Kultur die andere beeinflussen kann.
Wie beeinflusst der Tourismus Kulturwandel und Akkulturation?
Der Tourismus kann zu verschiedenen Formen des Kulturwandels führen, darunter organische (von Einheimischen initiiert) und induzierte Entwicklung (von externen Akteuren initiiert). Die Art und das Ausmaß des Kulturwandels hängen von der Kontaktsituation, der Kontaktart und der Machtverteilung innerhalb des Tourismus ab. Akkulturationseffekte können Demonstrationseffekte, Imitationseffekte und Identifikationseffekte umfassen.
Was ist das Vier-Kulturen-Schema im Ferntourismus?
Das Vier-Kulturen-Schema stellt die interkulturelle Interaktion im Ferntourismus dar, bei der eine Ferienkultur (aus Industriegesellschaften) auf eine Dienstleistungskultur der Einheimischen (betroffen vom Tourismus) trifft.
Was sind Demonstrationseffekte, Imitationseffekte und Identifikationseffekte im Kontext der Akkulturation?
Demonstrationseffekte sind die Bewusstwerdung kultureller Unterschiede bei Einheimischen. Imitationseffekte sind Versuche, die äußerlichen Merkmale und Verhaltensmuster der Touristen zu imitieren. Identifikationseffekte sind die vollkommene Identifikation mit der überlegenen Kultur.
Welche Bedeutung hat die Analyse von Kulturwandel und Akkulturation für eine Fallstudie über Tourismus und Entwicklung?
In einer Fallstudie über tourismusinduzierte Wirkungen auf Entwicklung einer Region muss der Kontaktsituation und –art, sowie der Form des Kulturwandels besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um zu prüfen, ob der Kulturwandel im modernisierungstheoretischen Sinn entwicklungshemmende Traditionen abschafft oder ob dependenztheoretisch kulturelle Fehlanpassungen erzeugt werden, die teilweise zur Übernahme der westlichen Kultur führen und in verstärkte Unterentwicklung der Gesellschaft münden.
- Quote paper
- Stefan Zimmer (Author), 2002, Die Entwicklung sozialer Strukturen im indischen Himalaya unter der Einwirkung des internationalen Tourismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/110011