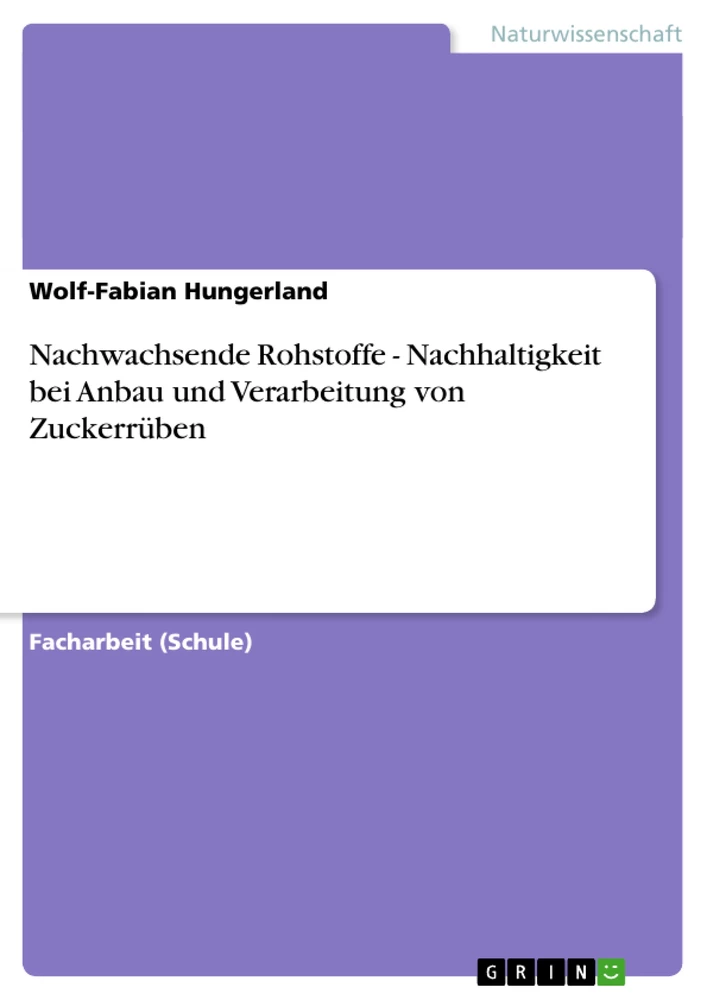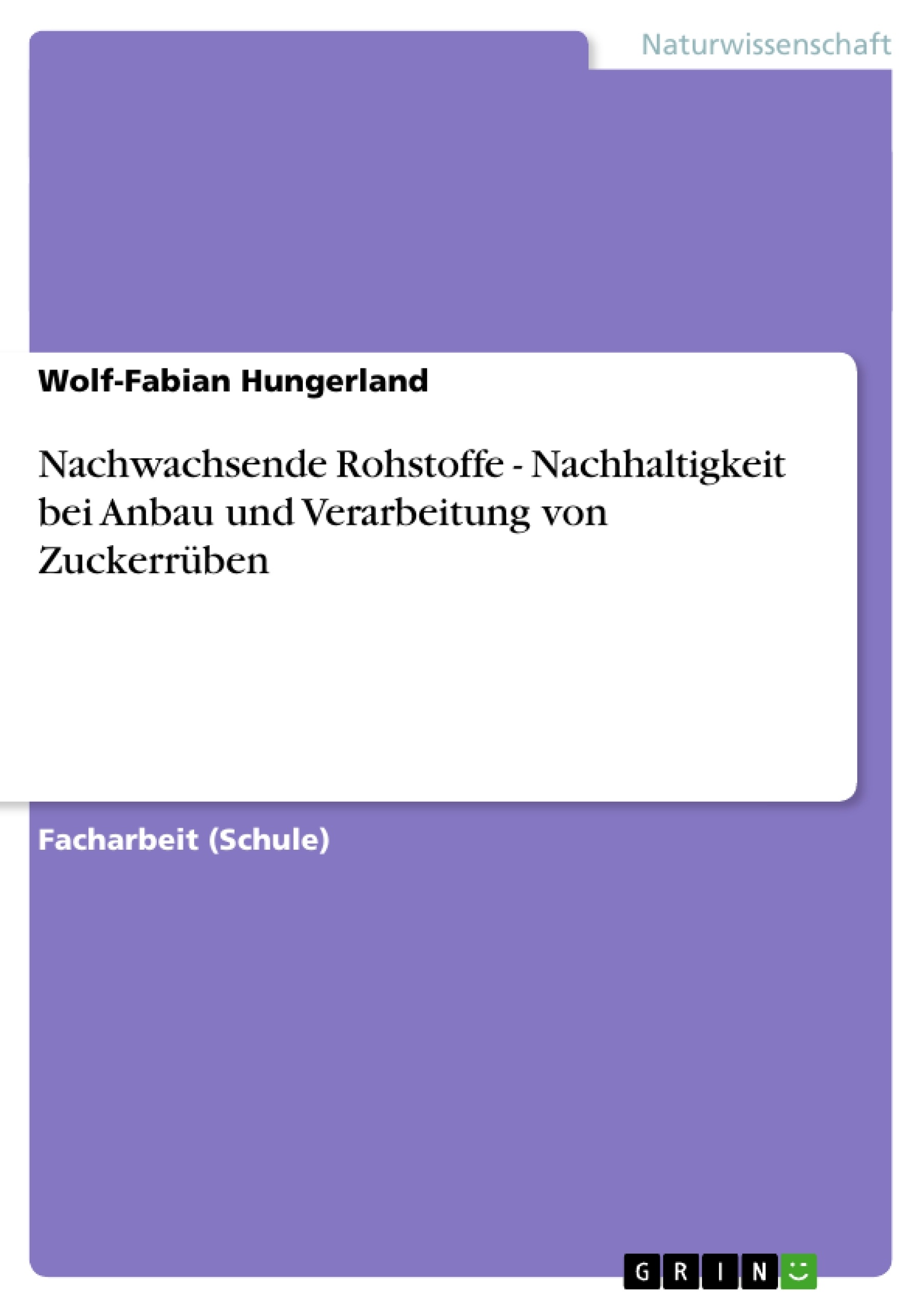Stellen Sie sich vor, ein Feld voller unscheinbarer Zuckerrüben birgt das Potenzial für eine nachhaltige Zukunft – weit mehr als süßer Genuss. Diese umfassende Analyse enthüllt die überraschenden Facetten des Zuckerrübenanbaus und der Zuckergewinnung im Kontext der Nachhaltigkeit. Von der Reduzierung des Energieverbrauchs durch innovative Anbaumethoden und präzise Düngung bis hin zur Minimierung des Pflanzenschutzes durch resistente Züchtungen und optimierte Applikationstechniken, werden alle Aspekte beleuchtet. Das Buch untersucht die Bedeutung der Fruchtfolge, Mulchsaaten und bodenschonenden Erntetechniken für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und den Schutz der Umwelt. Es zeigt, wie die deutsche Zuckerindustrie kontinuierlich daran arbeitet, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, indem sie Abfallprodukte verwertet, die Wassernutzung optimiert und Kraft-Wärme-Kopplung einsetzt. Doch damit nicht genug: Die Zuckerrübe erweist sich als vielseitiger Rohstoff, der nicht nur Zucker liefert, sondern auch die Grundlage für Bioethanol bildet, einen nachhaltigen Treibstoff der Zukunft. Entdecken Sie, wie der Zuckerrübenanbau zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beiträgt und gleichzeitig die ländliche Wirtschaft stärkt. Dieses Buch ist eine Pflichtlektüre für alle, die sich für nachhaltige Landwirtschaft, erneuerbare Energien und die Zukunft unserer Umwelt interessieren. Es bietet fundierte Einblicke in die Herausforderungen und Chancen einer Branche, die sich aktiv für eine nachhaltige Entwicklung einsetzt. Erfahren Sie mehr über Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Biodiversität, integrierten Pflanzenschutz, Fruchtfolgen, Direktsaat, Zwischenfruchtanbau, Wassermanagement, Kreislaufwirtschaft, Umweltschutz, Nachhaltigkeitsstrategien, Treibhausgasreduktion und Biokraftstoffe im Zusammenhang mit Zuckerrüben. Ein umfassender Überblick für Landwirte, Agrarwissenschaftler, Politiker und umweltbewusste Verbraucher, die verstehen wollen, wie die Zuckerrübe zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen kann. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Landwirtschaft und Umweltschutz Hand in Hand gehen, und lassen Sie sich von den innovativen Lösungen der Zuckerindustrie inspirieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2.1. Energieeinsatz im Zuckerrübenanbau
2.1.1. Bodenbearbeitungsintensität
2.1.2. Stickstoff-Dünger
2.2. Weitere Nachhaltigkeitsaspekte beim Zuckerrübenanbau
2.2.1 Bioethanol
2.2.2. Wachstumsfaktoren
2.2.3. Fruchtfolge
2.2.4. Mulchsaaten
2.2.5. Züchtung
2.2.6. Pflanzenschutzmaßnahmen
2.2.6.1. Herbizide
2.2.6.2. Insektizide
2.2.6.3. Fungizide
2.2.7. Erntemaschinen
2.2.8. Die vertragliche Bindung
2.2.9. Forschungs- und Beratungsstrukturen
3.1. Nachhaltigkeitsaspekte bei der Zuckerraffinierung
3.1.1. Verbesserte Rodetechniken und Reinigungsmaßnahmen auf dem Feld
3.1.2. Logistik
3.1.3. Melasse
3.1.4. Wassernutzungseffizienz
3.1.5. Kraft-Wärme-Kopplung
4.1. Diskussion
1. Vorwort
Die Bedeutung Nachwachsender Rohstoffe wächst heutzutage immer mehr durch die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten, die sich ihnen durch moderne Technologien und Forschung in der heutigen Zeit erschließen. Verwendungszweck dieser Rohstoffe kann die industrielle Weiterverarbeitung, aber auch die Erzeugung von Wärme, Strom und anderen Energieformen sein. Im Jahr 2003 wuchsen auf rund 8% der deutschen Ackerflächen nachwachsende Rohstoffe, Tendenz steigend. Die Gründe für die Ausweitung der Anwendungsmöglichkeiten nachwachsender Rohstoffe sind sowohl ökonomischer, ökologischer als auch sozialer Art. Der Begriff Nachhaltigkeit vereinigt diese drei Aspekte und „bezeichnet eine Entwicklung, welche den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen“1. Da nachwachsende Rohstoffe ihre fossilen Konkurrenten mittlerweile in vielen Bereichen ersetzen bzw. ergänzen können, ermöglichen sie einen Einstieg in Kreislaufwirtschaftssysteme und damit in die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaftsform im Sinne der auf der Agenda 21 in Rio de Janeiro beschlossenen „Nachhaltigen Entwicklung“. Auch die Bundesregierung strebt in der „Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland“2 dem Ausbau der energetischen Nutzung von Biomasse in Deutschland entgegen und will bis 2010 diese verdreifachen. Somit können Nachwachsende Rohstoffe nachhaltige Dienstleistungen für die ganze Gesellschaft erbringen:
- Durch ihre C0²-neutrale Nutzung entsteht kein zusätzlicher Treibhauseffekt.
- Sie ermöglichen durch ihre Regenerierung eine unendliche, umweltschonende Nutzung, sind also keine „ökologischen Einbahnstraßen“.
- Sie tragen zur Schonung endlicher fossiler Ressourcen (Erdöl, Erdgas, Kohle) bei.
- Sie eröffnen Möglichkeiten zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft.
- Sie bieten Chancen für innovative Entwicklungen, welche samt deren Endprodukten weltweit vermarktet werden können.
- Durch nachwachsende Rohstoffe profitiert der ländliche Raum. Es werden Arbeitsplätze erhalten und neue geschaffen.
- Sie bieten den Landwirten attraktive Produktions- und Einkommensalternativen.
Ein gutes Beispiel für all diese Nachhaltigkeitsaspekte stellt der Anbau, die Nutzung und die Verarbeitung des Rohstoffes Zuckerrübe im Sinne einer tatsächlichen Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland dar. Zudem werden Zuckerrüben in vielen Regionen Deutschlands angebaut und gehören zur hiesigen Kulturlandschaft. Ferner stellt das aus Zucker gewonnene Bioethanol eine aktuelle und biogene Kraftstoffalternative dar. Deshalb habe ich mich für eine intensive Betrachtung aller Produktions- und Verarbeitungsvorgänge rund um den Rohstoff Zuckerrübe entschieden...
2.1. Energieeinsatz im Zuckerrübenanbau
Beim Anbau von Zuckerrüben werden ca. 17 000 Mega-Joule (MJ) pro Hektar und Jahr an Primärenergie aufgewendet. Beispielsweise beträgt damit bei einem Ertragsniveau von 57t/ha der durchschnittliche Energieinput 0,3MJ je kg Rübe3. In der Wachstumsphase wandeln die Pflanzen aus dem Sonnenlicht gewonnene Energie in Pflanzenbiomasse um, so dass zur Ernte mit den Rüben eine Energiemenge von schätzungsweise 4 MJ je kg Rübe vom Feld transportiert wird (s. Grafik 2). Mit dem Anbau von Zuckerrüben kann somit ein Nettoenergiegewinn von etwa 210000 MJ/ha und Jahr erzielt werden. Verglichen z.B. mit Winterweizen ist der Primärenergieaufwand mit 16000 MJ/ha und Jahr insgesamt etwas niedriger als bei Zuckerrüben. Für ein Ertragsniveau von 7,6t Korn/ha ergibt sich jedoch ein durchschnittlicher Energieaufwand von 15,8 MJ/kg Korn. Ähnlich wie bei anderen Getreidesorten ist mit Winterweizen also nur ein vergleichsweise geringer Nettoenergiegewinn von 109000 MJ/ha und Jahr umsetzbar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Neben der Ertragsleistung der Feldfrüchte ist zudem auch bedeutend, wie viel Energie zur Erzielung des Ertrags aufgewendet werden muss. Eine effiziente Produktion sollte einen möglichst hohen Nettoertrag erzielen. In der Pflanzenproduktion wird Primärenergie bisher fast ausschließlich in Form fossiler Rohstoffe eingesetzt.
Entsprechend des internationalen UN-Abkommens zur Reduzierung von Treibhausgasen (Kyoto, 1997) stellt die Eindämmung der Freisetzung von Treibgasen einen der Schwerpunkte der EU-Strategie für eine nachhaltige Entwicklung und somit auch der Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland dar. Hauptsächlich der besondere Einsatz fossiler Energieträger trägt durch die C0²-Freisetzung zum Treibhauseffekt bei und wird meistens noch von weiteren, für die Umwelt nachteiligen Emissionen begleitet. Neben der möglichst effizientesten Nutzung der fossilen Energieträger, versucht die deutsche Zuckerindustrie bis zum Jahr 2005 eine Reduzierung des Ausstoßes klimarelevanter Gase von ca. 45 % zu erreichen.
Der größte Teil des Bedarfs an Primärenergie beim Zuckerrübenanbau wird für die Kraft- und Schmierstoffe und den mineralische Stickstoffdüngen aufgewendet (s. Grafik 3). Bei den Kraftstoffen stellt Diesel den größten Anteil, da dieser bei der Bodenbearbeitung für Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen verwendet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.1.1. Bodenbearbeitungsintensität
Von daher könnte eine verringerte Bodenbearbeitungsintensität zu Einsparungen beim Dieselverbrauch beitragen, wie Ergebnisse aus dem mehrjährigen Gemeinschaftsprojekt Bodenbearbeitung zeigen. Wird die Bodenbearbeitung konsequent flach, bis 10 cm Tiefe durchgeführt, so mindert dies den Aufwand an Primärenergie um durchschnittlich 1300 MJ/ha und Jahr bzw. um 7,5% gegenüber dem herkömmlichen Anbauverfahren, in dem jährlich gepflügt wird. Es lassen sich im Mittel aller im Projekt beteiligten zehn Standorte bereinigte Zuckererträge verzeichnen, die von der verminderten Bearbeitungsintensität unbeeinflusst blieben. Hier gibt es also noch weitere Möglichkeiten, die Effizienz der fossilen Energieträger zu erhöhen und gleichzeitig deren Verbrauch zu mindern.
2.1.2. Stickstoff-Dünger
Desweiteren lässt sich durch genaue Dosierung der Konzentration des eingesetzten mineralischen Stickstoff-Dünger, welcher eine energieaufwändige Produktion einher bringt, der Energieeinsatz im Zuckerrübenanbau optimieren. Die ideale Höhe der Stickstoffdüngung ist durch viele Versuche bereits herausgefunden und dokumentiert worden. Eine zeitgemäße Umstrukturierung der Anbauverfahren hat dazu geführt, dass im Vergleich zu 1980, wo durchschnittlich noch über 200 kg N-Dünger pro ha verwendet wurden, auf ca. 75% der Rübenanbaufläche in Deutschland heute weniger als 120 kg N/ha zu Zuckerrüben ausgebracht werden. In Süddeutschland liegt der Anteil von Rübenanbauflächen auf denen unter 80 kg N/ha gedüngt wird sogar bei 44%. Im Bereich der Düngung wird die Zuckerrübe also immer mehr von einer Intensivfrucht zu einer Extensivfrucht. Zugleich ist eine übermäßige Bemessung der Stickstoffdüngung nachteilig für die Qualität und die Verarbeitung des Rohstoffes Rübe. Die Zuckerfabriken benötigen nämlich für die Verarbeitung von Rüben mit hohen Stickstoffanteilen mehr Kalkstein und Primärenergie und zudem sinkt die Weißzuckerausbeute bei paralleler Zunahme der Produktion von Nebenprodukten wie z.B. Melasse. Insgesamt wird der Verarbeitungsprozess in der Raffinerie also auch unter energetischen Gesichtspunkten ineffizienter, weil trotz eines größeren Aufwandes ein schlechteres Ergebnis erzielt wird.
2.2. Weitere Nachhaltigkeitsaspekte beim Zuckerrübenanbau
2.2.1. Wachstumsfaktoren
Die effiziente Nutzung von Wachstumsfaktoren garantiert in der ausgedehnten Vegetationsperiode von März - April bis September - November die maximale Nutzung der Sonneneinstrahlung bis in den Spätherbst. Es wird sozusagen bestmöglich natürlich Primärenergie genutzt. Darüber hinaus weisen Zuckerrüben eine hohe Wassernutzungseffizienz auf. Sie benötigen relativ gesehen viel weniger Wasser zur Bildung eines Kilos Trockenmasse als viele andere Kulturpflanzen Mitteleuropas.
2.2.2. Fruchtfolge
Die Fruchtfolge beschreibt die zeitliche Abfolge von Kulturpflanzen auf einem Feld. Zuckerrüben werden immer im mehrjährigen Wechsel mit anderen Früchten, häufig mit Winterweizen, angebaut. Der Anbau von Zuckerrüben in Getreidefruchtfolgen verhindert eine einseitige Selektion der Unkrautflora und wirkt dem Auftreten von Pflanzenkrankheiten und Schädlingen entgegen. Da Zuckerrüben erst im Frühjahr ausgesät werden, kann die Lücke im Bewuchs zwischen der Ernte der Getreidevorfrucht und der Zuckerrübenaussaat für den Anbau einer Zwischenfrucht genutzt werden. Diese verbessern Bodenstruktur und Bodenleben, vermindern Nährstoffeintrag in das Grundwasser, unterdrücken die Entwicklung von Unkräutern (s. Mulchsaaten) und ermöglichen mit Wahl resistenter Sorten eine biologische Bekämpfung von Nematoden (s. Pestizide).
2.2.3. Mulchsaaten
Sommerfrüchte wie die Zuckerrübe, die mit einer vergleichsweise geringen Pflanzenzahl pro Flächeneinheit angebaut werden, benötigen im Frühjahr einige Zeit, bevor sie die Bodenoberfläche durch ein geschlossenes Blätterdach schützen. Um die Erosion durch Wasser oder Wind zu verhindern, sind Anbauverfahren erforderlich, bei denen Reststoffe von Vor- oder Zwischenfrüchten als Mulchschicht an der Bodenoberfläche verbleiben. In Deutschland werden so genannte Mulchsaaten zu Zuckerrüben bereits auf rund 100 000 ha, also auf ca. einem Viertel (22,8 %) der gesamten Rübenanbaufläche durchgeführt. Zudem fördern die schützende Mulchschicht in Kombination mit Bodenruhe die Entwicklung der Bodenlebewesen. Beispielsweise nehmen Anzahl und Aktivität von Regenwürmern unter diesen Bedingungen deutlich zu. Die angelegten Gangsysteme der Würmer fördern die Ableitung von Niederschlägen von der Oberfläche. Die Mulchdecke steigert die Bodenlebewesenaktivität, ist ein effektiver Erosions- und Verkrustungsschutz des Ackerbodens und steigert somit letztendlich dessen Tragfähigkeit.
2.2.4. Züchtung
Seit den 70er Jahren wird systematisch neben Ertragssteigerung auch zur Qualitätssteigerung Züchtung betrieben. So gelang es, die Gehalte der Inhaltstoffe, die die Zuckergewinnung erschweren (wie Kalium, Natrium o. Amino-Stickstoff), deutlich zu verringern. In jüngster Zeit wurde auch Resistenzzüchtung intensiv betrieben. Ohne Einsatz von ethisch bedenklichen gentechnischen Methoden gibt es seit zehn Jahren tolerante oder resistente Sorten gegen viröse Wurzelbärtigkeit (Rizomania), seit 1998 gegen den Rübenzystennematoden (Heterodera schachtii) und seit 2001 gegen pilzbedingte Rübenfäule (Rhizoctonia solani). Diese Entwicklung dient dem Ziel, durch neue Sorteneigenschaften kombiniert mit anbautechnischen Maßnahmen die Verwirklichung eines nachhaltigen und umweltgerechten Zuckerrübenanbaus zu erreichen.
2.2.5. Pflanzenschutzmaßnahmen
2.2.5.1. Herbizide
Nach dem Aufgang wachsen Zuckerrüben zunächst relativ langsam, und sind sehr empfindlich gegenüber Konkurrenz durch Unkräuter. Der unkrautbedingte Ertragsabfall kann ohne Pflanzenschutzmaßnahmen (Pestizide) bis zu 100% betragen. Pflanzenschutzmittel wurden noch in den 60er und 70er Jahren fast ausschließlich präventiv, d.h. bevor Unkräuter überhaupt wuchsen, also flächendeckend angewendet. Durch intensive Beratungsarbeit z.B. seitens des IfZ, wurde erreicht, dass in Deutschland Herbizide (Pflanzengifte) zu etwa 90% nur noch gezielt während oder nach der Keimung der Unkräuter eingesetzt werden (im sog. Nachauflaufverfahren im Keimblattstadium, NAK). Es wird die Tatsache genutzt, dass besonders die kleinen, gerade keimenden Unkräuter äußerst anfällig gegen Herbizide sind. Der Herbizideinsatz zu diesem Zeitpunkt verringert die Aufwandmengen deutlich und ermöglicht eine gezielte Auswahl von Wirkstoffen, da sowohl die Unkrautarten als auch deren Dichte vor der Anwendung der Pflanzenschutzmittel ermittelt werden können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das früher übliche Vorsaat-Einarbeitungsverfahren wurde durch das Nachauflaufverfahren ersetzt und später durch das Nachauflaufverfahren im Keimblattstadium verbessert. Der Herbizidaufwand sank bei geänderten Wirkstoffen und Dosierungen in der gesamten Ausbringungsmenge um mehr als die Hälfte ab (s. Grafik 4). Neuste Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass Zuckerrüben nur innerhalb der kurzen Phase vom Keimblatt bis etwa zum 6-Blatt-Stadium unkrautfrei gehalten werden müssen, danach muss eine Verunkrautung nicht mit Ertragseinbußen verknüpft sein. Praxistaugliche Umsetzungsmöglichkeiten bezüglich dieses Konzeptes sind bereits in der Ausarbeitung. Es erscheint also möglich, die Aufwandmengen und die Applikationen von Herbiziden in Zukunft weiter zu minimieren.
2.2.5.2. Insektizide
Aber auch das Auftreten bestimmter tierischer Schädlinge (wie z.B. die öfter auftretenden Rübenzystennematode [Fadenwürmer]) kann ohne Gegenmaßnahmen zu Ertragsverlusten führen. Der Einsatz chemischer Mittel gehört heute jedoch meistens der Vergangenheit an. So werden heute z.B. Nematode ausschließlich biologisch, durch Einsatz resistenter Zwischenfrüchte in der Fruchtfolge oder durch die Verwendung resistenter Zuckerrübensorten bekämpft. Bei starkem Insektenbefall ist jedoch eine aggressivere Bekämpfung nötig, da nicht nur direkte Fressschäden, sondern auch die unbewusste Übertragung von Blattkrankheiten (sog. Vektorübertragung) Ertragsbeeinflussend sind. Früher wurde in solchen Fällen das ganze Feld mit Insektiziden (Tiergifte) behandelt. Hier wurde versucht, möglichst ergiebig bei geringem Insektizieinsatz zu arbeiten. Die Flächenspritzung wurde zunächst durch die besser dosierbaren Granulatapplikationen in der Reihe ersetzt. Jedoch wird heute auch darauf weitestgehend verzichtet (s. Grafik 5), da durch das sog. Pillierungs-Verfahren eine Schutzhülle ummantelnd an das Saatgut angebracht wird, welches mit vergleichsweise viel geringeren Wirkstoffmengen die Rübe wirksam schützt. Da diese Insektizide nur dort wirken, wo dies auch nötig ist, kommen Boden und Unkräuter nur geringfügig mit den Wirkstoffen in Berührung. Es wird also das Risiko eines unerwünschten Austrags an die Umwelt durch Abdriftung, Verflüchtigung, Oberflächenabfluss oder durch Abwaschen der Insektizide praktisch ausgeschlossen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2.5.3. Fungizide
Darüber hinaus führen Blattkrankheiten zu einer Schädigung des Assimiliationsapparates (Umwandlungsfähigkeiten) der Rüben, verschlechtern die ihre Einlagerungsfähigkeit von Zucker und wirken damit ertragshemmend. Viröse Blattkrankheiten sind heute durch Resistenzzüchtung bzw. durch insektiziden Saatschutz zur Bekämpfung der Vektorübertragung beispielsweise durch Blattläuse praktisch beherrschbar geworden (s. Pestizide). Das pilzbedingte Auftreten von Blattkrankheiten ist jedoch witterungsabhängig und schwankt in den einzelnen Anbauregionen sehr stark. Die Schäden (meistens als Blattflecken erkennbar) können durchaus bedeutend sein und bedürfen oft des Einsatzes von Fungiziden (Pilzgifte). Jene kommen aber nur zum Einsatz, wenn ansonsten ein bedeutender wirtschaftlicher Schaden zu befürchten ist (Schadensschwellen-Konzept). Im Rahmen dieses Konzeptes führen offizielle Institutionen in Zusammenarbeit mit der Zuckerindustrie flächendeckende Beobachtungen der Befallsentwicklung (sog. Monitoring) durch und beraten Landwirte gezielt zum verantwortungsbewussten Einsatz von Fungiziden oder gar zum Verzicht auf diese. Eine Weiterentwicklung des Schadensschwellenkonzeptes soll in naher Zukunft in Kombination mit dem Anbau resistenter Sorten zu einer weiteren Fungizideinsatzreduzierung führen.
2.2.6. Erntemaschinen
Entsprechend dem Trend zur leistungs- und kostenorientierten Mechanisierung in der Landwirtschaft werden zur Zuckerrübenernte zunehmend größere und funktionsfähigere, oft computergesteuerte Erntemaschinen eingesetzt. Sie erreichen durch hohe Mobilität, Flexibilität, Wendigkeit und schnelle Betriebsbereitschaft auch in Gebieten mit kleineren oder unzugänglicheren Flächenstücken hohe Flächenleistungen. Selbst die oft übermäßig feuchten Böden im Herbst stellen für die heutige Erntetechnik in Kombination mit durchdachter Einsatzplanung, um z.B. Schäden für den Boden zu vermeiden, kein Problem mehr dar. Breite Reifen und spurversetztes Fahren verhindert die Ausprägung tiefer Spurrinnen bei der Überfahrt. Das Zusammenspiel vieler bereits zur Verfügung stehender technischer Möglichkeiten wird mit weiteren Entwicklungen dazu beitragen, dass die Erntetechnik für Zuckerrüben noch bodenschonender gestaltet wird.
2.2.7. Die vertragliche Bindung
Seit mehr als 30 Jahren sind durch die EU-Zuckermarktordnung Rübenbauer und Zuckerindustrie zu einer vertraglichen Bindung verpflichtet. Diese ermöglicht eine straffe Organisationsform und gewährleistet durch Preis- und Absatzgarantien wichtige Planungsgrundlagen und –sicherheiten für die Rübenbauern. Außerdem ermöglicht die enge Kooperation routinemäßige, flächendeckende Qualitätsanalysen und die daraus resultierende Haltung eines gemeinsamen Standarts. Ferner wird zur Zufriedenheit aller Beteiligten durch gemeinsame Entscheidungen der Rübenbauerverbände und der Zuckerindustrie z.B. im Bereich der Sortenauswahl ein breites Einvernehmen gewährleistet.
2.2.8. Forschungs- und Beratungsstrukturen
Bundesweit organisierte Forschungs- und Beratungsstrukturen im Bereich Zuckerrübe haben dazu geführt, dass der wissenschaftliche und technologische Fortschritt möglichst schnell in die Praxis umgesetzt wird und dass sich so der Anbau von Zuckerrüben heute nachhaltiger und umweltverträglicher gestalten lässt, ohne dass den Landwirten Einkommensverzichte abverlangt werden müssen. Die Beratung und Forschung erfolgt in Deutschland durch staatliche Institutionen (z.B. Bundessortenamt), private Beratungsunternehmen und mit langer Tradition durch Rübenanbauer und Zuckerindustrie selbst. Erfolgreiche Beispiele sind die Reduzierung des Fungizideinsatzes (s.o.) oder die deutliche Verminderung der Stickstoffdüngung (s.o.).
3.1 Nachhaltigkeitsaspekte bei der Zuckerraffinierung
Die Betrachtung des Energieaufwandes im Zuckerrübenanbau lässt sich um den Energieeinsatz im Verarbeitungsprozess erweitern, um damit die Betrachtung des Endproduktes Weißzucker (Saccharose) zu vervollständigen. Für die Verarbeitung der Zuckerrüben werden in der Zuckerfabrik je kg Rübe etwa 1,1 MJ an Primärenergie eingesetzt (s. Grafik 2). Das Endprodukt Weißzucker weist eine physiologischen Brennwert von 16,5 MJ/kg auf. Daraus resultiert insgesamt eine positive Energiebilanz der Zuckerproduktion. Ergänzen ließe sich die Energiebilanz der Zuckerproduktion durch die Energieinhalte der Nebenprodukte. Würden die Nebenprodukte aus der Zuckerherstellung wie zum Beispiel Futtermittel aus Melasse nicht weiter verwendet, müsste stattdessen anderes Futter hergestellt und eingesetzt werden. Da für diese Futtermittelherstellung wiederum Energie aufgebracht werden müsste, trägt die Verwendung der Nebenprodukte aus der Zuckerherstellung zu Energieeinsparungen in anderen Bereichen bei. Durch Weiterverarbeitung und -verwendung von Nebenprodukten wird Primärenergie sozusagen wiederverwertet oder „recycled“.
Das bei der Zuckergewinnung speziell verfolgte Nachhaltigkeitskonzept der deutschen Zuckerindustrie berücksichtigt neben einer weitest möglichen Reduzierung von Umweltbelastungen und einer Optimierung der Produktion und der Nutzung von Primärenergie auch die sozioökonomische Bedeutung der Zuckerfabriken für den ländlichen Raum und die Förderung der sog. Kulturlandschaft. Zudem setzt das Konzept auf gut ausgebildete und verantwortungsbewusste Mitarbeiter und auf einen Verbraucherschutz, der durch ein komplexes Qualitätsmanagement versucht Qualtitäts- und Produktsicherheit bei sämtlichen Zuckererzeugnissen zu gewährleisten.
Im Rahmen der Selbstverpflichtungserklärung der deutschen Wirtschaft hat sich die Zuckerindustrie im Jahr 1996 dazu verpflichtet, ausgehend von 1990 den spezifischen Energiebedarf von rund 36 kWh/100kg Rüben auf 29 kWh/100kg Rüben im Jahr 2005 zu verringern. Die tatsächliche Tendenz beispielsweise im Jahr 1996 von ca. 30,6 kWh oder im Jahr 2004 von etwa 30kWh je 100kg Rüben entspricht diesem Vorhaben.
Das bei der Verarbeitung von Rüben in den Zuckerfabriken angewendete Verfahren zur Herstellung von reinem Zucker beruht auf folgenden grundsätzlichen Verfahrensschritten: Die Zuckerrüben werden nach der Ernte im Herbst in Raffinerien zunächst gewaschen und dann zerkleinert. Bei der anschließenden Extraktion mit Wasser tritt der Zucker aus den geöffneten Pflanzenzellen aus. Nichtzuckerstoffe werden abgetrennt. Die filtrierte Flüssigkeit wird eingedampft, bis sich Zuckerkristalle bilden. Dieser Prozess lässt sich an vielen Stellen verbessern.
3.1.1 Verbesserte Rodetechniken und Reinigungsmaßnahmen auf dem Feld
Zum Beispiel wird an einem Verfahren gearbeitet, wie der Anteil der nach der Ernte und den Rüben haftenden Erde verringert werden kann. Durch verbesserte Rodetechniken und durch spezielle Reinigungsmaßnahmen der Rüben auf dem Feld konnte der Erd- und Rübenkopfanhang in den vergangenen Jahren bereits deutlich reduziert werden. Darüber hinaus wurde durch finanzielle Förderung der Zuckerindustrie durchgesetzt, dass die Landwirte die an den Feldrändern lagernden Rüben mit Planen (sog. Mieten) abdecken. Durch diesen Abdeckungsschutz wird eine verbesserte Abtrocknung der an den Rüben haftenden Erde erreicht. Dies erhöht die Effizienz der Reinigung bei der Rübenverladung erheblich. Bereits im Jahr 2000 gelangen rund 91 % der Rüben vorgereinigt in die Fabrik. Im Mittel der letzten 30 Jahre konnte der Anteil an Nichtrübenmasse (Erde, Rübenköpfe, u.a.) von ehemals rund 1,2 bis 1,5t je Tonne Weißzucker auf rund 0,6 t gesenkt, also mehr als halbiert werden. Je nach Jahr, Witterung und Region sind mit einer Tonne Zucker damit nicht wie früher 1 bis 2 t Erde, sondern nur noch rund 0,25 bis 0,5 t zu transportieren. Also verbleibt letztendlich mehr Erde auf dem Feld, was in der Zeit dieser Kampagne zu einer Verringerung der Transporte von ca. 300 000 Fahrzeugbewegungen geführt hat. Außerdem kann so der Flächenbedarf an die dafür erforderlichen Absetzbecken in den Zuckerfabriken weiter reduziert werden.
3.1.2. Logistik
Eine effiziente Rübenverarbeitung in den Zuckerfabriken setzt die Bewältigung enormer Warenströme durch eine gut geplante Logistik voraus. Die Abfuhr der Rüben vom Acker und ihre Anlieferung an die Fabriken erfolgt heute mit deutlich größeren Fahrzeugen als noch vor 30 Jahren und ist nach einem genauem Zeitplan strukturiert, sodass die Verkehrsbelastung durch Transportfahrzeuge und die Wartezeiten in den Fabriken möglichst minimal gehalten werden. Die Primärenergieversorgung erfolgt bei Heizöl soweit wie möglich per Bahn und bei Gas über entsprechende Rohrleitungen. Zudem ist die Substitution fossiler Brennstoffe im Bereich der Landwirtschaft und bei den Speditionen möglich (s.o.) und wird auch durch die Zuckerunternehmen finanziell gefördert.
3.1.3. Melasse
Das Randerzeugnis Melasse kann mit seinen hohen Gehalten an Saccharose, Glucose, Fruktose sowie anderen organischen und anorganischen Stoffen neben der Nutzung als Viehfutter (s. Grafik 2) auch in der Hefeindustrie oder Alkoholproduktion oder als Rohstoff in diversen biotechnologischen Prozessen verwendet werden. Dementsprechend lässt sich dieses eigentliche Nebenprodukt gut vermarkten.
3.1.4. Wassernutzungseffizienz
Die Zuckerrübe besteht zu ca. 75 % aus Wasser, was während des Verarbeitungsprozesses kondensiert und verdampft. Es wird versucht, eine bestmögliche Wassernutzungseffizienz zu erreichen. Da der Wassereintrag aus Rüben größer ist als die Verdunstung im Prozess, entsteht ein Wasserüberschuss, das sog. Überschusskondensat. Dieses Kondensat wird in verschiedenen Verarbeitungsschritten als Prozesswasser (z.B. als Frischwasser zum Waschen der den angelieferten Rüben anhaftenden Erde) eingesetzt. Die Erde-Wasser-Suspension wird in Absetzanlagen geleitet und das nach dem Absetzen der festen Bestandteile klare („dekantierte“) Wasser zum Waschen und Schwemmen der Rüben anschließend erneut eingesetzt. Die abgesetzte Erde wird zur weiteren Sedimentation in spezielle Teiche gepumpt. Hier entsteht das sog. Erdtransportwasser, das nach der Sedimentation zur Abwasserbehandlung geführt wird. Das dekantierte Erdtransportwasser aus den Rübenerdteichen wird meistens einer anaeroben (unter Sauerstoffauschluss) Behandlung in einer Biogasanlage zugeführt. In diesem Behandlungsschritt werden CSB-Abbauraten von über 90 % erreicht (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf). Das erzeugte Biogas kann mit einen Methangehalt von ca. 75 % als Energieträger weiter genutzt werden. Dies geschieht zumeist bei der Trocknung der Pressschnitzel. Insgesamt stellt Biogas jedoch nur einen kleinen Beitrag zum Energiebedarf der Fabriken von 1 bis 2 %. Das anaerob vorgereinigte Wasser wird zusammen mit dem Überschuss aus dem Fallwasser- und Kondensationskreislauf einer aeroben (unter Sauerstoffzufuhr) biologischen Behandlung zugeführt. In der Regel ist dies die Nitri- und Dentrifikation zur Stickstoffsäuberung. Anschließend erfolgt eine Einleitung des vollständig gereinigten Abwassers in den Vorfluter. Die Kreislaufführung des Schwemm- und Waschwassers reduziert die den Frischwasserverbauch auf ein Minimum und auch die in den Sedimentationsteichen verbleibende Erde wird nach 2 bis 4 jähriger Lagerung in Rekultivierungsprogrammen zur Melioration (Verbesserung der Böden) als natürlicher Dünger wieder zurück aufs Feld geführt oder kann als Baustoff für Dämme, Deiche oder mineralische Dichtungsschichten vermarktet werden.
3.1.5. Kraft-Wärme-Kopplung
Sämtliche Zuckerraffinerien in Deutschland besitzen eine sog. Kraft-Wärme-Kopplung, durch die Strom (z.B. durch Abwärme) in der Regel überschüssig produziert wird. Der Strom kann dann ins öffentliche Netz eingespeist werden. In einigen Fabriken kommen auch Gasturbinen zum Einsatz. Auch bei der mehrstufigen Verdampfung des Dünnsaftes zu Dicksaft ist es üblich, dass die sog. Brüden (der Dampf, der beim Eindampfen der Lösung entsteht) zur Anwärmung der nächsten Stufe verwendet werden.
4 Der Nachhaltigkeitsfaktor Bioethanol
Im Zusammenhang mit dem Kyoto-Abkommen (s.o.) wird heute häufig über die Herstellung und den Einsatz biogener Treibstoffe (also Treibstoffe biologischen oder organischen Ursprungs) und die Reduzierung von CO²-Emissionen pro gefahrenem Kilometer debattiert.
Hier kommt der Rohstoff Zuckerrübe ins Spiel; denn aus dem gewonnenen Zucker ist die Produktion von neuerdings steuerbefreitem Bioethanol möglich. Jener kann beispielsweise gemäß der Euronorm EN DIN 228 herkömmlichem Treibstoff direkt ohne Umbau des Motors bis ungefähr zu einem 5 Vol.-% Anteil beigemischt werden (wie es z.B. in Brasilien mit Bioethanol aus Zuckerrohr-Zucker schon seit Jahren der Fall ist). Er kann auch indirekt als Rohstoff für die Herstellung von Etyhltertiärbutylether (ETBE) genutzt werden, welcher sogar zu einem 15 Vol.-% Anteil normalem Benzin beigemischt werden kann. Die Beimischungen veranlassen neben den unendlichen Produktionsmöglichkeiten und langfristig sinkenden Preisen eine Treibgasemissionsreduzierung, da die energetische Nutzung von Bioethanol oder Ethern, wie ETBE, C0²-neutral passiert. In einigen EU-Ländern (z.B. Polen, Tschechien) wird sogar eine Zwangsbeimischung von Bioethanol geprüft. In Schweden wird auch an der Herstellung von dem Treibstoff E 85 gearbeitet, welcher zu 85% aus Bioethanol und zu 15% aus herkömmlichen Benzin besteht. Dieser ist bisweilen aber erst nach einem kompliziertem Einbau eines Kraftstoffsensors in den Motor nutzbar.
5. Diskussion
Zuckerrüben stellen heute nicht mehr nur einen Rohstoff zur bloßen Lebensmittelzuckergewinnung dar, sondern ermöglichen durch neueste Technologien und Forschungsergebnisse eine Verwendung von Zucker in einem viel aktuellerem Bereich; nämlich der Treibstoffherstellung. Diesbezüglich könnte der Zuckerrübenanbau eine neue, fortschrittlichere und beispielhafte Bedeutung in der Landwirtschaft und in der gesamten Gesellschaft erlangen.
Bei der Entwicklung und der Forschung hinsichtlich der Nutzung verschiedener, in der gemäßigten Zone angebauten Kulturpflanzen als biogene Treibstoffe spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben verschiedenen Umweltfaktoren, wie der Endlichkeit fossiler Rohstoffe, die zur Treibstoffherstellung genutzt werden oder die Treibhausgasemissionen, die bei der energetischen Nutzung jener entstehen, als auch ethischen Faktoren, wie dem gemeinschaftlichen Interesse am Erhalt der Umwelt für spätere Generationen, haben auch ökonomisch-politische Faktoren, wie das Streben der Industrienationen nach einer Import-Unabhängigkeit von Rohstofflieferanten aus Krisenregionen eine wichtige Bedeutung.
Bekanntestes und erfolgreichstes Ergebnis dieser Entwicklung ist der sog. Biodiesel, welcher aus Raps gewonnen wird. Bereits seit einigen Jahren ist Biodiesel an mehreren Tankstellen in vielen Städten Deutschlands zu tanken und auch die Automobilindustrie stellt bereits einige Biodiesel-Fahrzeuge her. Zudem laufen einige Etablierungs- und Werbeprogramme, die versuchen die Nutzung von Biodiesel in der Bundesrepublik weiter zu verbreiten. Durch bestimmte Raffinierungsmethoden kann aber auch Zucker aus Zuckerrüben zu Bioethanol oder ETBE weiterverarbeitet und als kostengünstige, umweltfreundliche und biogene Treibstoffergänzung genutzt werden (s. Der Nachhaltigkeitsfaktor Bioethanol).
Hier stellt sich die Frage nach der Angebrachtheit der Ausweitung der Treibstoffproduktion auf Zuckerrübenzucker, denn wie oben erwähnt hat sich die Biodieseltechnologie in der deutschen Gesellschaft bereits einigermaßen etabliert und verfügt über eine gewisse Infrastruktur.
Meiner Meinung nach ist es in diesem Fall jedoch sinnvoll, mehr als eine Strategie zur Ersetzung fossiler Treibstoff-Rohstoffe zu verfolgen. Wenn die Landwirtschaft sich nämlich nur auf Biodiesel und auf den damit verbundenen Rapsanbau beschränken würde, würde sich daraus zum einen eine gewisse Raps-Abhängigkeit entwickeln, die bei schlechten Ernten ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen und desweiteren eine Anti-Diversifizierung der angebauten Kulturen einher bringen würde. Eine Diversifizierung (Anbau verschiedener [in diesem Fall beider] Kulturen) ist jedoch nötig, um flexibler auf Preisänderungen, auf Klima- und Wetterbedingte Ertragsschwankungen und auf Angebot und Nachfrage reagieren zu können. Darüber hinaus ist der diversifizierte Anbau von Raps und Zuckerrüben nötig, um die Bodengüte der einzelnen Ackerflächen zu erhalten damit auf diese Weise nachhaltig und umweltfreundlich gewirtschaftet wird. Hinzufügend spielt die Bodengüte zudem auch eine ökonomische Rolle, da bei sinkender Bodengüte logischerweise schlechtere Erträge erzielt werden.
Bezüglich der Diversifizierung sollte man auch die unterschiedlichen Wachstumsarten von Raps und Zuckerrüben betrachten. Raps ist nämlich eine Winter- und die Zuckerrübe eine Sommerpflanze. Das heißt, dass Raps im August und Zuckerrüben im Frühjahr gesät werden und dass Raps im Juli und Zuckerrüben im Spätherbst geerntet werden. Hieraus ergeben sich unterschiedliche Anbausysteme. Beide Pflanzen müssen aufgrund der Bodentragfähigkeit zwar in einer diversifizierten Fruchtfolge (z.B. mit Weizen) angebaut werden, nur wird im Zuckerrübenanbau zusätzlich das Verfahren der Mulchsaat (s. Mulchsaaten) zur Bodenpflege praktiziert. Raps benötigt diese Maßnahmen nicht, da dieser den Acker schnell komplett bedeckt.
In Anbetracht der verschiedenen Anbausystem stellt auch die Stickstoff-Düngung einen wichtigen Aspekt dar. Im Vergleich mit Zuckerrüben, aber auch generell benötigt Raps eine extrem intensive Stickstoff-Düngung. Dies hat zur Folge, dass die Nitratauswaschung vom Acker sehr hoch ist und somit eine Gefährdung nicht nur der Bodengüte, sondern auch des Grundwassers entstehen könnte.
Auch der Aspekt der Kulturlandschaftspflege könnte für einige Gruppen in unserer Gesellschaft eine große Bedeutung haben. Denn für viele ist es annehmbares Bild, wenn man hinsichtlich des wachsenden Bedarfs an Biodiesel, also u.a. aus ökonomischen Gründen, den Anbau von Raps so erweitern würde, dass jedes Feld weit und breit gelb ist.
Für die Entwicklung einer zweiten Strategie zur Ersetzung fossiler Treibstoff-Rohstoffe durch Bioethanol spricht auch die internationale Akzeptanz. Denn Biodiesel-Technologie und die dazugehörige Infrastruktur ist nur in Deutschland vorhanden. Ausländische, aber auch immer mehr inländische Investoren interessieren sich eher für die Entwicklung und Etablierung von Bioethanol, was daran liegen könnte, dass jener in einigen Ländern (z.B. Brasilien) bereits äußerst etabliert oder dabei ist sich zu etablieren (z.B. Schweden oder die USA). Brasilien zeigt beispielhaft, dass eine flächendeckende und kostengünstige Einführung möglich und durchaus praktikabel ist. Darüber hinaus zeigen auch viele EU-Staaten Interesse an der neuen Technologie und prüfen die Einführung (s. Der Nachhaltigkeitsfaktor Bioethanol .).
Ich denke, dass all die oben genannten Aspekte und Faktoren für eine Ausweitung der biogenen Treibstoffproduktion auf Bioethanol aus Zuckerrüben sprechen. Ich finde es bemerkenswert, dass es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten zur Produktion biogener Treibstoffe gibt. Denn letztendlich wird die Forschung und Entwicklung in dieser Richtung nur betrieben, um zum einen die fossilen Rohstoffe und zum anderen die Umwelt zu schonen und für spätere Generationen zu erhalten. Es wird also ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Entwicklung gemacht. Außerdem kann man noch nicht die Forschungsergebnisse in naher oder auch in fernerer Zukunft absehen, was heißt, dass es erstens wahrscheinlich noch zu Verbesserungen in den schon vorhandenen Technologien gibt und zweitens, dass sich vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten zur Substitution fossiler Energieträger entwickeln und etablieren werden.
6. Schlusswort
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Zuckerindustrie im Anbau, in der Verarbeitung und in der Nutzung von Zuckerrüben alles daran setzt, die anfallenden Prozesse so umweltschonend, fortschrittlich und verantwortungsbewusst, folglich also so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Verschiedene Forschungsprojekte, wie z.B. das Gemeinschaftsprojekt Bodenbearbeitung, haben in dem letzten Jahrzehnt zu enormen Entwicklungen, wie z.B. der massiven Reduzierung der Stickstoffdüngung oder einer effizienteren Bodenbearbeitungsintensität geführt. In den meisten Punkten sind die Verbesserungskapazitäten jedoch noch längst nicht ausgeschöpft. Der aktuelle Stand der Technologie und Forschung ist wie immer nur temporär und wird bald schon ein neues Level erreichen, was sich dann wiederum positiv auf die Verbesserung der Prozesse rund um Zuckerrübe auswirkt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
Zitate und Grafiken
Quellenverzeichnis
„Zucker aus Rüben – Natürlich nachhaltig“; Wirtschaftliche Vereinigung Zucker, 2001
http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft
„Zuckerindustrie 129“; Nr. 11, 2004
„Ganzheitliche Bilanzierung nachwachsender Energieträger“; Kaltschmitt und Reinhardt, 1997
„Dauerhafte Bodenbearbeitungsverfahren in Zuckerrübenfruchtfolgen - Ertragsbildung, Rentabilität, Energiebilanz und Bodenerosion im Vergleich“; Wegener 2001
„Ertragsbildung von Zuckerrüben in Abhängigkeit von Blattfläche und intraspezifischer Konkurrenz“; Röver, 1995
Die Zuckerrübenzeitung (DZZ) Nr. 6, Dezember 2002
VdZ, 1998
ARGE Rheinland, 2001 (Erhebungsberichte)
Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V. http://www.fnr.de/
Institut für Zuckerrübenforschung, Holtensener Landstrasse 77, 37079 Göttingen
[...]
1 Nach einer verkürzten Definition aus dem Brundtland-Bericht / http://de.wikipedia.org/wiki/nachhaltigkeit
2 Fortschrittsbericht 2004 der Bundesregierung „Perspektiven für Deutschland“
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieses Dokuments über Zuckerrüben?
Das Dokument konzentriert sich auf die Nachhaltigkeitsaspekte des Anbaus, der Nutzung und der Verarbeitung von Zuckerrüben, insbesondere im Hinblick auf Energieeffizienz, Umweltschutz und die sozioökonomische Bedeutung für den ländlichen Raum.
Welche Aspekte des Zuckerrübenanbaus werden hinsichtlich des Energieeinsatzes betrachtet?
Das Dokument untersucht den Energieeinsatz bei der Bodenbearbeitung, dem Einsatz von Stickstoffdünger und den Vergleich des Energieaufwands mit anderen Feldfrüchten wie Winterweizen.
Wie kann die Bodenbearbeitung im Zuckerrübenanbau nachhaltiger gestaltet werden?
Durch die Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität (z.B. flache Bearbeitung bis 10 cm Tiefe) kann der Dieselverbrauch gesenkt werden, wodurch Primärenergie eingespart wird.
Welche Rolle spielt der Stickstoffdünger im Zuckerrübenanbau und wie kann er optimiert werden?
Der mineralische Stickstoffdünger ist ein bedeutender Faktor für den Energieeinsatz. Eine genaue Dosierung und zeitgemäße Anbauverfahren können den Energieeinsatz optimieren und gleichzeitig die Qualität der Rüben verbessern.
Welche weiteren Nachhaltigkeitsaspekte werden beim Zuckerrübenanbau berücksichtigt?
Weitere Aspekte sind die effiziente Nutzung von Wachstumsfaktoren, Fruchtfolge, Mulchsaaten, Züchtung, Pflanzenschutzmaßnahmen (Herbizide, Insektizide, Fungizide) und der Einsatz moderner Erntemaschinen.
Wie haben sich die Pflanzenschutzmaßnahmen im Zuckerrübenanbau verändert?
Früher wurden Pflanzenschutzmittel präventiv und flächendeckend eingesetzt. Heute werden Herbizide zu etwa 90% gezielt während oder nach der Keimung der Unkräuter eingesetzt (Nachauflaufverfahren). Insektizide werden oft durch biologische Methoden oder Pillierungs-Verfahren ersetzt, und Fungizide werden nur bei Bedarf und unter Berücksichtigung von Schadensschwellen eingesetzt.
Was sind Mulchsaaten und welche Vorteile bieten sie im Zuckerrübenanbau?
Mulchsaaten sind Anbauverfahren, bei denen Reststoffe von Vor- oder Zwischenfrüchten als Mulchschicht an der Bodenoberfläche verbleiben. Sie verhindern Erosion, fördern Bodenlebewesen und unterdrücken die Entwicklung von Unkräutern.
Wie trägt die Züchtung zur Nachhaltigkeit im Zuckerrübenanbau bei?
Durch die Züchtung werden neben Ertragssteigerung auch Qualitätssteigerung (Reduzierung von Inhaltsstoffen, die die Zuckergewinnung erschweren) und Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge angestrebt.
Welche Nachhaltigkeitsaspekte werden bei der Zuckerraffinierung berücksichtigt?
Die Zuckerraffinierung berücksichtigt die Reduzierung von Umweltbelastungen, Optimierung der Primärenergienutzung, sozioökonomische Bedeutung für den ländlichen Raum und die Förderung der Kulturlandschaft. Ein wichtiger Faktor ist auch die verbesserte Wassernutzungseffizienz und Kraft-Wärme-Kopplung.
Wie wird die Wassernutzungseffizienz in der Zuckerraffinierung verbessert?
Das bei der Verarbeitung entstehende Kondensat wird als Prozesswasser in verschiedenen Schritten eingesetzt. Das Erdtransportwasser aus den Rübenerdteichen wird einer anaeroben Behandlung in einer Biogasanlage zugeführt.
Was ist Melasse und wie wird sie genutzt?
Melasse ist ein Randerzeugnis mit hohem Gehalt an Saccharose, Glucose, Fruktose sowie anderen Stoffen. Sie wird als Viehfutter, in der Hefeindustrie, Alkoholproduktion oder als Rohstoff in biotechnologischen Prozessen verwendet.
Welche Bedeutung hat Bioethanol im Zusammenhang mit Zuckerrüben?
Aus Zucker kann Bioethanol produziert werden, welches als biogener Treibstoff genutzt werden kann. Es kann herkömmlichem Treibstoff beigemischt oder als Rohstoff für die Herstellung von ETBE verwendet werden, wodurch CO²-Emissionen reduziert werden können.
Welche Rolle spielen Forschungs- und Beratungsstrukturen im Zuckerrübenanbau?
Bundesweit organisierte Forschungs- und Beratungsstrukturen sorgen dafür, dass wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt schnell in die Praxis umgesetzt wird, wodurch der Anbau von Zuckerrüben nachhaltiger und umweltverträglicher gestaltet werden kann.
- Quote paper
- Wolf-Fabian Hungerland (Author), 2005, Nachwachsende Rohstoffe - Nachhaltigkeit bei Anbau und Verarbeitung von Zuckerrüben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109887