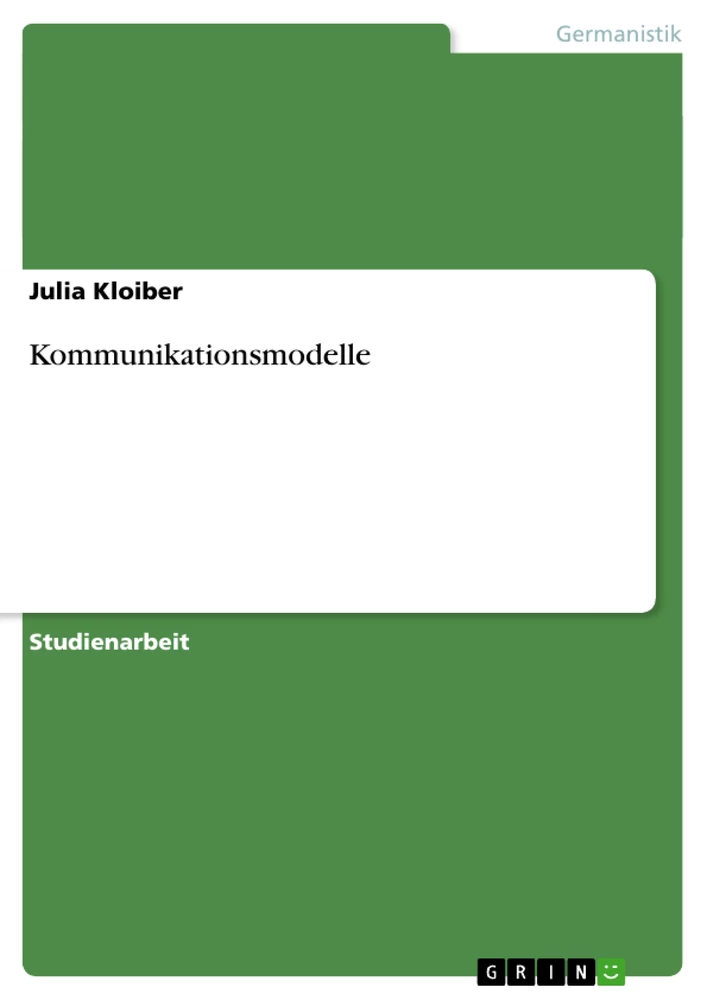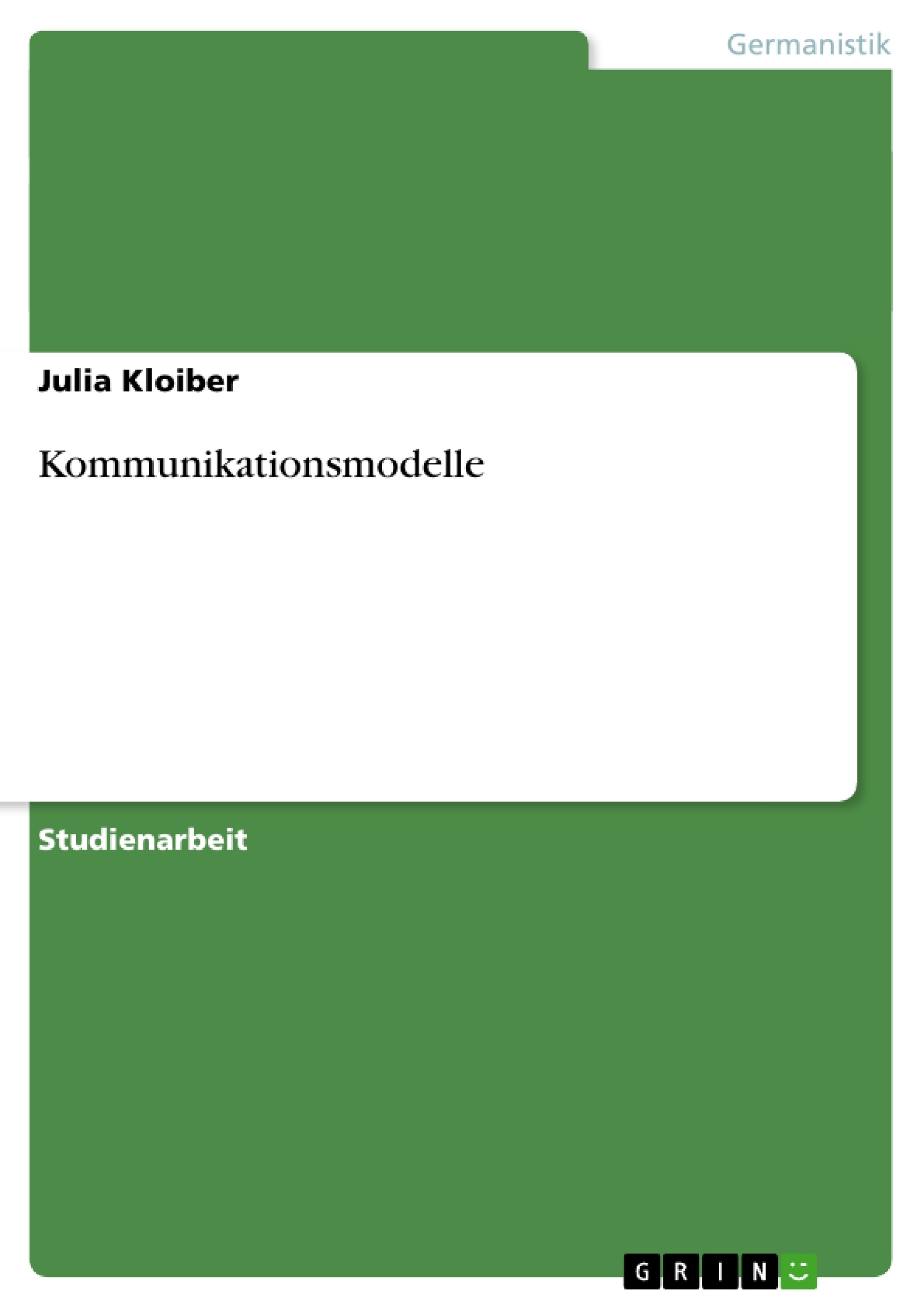1. Einleitung Der zu bearbeitende Text handelt von Kommunikationsmodellen verschiedener Art und der dazu aufkommenden Kritik. 2. Vorstellung der Modelle Das erste zu beschreibende Kommunikationsmodell wurde von einem amerikanischen Fernmeldeingeneur namens Shannon dargestellt. Es ist auf dem Prinzip des Telefonierens aufgebaut. Demnach gibt es einen Sender, einen Empfänger und einen Kanal, durch den die Mitteilung läuft. Dieser Kanal ist auch Störungen ausgesetzt, wie zum Beispiel dem Rauschen. Ein etwas genaueres Modell wurde später von Shannon und Weaver aufgestellt. Sie unterschieden zwischen einer Quelle, dem Sender, der seine Nachricht zu enkodieren hat. Diese enkodierte Nachricht läuft durch den Kanal, der eventuell durch ein Rauschen gestört sein kann, zu dem Empfänger, der das Ziel darstellt und die Aufgabe hat, die Nachricht zu dekodieren. Die Quelle, der Sender, und das Ziel, der Empfänger, sind dazu räumlich und zeitlich getrennt, damit die Nachricht über den Kanal transportiert werden kann. Die Enkodierung und Dekodierung der Nachricht hat einen bestimmten Grund. Die Sprache des Senders und die Sprache des Empfängers wird als Kode bezeichnet. Die beiden Kommunikationspartner müssen die selbe Sprache sprechen, damit sie überhaupt miteinander kommunizieren können.
1. Einleitung
Der zu bearbeitende Text handelt von Kommunikationsmodellen verschiedener Art und der dazu aufkommenden Kritik.
2. Vorstellung der Modelle
Das erste zu beschreibende Kommunikationsmodell wurde von einem amerikanischen Fernmeldeingeneur namens Shannon dargestellt.
Es ist auf dem Prinzip des Telefonierens aufgebaut. Demnach gibt es einen Sender, einen Empfänger und einen Kanal, durch den die Mitteilung läuft. Dieser Kanal ist auch Störungen ausgesetzt, wie zum Beispiel dem Rauschen.
Ein etwas genaueres Modell wurde später von Shannon und Weaver aufgestellt.
Sie unterschieden zwischen einer Quelle, dem Sender, der seine Nachricht zu enkodieren hat. Diese enkodierte Nachricht läuft durch den Kanal, der eventuell durch ein Rauschen gestört sein kann, zu dem Empfänger, der das Ziel darstellt und die Aufgabe hat, die Nachricht zu dekodieren.
Die Quelle, der Sender, und das Ziel, der Empfänger, sind dazu räumlich und zeitlich getrennt, damit die Nachricht über den Kanal transportiert werden kann.
Die Enkodierung und Dekodierung der Nachricht hat einen bestimmten Grund. Die Sprache des Senders und die Sprache des Empfängers wird als Kode bezeichnet. Die beiden Kommunikationspartner müssen die selbe Sprache sprechen, damit sie überhaupt miteinander kommunizieren können.
Doch jeder Mensch besitzt seinen eigenen Sprachstil - Idiolekt[1] - deshalb muss die Nachricht vom Empfänger erst dekodiert werden, also in seinen Idiolekt „übersetzt“ werden, damit er den Sender verstehen kann.
Es gibt dabei einen Bereich, den beide Partner verstehen, und einen, der aufgrund des Idiolekts nur vom Sender oder nur vom Empfänger verstanden wird.
3. Kritik
Die Trennung zwischen Sender und Empfänger ist nicht gegeben, obwohl jeder der beiden Kommunikationspartner beide Rollen übernimmt. Ebenso wird der Ablauf des De- und Enkodierens nicht weiter erläutert. Was hier bei dem Sender und Empfänger vorgeht bleibt unbekannt. Als weiteres wird die Kommunikation nur auf die Übertragung von Informationen reduziert, doch es geschieht mehr zwischen den Aktionspartnern.
Ein Kode ist nicht eindeutig, denn er besteht aus vielfältigen Elementen, Wiederholungen oder Variationen, was aus den Modellen ebenfalls nicht hervorgeht.
Literaturverzeichnis
Bünting, Karl-Dieter: Grundkurs Sprachwissenschaft. Arbeitsmaterialien, Literaturhinweise, Teil 1. Universität Essen, WS 2002/2003
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text über Kommunikationsmodelle?
Der Text behandelt verschiedene Kommunikationsmodelle und die Kritik, die an ihnen geübt wird.
Welches Kommunikationsmodell wird zuerst vorgestellt?
Das erste beschriebene Modell stammt von dem amerikanischen Fernmeldeingenieur Shannon. Es basiert auf dem Prinzip des Telefonierens und beinhaltet einen Sender, einen Empfänger und einen Kanal, durch den die Mitteilung läuft. Der Kanal kann auch Störungen, wie Rauschen, ausgesetzt sein.
Wie wurde Shannons Modell weiterentwickelt?
Shannon und Weaver entwickelten ein genaueres Modell, das zwischen einer Quelle, dem Sender (der die Nachricht enkodiert), dem Kanal (der Störungen ausgesetzt sein kann) und dem Empfänger (der die Nachricht dekodiert) unterscheidet. Die Quelle und das Ziel sind räumlich und zeitlich getrennt.
Was ist ein Kode in diesem Kontext?
Der Kode ist die Sprache des Senders und des Empfängers. Beide Kommunikationspartner müssen die gleiche Sprache sprechen, um miteinander kommunizieren zu können.
Was ist ein Idiolekt?
Jeder Mensch besitzt seinen eigenen Sprachstil, den sogenannten Idiolekt. Der Empfänger muss die Nachricht dekodieren und in seinen Idiolekt "übersetzen", um den Sender zu verstehen.
Welche Kritik wird an den Kommunikationsmodellen geübt?
Kritisiert wird unter anderem die Trennung zwischen Sender und Empfänger (da beide Rollen übernehmen), die fehlende Erklärung des De- und Enkodierens, die Reduktion der Kommunikation auf reine Informationsübertragung und die mangelnde Berücksichtigung der vielfältigen Elemente, Wiederholungen und Variationen eines Kodes.
Woher stammt die Information über den Idiolekt?
Die Information über den Idiolekt stammt aus Bünting, Karl-Dieter: Grundkurs Sprachwissenschaft. Arbeitsmaterialien, Literaturhinweise, Teil 1. Universität Essen, WS 2002/2003, S. 7.
- Quote paper
- Julia Kloiber (Author), 2003, Kommunikationsmodelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109780