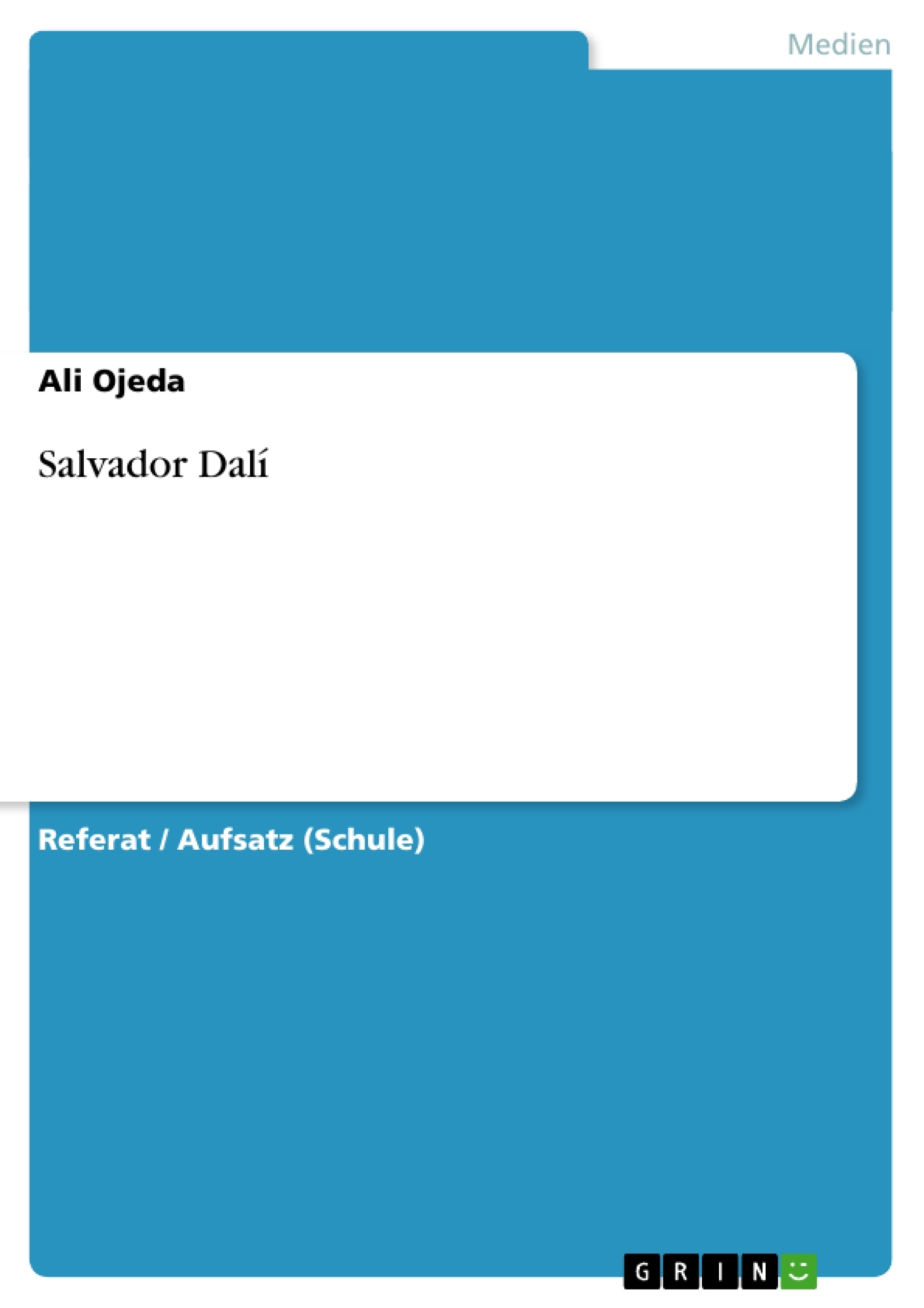Was steckt wirklich hinter dem exzentrischen Genie? Tauchen Sie ein in das faszinierende Leben und die surreale Welt von Salvador Dalí, einem der schillerndsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Diese Biografie enthüllt die komplexen Facetten einer Persönlichkeit, die sich zwischen Narzissmus und Verletzlichkeit, zwischen kalkulierter Provokation und tiefgründiger Sensibilität bewegte. Erfahren Sie von seiner Kindheit in Katalonien, geprägt vom Verlust seines Bruders und dem dominanten Vater, die sein Schaffen nachhaltig beeinflussten. Verfolgen Sie seinen Weg durch die Kunstakademie in Madrid, seine Begegnungen mit Schlüsselfiguren wie Picasso, Buñuel und Gala, seiner Muse und späteren Ehefrau, die sein Leben und Werk revolutionierte. Entdecken Sie die Ursprünge seiner ikonischen Bildsprache, von den zerfließenden Uhren bis zu den surrealen Landschaften, und wie er seine "paranoisch-kritische Methode" nutzte, um die Grenzen zwischen Traum und Realität aufzulösen. Analysiert werden seine künstlerischen Phasen vom Impressionismus über Kubismus und Surrealismus, und wie diese Strömungen seine unverwechselbaren Bildtechniken, Bildgattungen und Bildthemen prägten. Seine kontroverse Haltung zu politischen Themen wie dem Faschismus, seine Besessenheit von Geld und sein extravagantes Auftreten werden ebenso beleuchtet wie seine zahlreichen Ausstellungen, Bildbeispiele und sein Einfluss auf die Kunstwelt. Ergründen Sie das Zusammenspiel von Zeitgeist, Gesellschaft und technischem Fortschritt in Dalís Schaffen und erleben Sie, wie er die Kunstwelt revolutionierte. Abschließend wird ein individueller Bezug zu Dalí hergestellt und eine eigene Meinung über den Künstler gebildet, um seine Bedeutung und sein Vermächtnis in der Kunstgeschichte zu würdigen. Ein unentbehrliches Buch für alle, die sich von Dalís einzigartiger Vision und seinem revolutionären Beitrag zur Kunst des 20. Jahrhunderts fesseln lassen wollen. Tauchen Sie ein in die Psyche eines Genies, dessen Werk bis heute nichts von seiner Sprengkraft und seinem Rätsel verloren hat.
Inhaltsverzeichnis
1. Persönliche Daten
1.1 Geburtsdaten
1.2 Elternhaus – Schichtzugehörigkeit
1.3 Geschwister
1.4 Eheschließung
1.5 Beruf
1.6 Todesdaten
2. Lebensgeschichte
2.1 Kindheit – Jugend
2.2 Schuldbildung
2.3 Ausbildung
2.4 Einflüsse – Freunde
2.5 Lebenseinschnitte
2.6 Krankheiten – Unfälle
2.7 Charakter – Lebensphilosophie
3. Künstlerische Laufbahn
3.1 Bildtechniken
3.2 Bildgattungen
3.3 Bildthemen
3.5 Einflüsse – Charakteristiken
3.6 Ausstellungen – Bildbeispiele
3.7 Künstlerische Phasen
4. Kunstepochen
4.1 Zuordnung und Begründung
5. Umfeld
5.1 Zeitgeist – Gesellschaft
5.2 Stand der Technik
6. Individueller Bezug
6.1 Begründung der Wahl
6.2 Eigene Meinung über den Künstler
1. Persönliche Daten
1.1 Geburtsdaten
Salvador Felipe Jacinto Dalí Doménech wurde am 11. Mai 1904 in der Calle Monturiol in Figueras bei Gerona in Katalonien geboren.
1.2 Elternhaus und Schichtzugehörigkeit
Er ist der Sohn des angesehenen Notars Salvador Dalí y Cusi. Der außerdem eine gewisse lokale Bedeutung hat. Er wächst im Umfeld einer bürgerlichen Gesellschaft auf, die sein späteres Leben beeinflusst.
1.3 Geschwister
Der Name Salvador war ursprünglich dem drei Jahre zuvor verstorbenem Bruder gegeben worden. Bis zu der Geburt Dalís jüngeren Schwester Ana María war er daher das einzige Kind der Familie. Er wurde verwöhnt und durfte praktisch tun, wozu er Lust hatte. In seiner Autobiografie gibt Dalí selbst eine Schilderung jener frühen Jahre: „Mein Bruder starb mit sieben Jahren an einer Gehirnhautentzündung, drei Jahre vor meiner Geburt. Sein Tod stürzte meine Eltern in tiefe Verzweiflung; sie fanden Trost nur dadurch, dass ich zur Welt kam. Mein Bruder und ich ähnelten einander wie ein Ei dem anderen, aber wir dachten verschieden. Wie ich besaß er die unverkennbare Gesichtsmorphologie eines Genies, er zeigte Symptome beängstigender Frühreife, aber sein Blick war verschleiert von der Melancholie, die für unüberwindliche Intelligenz kennzeichnend ist. Ich dagegen war viel weniger intelligent, dafür reflektierte ich alles. Ich sollte der Prototyp Par excellence des phänomenal zurückgebliebenen Polymorph-Perversen, der sich alle Erinnerungen an die erogenen Paradiese des Säuglings fast ganz bewahrt hat: Mit grenzenloser, egoistischer Gier griff ich nach der Lust, und beim geringsten Anlass wurde ich gefährlich.“
1.4 Eheschließung
Im Jahre 1929 lernt Salvador Dalí auf seiner zweiten Reise nach Paris u.a. seine zukünftige Frau, lebenslange Muse und Weggefährtin Helena, genannt Gala, eine russische Immigrantin, kennen. Jene ist zu genannter Zeit noch mit dem Dichter Paul Eluard verheiratet und obwohl sie zehn Jahre älter ist, verliebt sich Dalí in sie. Seine Werbeversuche sind von Erfolg: Gala bleibt bei ihm. Die offizielle Scheidung von ihrem Mann erfolgt 1932. Die kirchliche Trauung mit Dalí erst 1958.
1.5 Beruf
Salvador Dalí war ein Mann der vielen Berufe.
„Als ich drei Jahre alt war, wollte ich Koch werden. Mit sechs wünschte ich, Napoleon zu sein. Seitdem hat mein Ehrgeiz ständig zugenommen.“ Diesem Ehrgeiz verdankt er seinen Ruf als einer der bedeutendsten surrealistischen Maler. Er war allerdings auch noch in anderen kreativen Bereichen tätig. So übte er sich als Schriftsteller, Buchillustrator, Bildhauer, Bühnenbildner und Schauspieler.
1.6 Todesdaten
Nach dem Tod seiner Frau Gala, im Jahr 1982, verschlechterte sich Dalis Gesundheit zusehends. 1984 erlitt er bei einem Feuer in seinem Schlafzimmer im Schloss von Pubol Brandverletzungen. Zwei Jahre später wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Die meiste Zeit seiner letzten sechs Jahre verbrachte Dali in Abgeschiedenheit, zuerst in Pubol und später in seiner Wohnung, in der Nähe seines Theater-Museum, im Torre Galatea. Salvador Dali starb am 23. Januar 1989 im Torre Galatea in Figueras an Herzversagen und Atemsbeschwerden. Auf seinen Wunsch wird er in der Krypta seines Theater-Museums beigesetzt. Als einzigen Erben setzte er den spanischen Staat ein und vermachte diesem sein gesamtes Vermögen und sein Werk.
2. Lebensgeschichte
2.1 Kindheit und Jugend
Dalí wuchs in einem bürgerlichem Umfeld auf, durch dieses und die Erziehung seines Vaters prägte sich bei ihm ein Wunsch nach Sicherheit und ein Ordnungssinn aus, der für sein späteres Leben bestimmend sein sollte. Wie schon in erwähnt (s. Punkt 1.3) genoss er die wahre Narrenfreiheit. Bereits früh machte sich Dalís exzentrische Ader bemerkbar. So soll er seine Exkremente in der gesamten Wohnung verteilt haben, was seine Familie in helle Aufruhr versetzte und ihn in den Genuss brachte, alle Aufmerksamkeit zu erhalten. Ob diese negativer oder positiver Natur war schien ihn dabei nicht zu interessieren. Außerdem neigte er zu Gewalttätigkeiten gegen Tiere, Menschen und auch gegen sich selbst. Seine schulischen Leistungen ließen zu wünschen übrig und seine Zeugnisse wurden von den Eltern mit einiger Bestürzung aufgenommen. Er wollt immer das genaue Gegenteil erreichen und verbrachte Stunden damit sich möglichst antisoziale Taten auszudenken, um seine Mitmenschen zu beeindrucken. Viele dieser Taten waren reine Gewalt. So stieß er ohne Grund einen Klassekameraden von einer fünf Meter hohen Brücken und verbrachte den weiteren Verlauf des Tages kirschenessend in einem Schaukelstuhl. Auch gegenüber seiner Schwester verhielt er sich nicht anderes, so versetzte er der damals Dreijährigen einen heftigen Tritt gegen den Kopf, was ihm eine „delirische Freude“ bereitete. Ebenso großen Gefallen fand Dalí daran, sich die Treppe hinunterzuschmeißen. Das Empfinden von Schmerz spielte hierbei keine Rolle, denn die intensive Freude war überwältigend. Bei diesem Spiel übersah er nie die Wirkung, die er auf seine Mitschüler ausübte. Bei anderer Gelegenheit zertrümmerte er die Violine eines Jungen um zu beweisen und zu demonstrieren, dass die Malerei der Musik überlegen ist. Auf der anderen Seite schien er malerisch talentiert zu sein. Dieses Talent zeigte der noch keine sechs Jahre alte Dalí und seine Eltern wiesen ihm als erstes Atelier einen alten Waschraum zu. Er malte auf die Deckel von Hutschachteln aus dem Geschäft seiner Tante, außerdem reproduzierte er Gemälde der Renaissance-Meister, die er aus Zeitungen herausgerissen hatte. Hier fand er Zuflucht und die ersehnte Einsamkeit. Das Alleinsein wurde schon bald zur Manie. In dieser alten Wäschekammer fühlte er sich wohl, lebte seine Phantasien aus in seinen Geniespielen: „Wenn du ein Genie spielst, wirst du eines.“
2.2 Schulbildung
Seine Erziehung begann in der Grundschule des Ortes, von 1914 bis 1918 besuchte er die von Brüdern des Maristenordens geleitete Akademie. Dort beschäftigte er sich vor allem mit seiner Persönlichkeit, der er durch sein äußeres Erscheinungsbild zu Ausdruck verhalfen versuchte. Seine Eltern, die sein wachsendes Talent erkannten, schickten ihn zu Ramón Pitchot, einem wohlhabenden Kunstkenner und begabtem impressionistischen Maler, bei dem Dalí ein Jahr lebte und von den impressionistischen Werken des Meisters beeinflusst wurde. Von Pitchot ermutigt schickte Dalís Vater seinen Sohn in die Kunstklasse des Señor Nuñez in Figueras. Nuñez scheint von der späteren Brillianz seines exzentrischen, aber eifrigen Schülers etwas zu spüren. Stimuliert von der Aufmerksamkeit die ihm zuteil wurde, kehrte Dalí zu seiner Leidenschaft für die Meister der Renaissance zurück. Er begann sich ebenfalls für das Lesen, insbesondere philosophischer Werke zu interessieren. Allmählich erregten seine Gemälde Aufmerksamkeit und es folgten die ersten Einladungen zu Ausstellungen in der näheren Umgebung. Seine schulische Ausbildung bei den Maristen setzte er fort, wenn er auch regelmäßig versuchte dem Unterricht zu entkommen.
2.1 Ausbildung
Obwohl seine Familie Zweifel in Hinsicht auf Dalís Leidenschaft hatte und nicht glaubte, dass er seinen Lebensunterhalt mit der Kunst verdienen könnte, schlossen sie und Dalí einen Kompromiss. Dalí würde die Kunstakademie in Madrid besuchen, sich als Lehrer qualifizieren und in seiner Freizeit könnte er so viel malen wie es ihm beliebt. Im Jahre 1921 begann er sein Studium, dem eine Aufnahmeprüfung vorausgegangen war: es sollte eine Zeichnung nach einem klassischen Thema mit festgelegten Größenverhältnissen angefertigt werden. Dalí ignorierte diese Anweisungen, folglich war seine erste Zeichnung zu klein, die Zweite groß und die Dritte kleiner als die Erste. Dennoch waren seine Studien so perfekt, dass er angenommen wurde. Er machte die Bekanntschaft von Luis Buñuel, Federico García Lorca und Pedro Garfia und wurde von Juan Gris sowie dem Kubismus beeinflusst. 1922 wurde er aufgrund einer Rebellion für ein Jahr von der Akademie verwiesen. Zurück in Figueras wurde er von der Polizei festgenommen. Eine revolutionäre Erregung lag damals über dem Land und Dalí hatte sich mit seinen wilden Reden über Anarchie und Monarchie verdächtig gemacht. Da man aber keine Anklage Punkte gegen ihn finden konnte, wurde schließlich freigelassen. Im Jahre 1925 kehrt er an die Madrider Akademie zurück und beschäftigt sich von nun an mit den Schriften Sigmund Freuds.
2.4 Einflüsse – Freunde
Dalí ließ sich sehr beeinflussen. Während seiner Zeit bei Ramon Pitchot (1918 – 1919), steht er unter dem Einfluß dessen impressionistischem Stil. 1920 wir er durch den italienischen Futurismus beeinflusst, nachdem er Kataloge und Manifeste gesehen hatte, die seine Eltern aus Paris mitgebracht hatten. Als Schüler der Madrider Akademie lernt er Luis Buñuel, Federico García Lorca und Pedro Garfia kennen und wird von ihnen als auch von Juan Gris sowie dem Kubismus beeinflusst. Nach seinem Besuch bei Picasso (1925) macht sich 1926 dessen Einfluss auf Dalís Kunst bemerkbar. Nach dem Anschluss an die surrealistische Bewegung um André Breton und der Bekanntschaft mit Joan Miró zeigen seine Bilder deren Einfluss. 1929 – 1930 ließ er sich vom Jugendstil und der Architektur Antoni Gaudís beeinflussen.
2.5 Lebenseinschnitte
1904 Sein vorgeburtliches Leben im Mutterleib identifiziert Dalí als Paradies, das die Farbe einer weichen, warmen und unbeweglichen Hölle hat. Eine seiner vorgeburtlichen
Visionen sei über zwei in einer Pfanne brutzelnden Eier gewesen – ohne Pfanne, Dalís „Grundhalluzination“ , die er später willkürlich wiederholt, so z.B. sichtbar in seinem Werk „Spiegeleier auf dem Teller ohne Teller“.
1922 Nach seinem einjährigem Ausschluss von der Akademie, weist Dalí den Kubismus zurück und bekennt sich zu den Lehrender „Metaphysischen Schule“ der Malerei, die unter der Führung Giorgio de Chiricos und Carlo Carrás, die Welt innerer Wahrnehmung und Erfahrung erkundete.
1925 Erste Einzelausstellung in der Galerie Dalmau, Barcelona. Dalís erste Reise nach Paris, wo er Pablo Picasso und den Zirkel der Surrealisten um Joan Miró und André Breton kennenlernt.
1927 – 1929 Beiträge zur Zeitschrift L’Amic de les Arts.
1928 Ana Maria und Sitzendes junges Mädchen von hinten sind die ersten Bilder Dalís, die in Amerika, im Carnegie Institute von Pittsburgh, gezeigt werden.
1929 Beitrag zur Gaseta de les Arts. Zweite Reise nach Paris. Dort schließt Dalí sich der Surrealistengruppe an und lernt u.a. Paul Eluard kennen. Er erhält Besuch von Breton, Margritte, Eluard und dessen Frau Helena, genannt Gala.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dalí verliebt sich in die russische Immigrantin und Gala bleibt bei ihm. Es entstehen die Bilder Erleuchtete Lüste, Das finstere Spiel und andere genuin
surrealistische Werke, sowie eine Reihe von mischtechnischen Collagen. Es kommt zur Uraufführung des Films Un Chien andalou, nach dem Drehbuch von Dalí und Buñuel. 1930 Uraufführung des Films L’Age d’Or, eine erneute Zusammenarbeit Dalís und Buñuels.
1930 – 1933 Veröffentlichung von L’Amour et la Mémoire. Beiträge zur Zeitschrift Le Surréalisme au service de la révolution.
1931 Gemälde und Zeichnungen für die Ausstellung „Der neue Surrealismus“ in Wadsworth Atheneum, Hartford, Connecticut. 1932 Niederschrift von Babaouo. Ausstellung in der Julien Levy Gallery, New York.
1933 Erste Einzelausstellung in der Julien Levy Gallery. 1934 Die Surrealistengruppe ist beunruhigt durch Dalís politische Äußerungen missbilligt seine Bewunderung für Hitler, sowie seine monarchistischen Tendenzen. Es kommt zum offiziellen Ausschluss Dalís.
Dalí unternimmt seine erste Reise nach Amerika und fertig Illustrationen von New York für die American Weekly an.
1935 Veröffentlichung des Buches Die Eroberung des Irrationalen, in dem er seine paranoische-kritische Aktivität definiert.
1936 Dalí nimmt an der Internationalen Surrealistischen Ausstellung in London teil.
Er schließt Freundschaft mit dem englischen Sammler Edward James, der die umfassendste Dalí-Sammlung aufbaute. 1937 Erste von insgesamt drei Reisen nach Italien. Dalí ist beeindruckt von Palladio, der Renaissance und der Barockmalerei.
1938 Dalí bekommt nach Vermittlung durch Stefan Zweig und Edward James die Gelegenheit, Sigmund Freud in London zu besuchen. Diesen porträtiert er auf Löschpapier.
1940 Dalí verlässt Frankreich und reist über Spanien nach Kalifornien.
1941 – 1942 Große Retrospektive im Museum of Modern Art, die in acht Städten gezeigt wird. Dalí erhält die allgemeine Anerkennung in den USA. Er beginnt mit der Niederschrift seiner Autobiografie Das geheime Leben des Salvador Dalí, sowie die Porträtmalerei.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1943 Illustrationen für die Bücher des Schriftstellers Maurice Sandoz. Erstellt die Novelle Verborgene Gesichter.
1948 Er kehrt nach Port Lligat in Spanien zurück und wendet sich zum Klassizismus. 1949 Die Madonna von Port Lligat, Dalís erstes religiöses Bild wird vom Papst gebilligt. 1958 Kirchliche Heirat mit seiner Lebensgefährtin und Muse Gala. 1964 Er wird für seine Verdienste in der Kunst mit einem der höchsten Orden Spaniens, dem Großkreuz der Königin Isabella von Spanien ausgezeichnet.
1964 – 1965 Große Ausstellung in Tokio. Veröffentlichung des Buchs Tagebuch eines Genies.
1973 Eröffnung des Dalí-Museums in seiner Geburtsstadt Figueras. Das Buch So wird man Dalí wird veröffentlicht.
1978 Uraufführung des Films Babaouo, der auf dem gleichnamigen Buch beruht.
1981 Dalí erkrankt an Parkinson.
1982 Ernennung zum Marquis von Pubol. Tod seiner Frau Gala.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dalí wohnt allein und zurückgezogen in seinem Schloss Pubol. Im Mai entsteht sein letztes Gemälde Der Schwalbenschwanz. Sein Gesundheitszustand verbietet ihm größere Anstrengungen.
1986 Feuer in Dalís Schlafzimmer, bei dem er sich Verbrennungen zuzieht.
1989 Dalí stirbt am 23. Januar. 2.6 Krankheiten – Unfälle
1981 wurde bei Dalí die Krankheit Parkinson festgestellt. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zu sehend und erlaubt ihm keine größeren Anstrengungen mehr. Im Jahre 1984 erlitt er bei einem Feuer in seinem Schlafzimmer schwere Verbrennungen.
2.7 Charakter – Lebensphilosophie
„Der einzige Unterschied zwischen einem Verrücktem und mir ist der, dass ich nicht verrückt bin.“ Man kann Dalí durchaus für verrückt halten jedoch wurde diese Tatsache nie medizinisch überprüft. Einige denken, dass er oft kurz davor stand verrückt zu werden, allerdings schützte er sich durch Verhalten und Bilder, in dem er alles was ihn belastete aus seinem Inneren entfernte und so den inneren Frieden fand. Dalí behauptet sich an seine Geburt und Schwangerschaft lebhaft zu erinnern. Schon als Kind legt er außergewöhnliches Verhaltensweise zu Tage, die sich u.a. in rechthaberisch, Wutanfälle und extravaganter Kleidung äußern.
Er behauptete mit 3 Jahren erste Halluzinationen gehabt zu haben. Mit 10 Jahren zeigt sich seine exhibitionistische Veranlagung, in Form von Nacktheit.
Es ist ein Ausdruck für Exzentrik und Bedürfnis im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Er verblüffte immer wieder durch spektakuläre Auftritte und Aussagen seine Mitmenschen, z.B. in der Rede bei einer Ausstellung zu der er in Taucheranzug, Helm und Billardqueue in der Hand kam.
Oft erzählte er von einem kleinem Fläschchen, dass im Safe aufbewahrt wurde und in angeblich in die Lage versetzte Meisterwerke zu malen.
Dali arbeitete hart an seinem Image eines exzentrischen und paranoiden Genies. Vermutlich war das nicht mehr als sein Weg sich zu vermarkten nach dem Motto: "Es zählt nicht was man macht, Hauptsache man steht in den Schlagzeilen."
Im Jahr 1949 veröffentlichte seine Schwester Ana María ein Buch über ihren Bruder, Dali as Seen by His Sister, in dem sie seine Jugend als sehr normal und glücklich beschrieb. Dali war außer sich vor Wut - und typisch für Dali - schuf ein Gemälde, das man nur als bösartige Rache an seiner Schwester bezeichnen kann - voll bespickt mit sexuellen Obszönitäten und Gemeinheiten.
In einem Interview mit einem Nachrichtenmagazin aus dem Jahr 2000, beschreibt Robert Descharnes, Dalis langjähriger Sekretär, den Künstler als ziemlich normalen Menschen.
Gala heilte, sowie Dalí behauptete, seine Verrücktheit und er wurde wieder Herr über sich selbst.
3. Künstlerische Laufbahn
3.1 Bildtechniken
Dali schuf seine Grafiken mithilfe der verschiedensten Techniken: Radierungen, Stahlstiche, Holzschnitte, Lithographien und andere gemischte Techniken. Die Mehrzahl sind Radierungen. Seine grafischen Arbeiten wurden entweder als Einzelblätter, als Serien, als Mappen oder in Form von limitierten Buchauflagen veröffentlicht.
Jedoch unterstand seine Bildtechnik ebenfalls dem Einfluss, dem er selbst unterlag. So kam es z.B. in der Zeit von 1918 bis 1919 zu einem sehr verschwenderischen Farbauftrag, durch den nicht zu verkennenden Einfluss von Ramón Pitchot.
Ein sehr wichtiges Werkzeug Dalís ist die "paranoisch-kritische" Methode. Er selbst umschreibt sie als irrationales Wissen, basierend auf ein Delirium der Interpretation. Sie stellt somit einen, für den Surrealisten neuen und einzigartigen Weg der Weltanschauung dar.
Dali erklärt die paranoid-kritische Methode erstmals in einem seiner wichtigsten Essays, "Die Eroberung des Irrationalen" (1935):
"Mein ganzer Ehrgeiz auf dem Gebiet der Malerei besteht darin, die Vorstellungsbilder der konkreten Irrationalität mit der herrschsüchtigsten Wut der Genauigkeit sinnfällig zu machen [...] Vorstellungsbilder, die vorläufig weder durch Systeme der logischen Anschauung noch durch rationale Mechanismen erklärbar oder ableitbar sind."
Er meint damit, seine Bestrebungen, vom Verstand nicht fassbare Vorstellungsbilder mit einer hohen Präzision zu realisieren, wobei das Realisationsmedium keine Rolle spielt. Dali führt, wie folgt, seine Definition fort:
"Paranoisch-kritische Aktivität bedeutet: spontane Methode irrationaler Erkenntnis, die auf der kritisch-interpretierenden Assoziation wahnhafter Phänomene beruht.",
Dies soll bedeuten, dass imaginäre Momentaufnahmen auf psychologisch relevante Objekte projiziert werden, um diese Momentaufnahmen somit deutend erklären zu können. Diese Phänomene beinhalten bereits die komplette Struktur und Systematik und "objektivieren sich lediglich a priori durch das Einschalten der Kritik".
Somit war für Dali die Möglichkeit gegeben, seine zahllosen Phantasien und Halluzinationen illustrativ zu visualisieren.
Mit fantastischer Leichtigkeit verbindet er die realistische Dingwelt mit morbider und pathologischer Verfremdung. Er setzt die Gegenstände und Gestalten in neue surrealistische Zusammenhänge, indem er ihre Beziehung zueinander verändert. Oft bezieht er Bildthemen älterer Meister in seine Werke mit ein oder schafft so genannte „Doppelbilder“, in denen sich ein Mensch aus Gegenständen zusammensetzt.
3.2 Bildgattungen
Dalí entwarf u.a. Gemälde, Collagen, Porträts, religiöse Bilder, Skulpturen und Buchillustrationen, sowie Bühnenkulissen, Schmuck, Möbel, Ballettausstattung, Bücher, Filme, Gedichte u.s.w.
3.3 Bildthemen
Bei seiner Ausbildung bei Ramón Pitchot beschäftigte er sich vor allem mit seiner Persönlichkeit, die er durch sein äußeres Erscheinungsbild, wie z. B. lange Haare, Backenbart, weites Hemd und Lavallière-Krawatte, Er malte oft und gerne Hitler, obwohl er mit Politik nichts zu schaffen hatte. „Ich war fasziniert von Hitlers weichem und fleischigem Rücken, der immer so prall in seine Uniform geschürt war.“ Jedoch betone Dalí immer: „Ich bin kein Nazi.“
Seine häufigste Thematik ist die Welt des Raums, des Rausches, des Fiebers und der Religion; oft findet man in seinen Gemälden seine Frau wieder. Dalís politisch teils reaktionäre Einstellung führt vielfach zu Kontroversen bei der Bewertung seiner Person und seiner Werke.
Außerdem verarbeitete seine Paranoia, die sich in Symptomen wie Verfolgungswahn oder fixen Ideen äußerte, oder Träume in seinen Bildern. Er brachte sie aktiv, systematisch und assoziativ auf seinen Bildern zum Ausdruck, diese zeigen eine bedrohliche, geisterhafte, wie von Wahnvorstellungen verunstaltete Welt
Sie bilden den Zusammenfluss von Realität und Traum, Halluzination und Sexualität, Persönlichem und Mythologischem und zeigen, dass alles vertauschbar ist.
3.5 Einflüsse – Charakteristiken
Einflusshabende Personen oder Stile auf Dalí und seine Kunst sind in Punkt 2.4 schon genannt, zur Wiederholung u.a. Ramón Pitchot, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfia, Juan Gris, Pablo Picasso, André Breton, Joan Miró, Antoni Gaudís, sowie der Impressionismus, der italienische Futurismus, der Kubismus und der Jugendstil. Charakteristisch für Dalís Werke sind einige, immer wieder kommende Symbole. - Löwenköpfe mit fletschenden Zähnen: Sie sind ein Hinweis auf Dalis Vater und dessen Persönlichkeit, sowie auf vitale und ungebrochene Potenz. - Heuschrecken: Dalí assoziiert Heuschrecken mit dem Tod. Die Heuschrecke verzehrt das Männchen nach dem Geschlechtsakt. Somit sieht er in der Heuschrecke auch eine Menge sexuelle Energie, die sich im Nu in Erlöschung umkehren kann.
- Weiche Uhren: Sie sind eine der bekanntesten Kreationen von Dali, die er erstmals in dem Bild Die Beständigkeit der Erinnerung verwendete. Er selbst hat in seiner Autobiographie Das geheime Leben des Salvador Dalí beschrieben, wie er zu den Uhren kam:
„Wir hatten zum Abschluss unseres Abendessens einen sehr starken Camembert gegessen, und nachdem alle gegangen waren, blieb ich noch lange am Tisch sitzen und dachte über die philosophischen Probleme des „Superweichen“ nach, die der Käse mir vor Augen führte. Ich stand auf, ging in mein Atelier und machte Licht, um noch einen letzten Blick auf das Bild zu werfen, das ich gerade in Arbeit hatte, so wie es meine Gewohnheit ist. Dies Bild stellte eine Landschaft bei Port-Lligat dar; die Felsen lagen in einem transparenten, melancholischen Dämmerlicht, und im Vordergrund stand ein Ölbaum mit abgeschnittenen Zweigen und ohne Blätter. Ich wusste, dass die Atmosphäre, die zu schaffen mir in dieser Landschaft gelungen war, als Hintergrund für eine Idee, für ein überraschendes Bild dienen sollte, aber ich wusste noch nicht im mindesten, was es sein würde. Ich wollte schon das Licht ausknipsen, da sah ich plötzlich die Lösung. Ich sah zwei weiche Uhren, von denen die eine kläglich über dem Ast des Ölbaums hing. Obwohl meine Kopfschmerzen so stark geworden waren, dass sie mich sehr quälten, bereitete ich gierig meine Palette vor und machte mich an die Arbeit. Als Gala zwei Stunden später aus dem Kino zurückkehrte, war das Bild - es sollte eines meiner berühmtesten werden - vollendet. Ich ließ sie sich mit geschlossenen Augen davor hinsetzen und zählte: ´Eins, zwei, drei, mach die Augen auf!´ Ich blickte gespannt auf Galas Gesicht und sah darauf die unverkennbare Mischung aus Staunen und Hingerissenheit. Dies überzeugte mich von der Wirksamkeit meines neuen Bildes, denn Gala irrt nie, wenn es darum geht, die Echtheit eines Rätsel einzuschätzen[...]"
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Telefone: Sie haben für Dali zwei Bedeutungen. Zum Einen versucht er, sie zum Ausdruck seiner Unmut gegenüber der Technik zu verwenden, zum Anderen erwecken Telefone in Dali Widerwille gegenüber der Politik, da auch Telefonkonferenzen 1938 zur Linderung der weltpolitischen Krisen nichts bewirkt haben.
- Pferdekarren: Sie sind für Salvador mit Kindheitserinnerungen und erotischen Träumereien verbunden, da er früher des öfteren von einem Freund der Familie in einem Pferdekarren spazieren gefahren wurde.
- Schubladen: Dali sieht in ihnen ein Hinweis auf das Unterbewusste, in dem man nicht, oder nur kaum hineinsehen kann. Sie liegen außerhalb unseres Kontrollbereiches.
3.6 Ausstellungen – Bildbeispiele
1946 Die Versuchung des heiligen Antonius 89,7 x 119,5 cm, Musees Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brüssel Dalí malte dieses Bild für einen Wettbewerb, den Albert Lewin ausgeschrieben hatte, ein amerikanischer Filmproduzent, der für einen Film nach Maupassant Novelle "Bel Ami" ein Bild von der Versuchung des heiligen Antonius benötigte. Elf Künstler beteiligten sich an diesem Wettbewerb, den Max Ernst gewann. Dessen Werk stand in der spätmittelalterlichen Tradition der Behandlung dieses Themas und stellte schreckliche Dämonen dar, während Dalì eine neuartige symbolische Welt schuf. Der heilige Antonius hält das Kreuz hoch, um die bösen Geister abzuwehren, die hier als Pferd (Symbol aggressiver Sinnlichkeit) und Elefanten mit verschiedenen symbolischen Gegenständen dargestellt sind. Auf dem Rücken des Elefanten entsteigt zum Beispiel eine nackte Frau, die Verkörperung der Wollust, einem Kelch.
1951 Der Christus des heiligen Johannes vom Kreuz 205 x 116 cm, Glasgow Art Gallery and Museum, Glasgow Als dieses Gemälde 1952 für den irrsinnigen Preis von 8200 Pfund Sterling von der Glasgow Art Gallery erworben wurde, löste es wegen seiner angeblichen Sensationshascherei einen Sturm der Entrüstung aus. Seither gewann das Werk ungemein an Popularität. Der ungewöhnliche Blickwinkel aus dem Christus dargestellt ist war einer Zeichnung (heute im Kloster der Inkarnation in Avila, Spanien) entlehnt, die dem heiligen Johannes vom Kreuz, einem spanischen Mystiker des 16. Jahrhunderts, zugeschrieben wird. Dalí ist der einzige Künstler, für den es bereits zu Lebzeiten zwei Museen gab, die ausschließlich seinen Werken gewidmet waren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das erste Museum, das Dalí Museum in St. Petersburg in Florida wurde im Jahr 1971 von dem Dalí-Sammler A. Reynolds Morse und seiner Frau Eleanor gegründet. Die Sammlung wurde zuerst in einem Gebäude in der Nähe ihrer Residenz in Cleveland, Ohio ausgestellt. Im Jahr 1982 zog das Museum nach St. Petersburg in Florida um. Es beherbergt 95 Ölgemälde, einschließlich sechs der insgesamt 18 großformatigen Historiengemälde Dalís.
Das zweite Museum, das Teatre-Museu Dalí in seiner Heimatstadt Figueres in Spanien, war das frühere Theater der kleinen Gemeinde. 1974 wurde es zu einem Museum umgebaut. Dalí selbst arbeitete daran mit, aus den verfallenen Ruinen des Stadttheaters wieder einen Anziehungspunkt für Menschen zu machen. Der Grund, warum er gerade dieses Gebäude wählte, ist simpel: Im Jahr 1918, als Dalí 14 Jahre alt war, fand dort seine erste Ausstellung statt. Nachdem das um 1850 von Roca i Bros gebaute Theater durch ein Feuer gegen Ende des spanischen Bürgerkriegs 1939 zerstört wurde, schlug Figueres' Bürgermeister Ramon Guardiola 1961 Dalí vor, dort ein Museum zu errichten. Am 28. September 1974 wurde es eröffnet und zieht seitdem Millionen von Besuchern an.
In Spanien sind seit Mitte der 1990er Jahre zwei weitere Museen der Öffentlichkeit zugänglich, an denen Dalí maßgeblich beteiligt war. Es handelt sich dabei um das Schloss von Púbol, welches seit 1970 der Wohnsitz seiner Frau und nach ihrem Tod 1982 für zwei Jahre auch Dalís Wohnort war, und das Wohnhaus in Port Lligat, Gemeinde Cadaques, einem kleinen Fischerdorf nahe der spanisch-französischen Grenze. Nachdem er die Fischerhütte 1930 kaufte, richtete er es immer weiter her und nach dem USA-Aufenthalt zogen Salvador und Gala 1948 dort ein.
Weitere Ausstellungen wandern durch die ganze Welt.
3.7 Künstlerische Phasen
Nach 1948 entwickelte Dali ein Interesse an Wissenschaft, Religion und Geschichte. Er integrierte Dinge in seine Kunstwerke, die er von populären Wissenschaftsmagazinen aufgeschnappt hatte. Eine andere Quelle der Inspiration wurden die großen klassischen Meister wie Raphael, Velasquez oder der französische Maler Ingres. Dali kommentierte seinen Stilwechsel mit den Worten : "Für immer ein Surrealist zu bleiben ist wie wenn man sein ganzes Leben nur Augen und Nasen malt."
Im Jahr 1958 begann Dali die Serie seiner großformatigen Gemälde mit geschichtlichen Themen. Er malte ein solches Monumentalgemälde pro Jahr - jeweils in den Sommermonaten in Lligat. Das berühmteste, die Die Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus hängt im Dali Museum in St. Petersburg in Florida.
4. Kunstepochen
4.1 Zuordnung und Begründung
Dalí ist ein surrealistischer Künstler. Der Surrealismus ist eine Stilrichtung der Moderne des 20. Jahrhunderts und entstand im 1. Weltkrieg. Er ist die Reaktion auf den Zusammenbruch der traditionell-abendländischen Wertvorstellungen, deren Ziel die Wiederherstellung der ursprünglichen Ganzheit des Menschen und die Befreiung des Geistes aus inneren und äußeren Zwängen war.
Bei surrealistischen Kunstwerken wurde versucht, das rationale Denken während der Arbeit völlig auszuschalten. Man versuchte, Träume zeichnerisch darzustellen, wobei die Schnelligkeit, mit der man seinen Traum auf dem Papier brachte, die Traumnähe vergrößerte.
Die Bildaufbauten vieler bekannter Surrealisten ähneln sich sehr. So sind zum Beispiel weite allgegenwärtig. Die Bilder der Surrealisten haben oftmals traumhafte und abstrakte Wirkung auf dem Betrachter.
Der Surrealismus hat auch in der Literatur seinen Einzug erhalten. Dort konnte mit Hilfe von literarischen Impulsen aus der deutschen Romantik und des französischen Symbolismus und unter dem Einbeziehen den zeitgenössischen Wissenschaften, wie Psychiatrie und Psychoanalyse die Literatur als Medium der Weltveränderung und Selbsterkenntnis neu definiert werden.
Während des Futuristischen Manifests 1909 begannen die Anfänge des Surrealismus. Erst 1917 wurde der Surrealismus als solcher benannt. Er beschreibt eine künstlerische Richtung, die das "Überwirkliche" als Ziel hat. Er erhielt 1921 durch Breton Einzug in Paris. Gegen Ende der surrealistischen Kunstepoche flüchten viele der großen Künstler aufgrund der Bürgerunruhen in die USA.
Heute wird all das als surrealistisch bezeichnet, was traumhaftes oder mystisches so darstellt, das es einen möglichst hohen Realitätscharakter bekommt.
5. Umfeld
5.1 Zeitgeist – Gesellschaft
Schon früh bekundete Dalí Sympathie für das Regime des Francisco Franco auch für Adolf Hitler, eine seiner Aussagen zu diesem Thema: „Franco, I believe, is probably the only intelligent man today in politics.“.
Immer wieder äußerte Dalí exzessive Lobpreisungen über die spanische Diktatur Franco, in welchem Dalí seinen Glückwunsch für die Hinrichtung von vier Antifaschisten aussprach und feststellte, es müssten noch mehr Exekutionen durchgeführt werden. Der Surrealistenkreis um André Breton schloss Dalí wegen seiner pro-faschistischen Einstellung bereits 1934 aus seinen Reihen aus, was diesen in seinem Aplomb gegenüber vielen zeitgenössischen Künstlern bestärkte: „Der Surrealismus bin ich!“
In den USA fand Dalí Anklang mit dem Bekenntnis, Antikommunist zu sein. Politikwissenschaftler wie Vincente Navarro werfen Dalí vor, nach der Rückkehr aus den USA seine ehemaligen, linksorientierten Freunde beim Regime denunziert zu haben.
Dalí war aber auch bekannt für seinen üppigen Lebensstil und seine Gewinnsucht, die er nicht verhehlte: „Salvador Dalí, myself, is very rich, and loves tremendously money and gold.“
5.2 Stand der Technik
Ab Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts kommt die industrielle Großproduktion auf. Die Dampfmaschine wird durch den individuellen Elektroantrieb ersetzt. So bestand nun die Möglichkeit, den Produktionsprozess neu zu gestalten und zu organisieren. Doch es ist anzunehmen, dass neue Produktionsprozesse, wie die Fließ- und Massenfertigung, nicht realisiert worden wären, wenn es nicht eine radikale Änderung der Betrachtungsweise des Produktionsprozesses gegeben hätte. So wurden die Produktionsvorgänge von einem abstrakteren Gesichtspunkt betrachtet und konnten so besser optimiert werden. Aus diesen Optimierungen, die sich überwiegend im Bereich der mechanischen und chemischen Industrie abspielten, bildeten sich die Fertigungstechnik, die Verfahrenstechnik, die Förderungstechnologie und auch die Verarbeitungstechnologie heraus. Diese Bereiche waren nun nicht mehr an die einzelnen Technologierichtungen gebunden und konnten so allgemeingültige Verfahren und Prozesse entwickeln.
Prägende Technologien sind Automobil, Fließband, Flugzeug und Funktechnik.
Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurde mit der Entwicklung der Atombombe und dem Aufkommen der Atomtechnologie zum erstenmal in der Geschichte die Selbstauslöschung der Menschen durch Technologie ermöglicht. Der Umgang mit Technologie und technischem Fortschritt wurde damit zur existentiellen Frage der Menschheit. Andere Technologien haben ebenfalls potentiell globale, katastrophale Folgen (Gentechnik, globale Erwärmung), so dass für manche der Begriff Technologie erstmals eine negative Nebenbedeutung bekommen hat und es Bestrebungen zur Begrenzung des technischen Fortschritts und zur Technologiefolgeabschätzung gibt. Jedoch ist die technologische Entwicklung insgesamt relativ positiv zu bewerten, bezüglich ihrer Folgen. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hat der Menschheit die Möglichkeit gegeben, die rechnerische Leistung des Gehirns mittels Computer zu multiplizieren (mit exponentieller Geschwindigkeit), was weitaus größere Folgen für den menschlichen Fortschritt haben wird, als die Multiplizierung des Muskelkraft von Menschen die durch die industrielle Revolution zustande kam.
Prägende Technologien dieser Zeit sind Kernkraft, Raumfahrt, Informationstechnologie und Gentechnik.
Jedoch erscheint es mir wichtig zu erwähnen, dass Dalí selbst das Mechanische und den Industrialismus. Die Behandlung des Autos im Bild Paranoisch-kritische Einsamkeit (1935) ist charakteristisch für seine Verachtung, da das Auto wie ein Fossil aus dem Stein geschnitten ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Individueller Bezug
6.1 Begründung der Wahl
Auf Salvador Dalí bin ich durch sein Bild Die Beständigkeit der Erinnerung vor schon längerer Zeit aufmerksam geworden.
Aus diesem Grund wählte ich ihn und seine Kunst für dieses Referat, um mehr über ihn zu erfahren.
6.2 Eigene Meinung über den Künstler
Meiner Meinung nach verkörpert Salvador Dalí einen Künstler, den man nie vollends verstehen und begreifen kann. Ich bin von seiner gesamten Art beeindruckt, von seinem Lebensstil, der oftmals an die Grenzen des legitimen stieß, von der Bedeutung seiner Bilder, die einen teilweise schockiert. Am meisten beeindruckte mich jedoch Dalís Fantasie, mithilfe derer er Bilder wie Die Beständigkeit der Erinnerung oder Gala betrachtet das Mittelmeer, das sich in (...) Abraham Lincolns verwandelt (1976) erschuf.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die persönlichen Daten von Salvador Dalí laut dieser Zusammenfassung?
Salvador Felipe Jacinto Dalí Doménech wurde am 11. Mai 1904 in Figueras, Katalonien, geboren. Er war der Sohn des Notars Salvador Dalí y Cusi und wuchs in einer bürgerlichen Familie auf. Er hatte einen älteren Bruder namens Salvador, der vor seiner Geburt starb, und eine jüngere Schwester namens Ana María. Er heiratete Helena, genannt Gala, eine russische Immigrantin, im Jahr 1958 (kirchliche Trauung; Gala war zuvor mit Paul Eluard verheiratet). Dalí war Maler, Schriftsteller, Bildhauer, Bühnenbildner und Schauspieler. Er starb am 23. Januar 1989 in Figueras.
Welche Einflüsse und Freundschaften prägten Dalís künstlerische Laufbahn?
Dalí wurde von Ramon Pitchot (Impressionismus), dem italienischen Futurismus, Luis Buñuel, Federico García Lorca, Pedro Garfia, Juan Gris (Kubismus), Pablo Picasso, André Breton, Joan Miró und Antoni Gaudí beeinflusst. Er schloss Freundschaften mit vielen dieser Künstler.
Was sind die wichtigsten Ereignisse in Dalís Leben, die in diesem Dokument genannt werden?
Zu den wichtigsten Ereignissen gehören seine Geburt (1904), sein Studium an der Kunstakademie in Madrid, seine Bekanntschaft mit Gala (1929), sein Anschluss an die Surrealistengruppe, seine erste Reise in die USA, die Veröffentlichung seiner Autobiografie "Das geheime Leben des Salvador Dalí", seine Rückkehr nach Spanien, die Eröffnung des Dalí-Museums in Figueras, der Tod seiner Frau Gala (1982) und sein eigener Tod (1989).
Was ist die "paranoisch-kritische" Methode Dalís?
Die "paranoisch-kritische" Methode ist Dalís Methode zur irrationalen Erkenntnis, die auf der kritisch-interpretierenden Assoziation wahnhafter Phänomene beruht. Er beschreibt sie als ein Mittel, um seine zahllosen Phantasien und Halluzinationen illustrativ zu visualisieren.
Welche Bildthemen und Symbole sind charakteristisch für Dalís Werke?
Häufige Themen sind Raum, Rausch, Fieber und Religion. Symbole umfassen Löwenköpfe, Heuschrecken, weiche Uhren, Telefone, Pferdekarren und Schubladen. Die weichen Uhren sind besonders bekannt und symbolisieren die Beständigkeit der Erinnerung.
Welche Museen sind Salvador Dalí gewidmet?
Es gibt zwei Museen, die ausschließlich Dalís Werken gewidmet sind: das Dalí Museum in St. Petersburg, Florida, und das Teatre-Museu Dalí in Figueras, Spanien. Das Schloss von Púbol und das Wohnhaus in Port Lligat sind ebenfalls öffentlich zugänglich.
Wie wurde Dalí politisch eingeordnet und wie wirkte sich dies auf sein Leben aus?
Dalí äußerte Sympathie für das Regime von Francisco Franco und für Adolf Hitler, was zu Kontroversen führte. Er wurde 1934 aufgrund seiner pro-faschistischen Einstellung aus dem Surrealistenkreis um André Breton ausgeschlossen.
Wie beschreibt das Dokument Dalís Charakter und Lebensphilosophie?
Dalí wird als exzentrisch, exhibitionistisch und von dem Bedürfnis getrieben beschrieben, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Er arbeitete hart an seinem Image eines exzentrischen und paranoiden Genies. Gala wird als diejenige beschrieben, die seine Verrücktheit heilte und ihn wieder Herr über sich selbst werden ließ.
Welcher Kunstepoche wird Dalí zugeordnet?
Dalí wird dem Surrealismus zugeordnet, einer Stilrichtung der Moderne des 20. Jahrhunderts, die als Reaktion auf den Zusammenbruch traditioneller Wertvorstellungen entstand.
Was war Dalís Meinung zum industriellen Zeitalter?
Dalí verachtete das Mechanische und den Industrialismus. Er sah Technologien, wie das Auto, wie Fossilien.
- Citar trabajo
- Ali Ojeda (Autor), 2006, Salvador Dalí, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109755