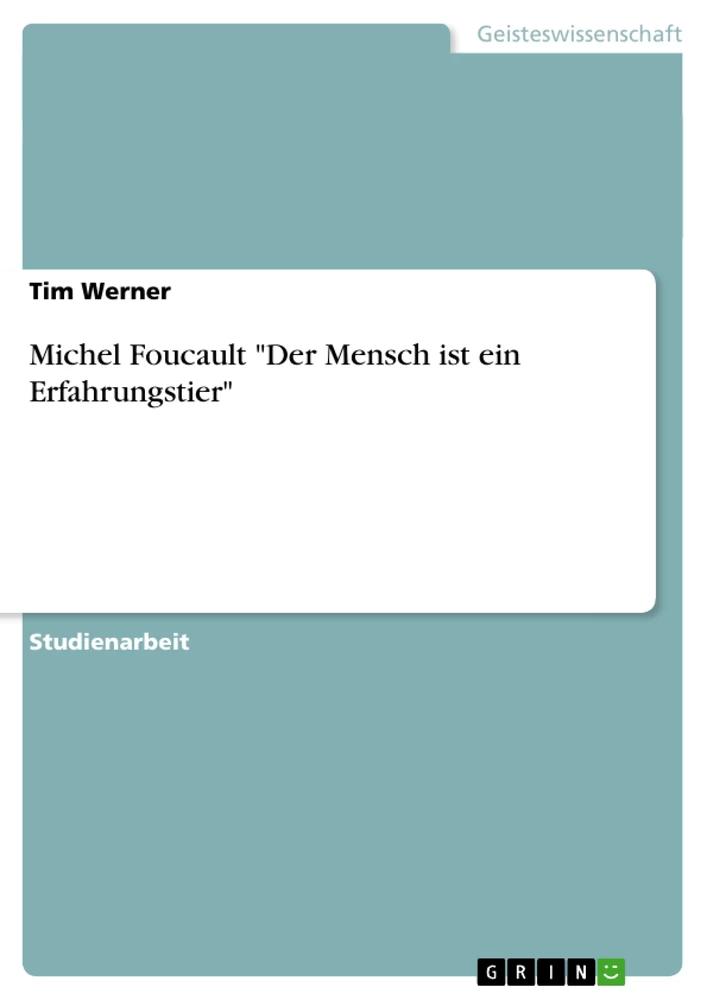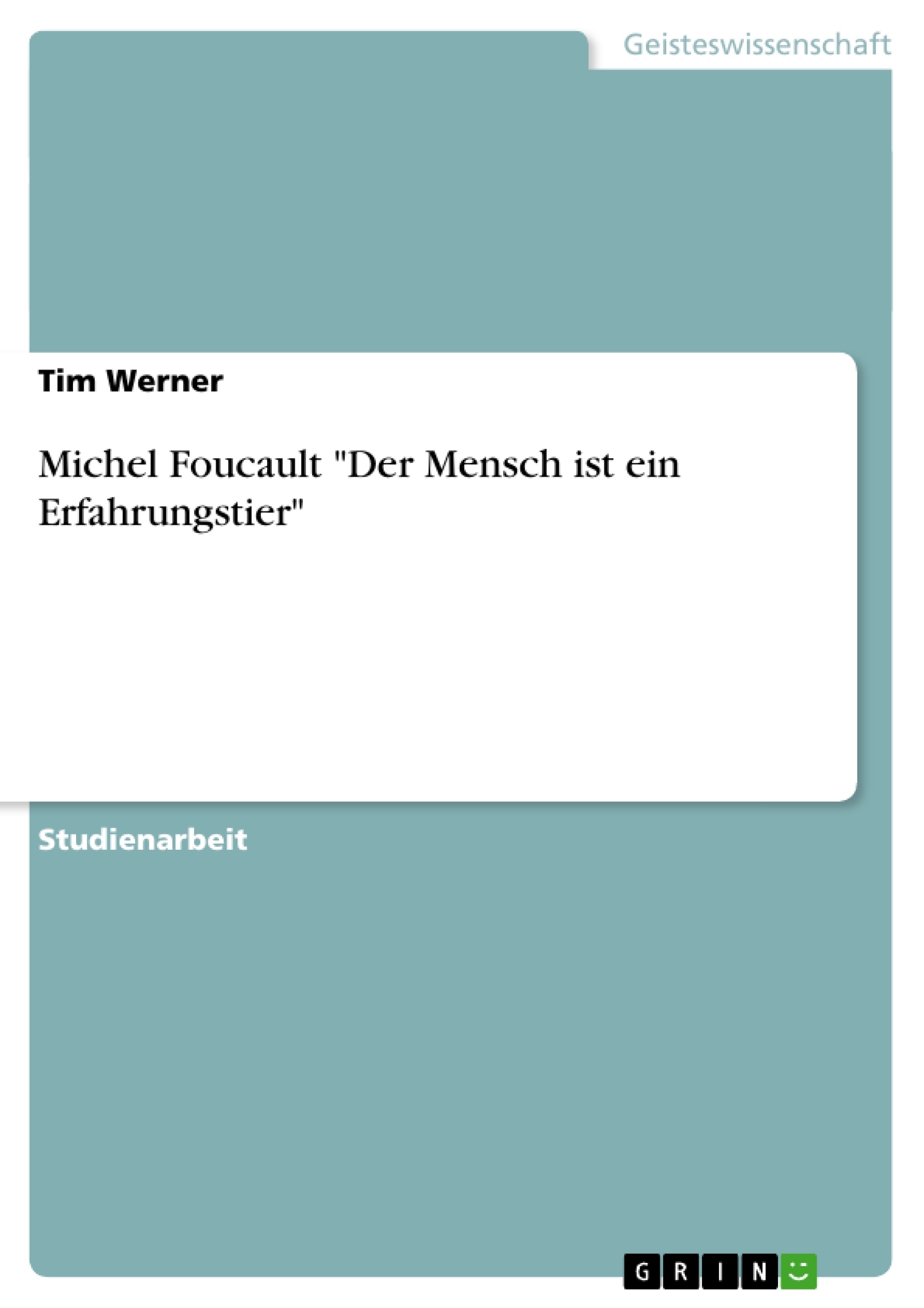Was bedeutet es, ein "Erfahrungstier" zu sein? Diese Frage durchdringt Michel Foucaults Denken und Handeln, wie dieses faszinierende Werk offenbart. Es ist keine trockene Abhandlung, sondern eine Einladung, die Welt mit neuen Augen zu sehen und eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen. Anhand eines tiefgründigen Gesprächs mit Ducio Trombadori entfaltet sich ein vielschichtiges Bild des Philosophen, Historikers und Gesellschaftskritikers Foucault, der sich stets im Wandel befand. Entdecken Sie die prägenden Einflüsse seiner Jugend im von Faschismus besetzten Frankreich, seine Auseinandersetzung mit Hegel, Nietzsche und der Psychoanalyse, sowie seine intensive Beschäftigung mit Machtstrukturen und Diskursen. Foucaults Streben nach persönlicher Transformation durch Grenzerfahrungen und sein Engagement für soziale Gerechtigkeit werden ebenso beleuchtet wie seine komplexen Beziehungen zum Marxismus, Strukturalismus und der Frankfurter Schule. Erfahren Sie, wie Foucaults Analysen von Wahnsinn, Sexualität und Strafsystemen nicht nur historische Phänomene untersuchen, sondern auch aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen beleuchten. Dieses Buch ist mehr als eine Einführung in Foucaults Werk; es ist eine Aufforderung, sich selbst und die Welt kritisch zu reflektieren, um neue Perspektiven und Möglichkeiten des Handelns zu eröffnen. Schlüsselwörter: Michel Foucault, Erfahrung, Macht, Diskurs, Strukturalismus, Philosophie, Geschichte, Sozialkritik, Subjekt, Wahrheit, Wissen, Ethik, Lebenskunst, Frankreich, 20. Jahrhundert, Gesellschaft, Denken, Erkenntnis, Antipsychiatrie, Sexualität, Strafe, Gefängnis, Humanismus, Poststrukturalismus, Moderne, Subjektivität, Alterität, Wahrheit, Wissen, Ethik, Politik, soziale Bewegungen, Mai 68, Algerienkrieg, Intellektuelle, Engagement, Transformation, Kritik, Gesellschaftsanalyse, Diskursanalyse, Machtanalyse, Subjektkonstitution, historische Epistemologie, Archäologie des Wissens, Ordnung des Diskurses, Überwachen und Strafen, Sexualität und Wahrheit, Geständnisse des Fleisches, Der Mensch ist ein Erfahrungstier, Suhrkamp Verlag, Wilhelm Schmid, Ducio Trombadori, Erkenntnistheorie. Ergründen Sie die Tiefen von Foucaults Schriften über Machtbeziehungen und wie sie unser Verständnis von Institutionen, Normen und Identitäten prägen. Lassen Sie sich von Foucaults leidenschaftlichem Plädoyer für ein Denken inspirieren, das keine Angst vor Widersprüchen hat und stets nach neuen Wegen sucht, um die Welt zu verändern. Dieses Buch ist eine intrigue Reise in das Universum eines der bedeutendsten Denker des 20. Jahrhunderts, eine Reise, die Ihr eigenes Denken herausfordern und bereichern wird.
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog
2. Zitate
3. Zur Person „Paul Michel Foucault“
4. Erste Eindrücke
5. Das Gespräch
6. Zusammenfassung und Eigenreflexion
7. Exkurs Frankreich von 1870 – 1981 und de Gaulle
8. Literaturverzeichnis
9. Erklärung
1. Prolog
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem „Taschenbuch“ des Suhrkamp Verlages „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“. Dieses Buch beinhaltet ein Ende 1978 geführtes Gespräch von Ducio Trombadori mit Michel Foucault, sowie ein Vorwort von Wilhelm Schmid. Im Anhang befindet sich eine Bibliographie von Andrea Hemminger.
Es wird ein Überblick über Foucaults Leben in Anlehnung an das Vorwort von Wilhelm Schmid gegeben, sowie eine Zusammenfassung des Gespräches.
Es soll anhand von Aussagen im Gespräch sowie den biographischen Daten Foucaults dargestellt werden, um was es Foucault in seinen Büchern geht und es soll die These der stetigen fließenden Entwicklung Foucaults zu weiteren Themen bekräftigt werden.
Diese Hausarbeit gibt Auskunft über Michel Foucaults Denk und Arbeitsweise und versucht darzustellen was er mit seinen Schriften bewirken wollte.
Im folgendem befindet sich eine Zusammenfassung sowie eine Reflexion über die Thesen Foucaults und deren „Übertragbarkeit“ in die soziale Arbeit sowie in die heutige Gesellschaft und deren Anforderungen.
Im Anhang befindet sich ein Exkurs über die Geschichte Frankreichs, die helfend über die Ereignisse in Frankreichs Geschichte aufklärt, sowie ein Personalie von Charles de Gaulle.
2. Zitate
„ Foucault gilt nicht selten als Denker der Disziplinargesellschaften und ihrer prinzipiellen Technik, der Einschließung ( nicht allein Hospital und Gefängnissen, sondern auch Schule, Fabrik, Kaserne). Aber in Wirklichkeit gehört er zu den ersten, die sagen, daß wir dabei sind, die Disziplinargesellschaften zu verlassen, daß das schon nicht mehr unsere Gegenwart ist.“[1]
„Das Problem besteht gerade darin herauszufinden, ob es gut ist, sich im Inneren eines „Wir“ zu situieren, um den Grundsätzen, die man Erkennt, und den Werten, die man akzeptiert, Geltung zu verschaffen – oder ob es nicht besser wäre, die Entwicklung eines neuen „Wir“ möglich zu machen, indem man die Frage ausarbeitet. Mir scheint nämlich, daß das „Wir“ der Frage nicht vorausgehen kann; es kann nur das Ergebnis – und das notwendigerweise provisorische Ergebnis – der Frage sein, wie sie sich in den neuen Formen stellt, in denen sie formuliert wird.“[2]
„Ein Denken ist dann als historisch zu qualifizieren, wenn es die erkenntnistheoretischen Kosten des Faktums der Historizität für seine intellektuellen Praktiken zu (er)tragen bereit ist. Foucault hat versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. In diesem Sinne ist er ein Historiker par excellence “[3]
„ Foucault schwankt zwischen zwei gleichermaßen unzulänglichen Haltungen. Einerseits folgt er einem Machtkonzept, das ihm die Verurteilung inakzeptabler Seiten der modernen Gesellschaft verbietet. Gleichzeitig verrät aber seine Rhetorik die Überzeugung, daß modernen Gesellschaften nichts zugute gehalten werden kann. Was Foucault offensichtlich fehlt, sind normative Kriterien zur Unterscheidung der annehmbaren von den unannehmbaren Formen der Macht.“[4]
3. Zur Person „Paul Michel Foucault“
Paul Michel Foucault wird am 15. Oktober 1926 in Poitiers geboren, als Sohn eines Chirurgen und einer Chirurgen - Familie entstammenden Mutter.
Das Grundanliegen seines Denkens wird geprägt als er Abitur macht, denn Frankreich war zu dieser Zeit okkupiert von den Deutschen Faschisten.
Er studiert an der „Ecole Normale Superieure“ in Paris und läßt dort seine konservative und katholische Herkunft hinter sich. Er interessiert sich besonders für Psychologie und hat laut seiner Kommolitonen einen. „ Sehr lebhaften Sinn für alle Künste“, wie z. B. Stiche von Goya.
Nach seiner Prüfungsvorbereitung bei Louis Althusser, aus denen er auch seine Erfahrungen und Kontakte mit dem Kommunismus macht[5], legt er sein Examen in Philosophie, seinen Abschluß in Psychologie, und eine Magisterarbeit über Hegel ab und wird kurz darauf Assistent für Psychologie an der Uni von Lille.
Man spricht von „4 Eckpunkten seines Denkens“[6]
(1) Auseinandersetzung mit Psychologie, Psychiatrie und Medizin.
(2) Die Erarbeitung einer „Archäologie“ und Diskurstheorie als Verfahrensweise, bei der man, wie Foucault sagte:„den Raum untersucht, indem sich das Denken entfaltet, sowie die Voraussetzung dieses Denkens, die Art und Weise seiner Entstehung“
(3) Die Analyse der Machtbeziehungen.
(4) Die Zuwendung zu Fragen der Ethik und der Lebenskünste
Trotz dieser vier zeitlich ineinander übergehenden Eckpunkte seines Denkens spricht man bei ihm jedoch nicht von einem „frühen“ oder „späten“ Foucault, da Ansätze und Aussagen seiner frühen Arbeiten sich ebenfalls in seinen späten Arbeiten finden.
Seine ganze Arbeit wird durchzogen von der Frage nach dem Subjekt und von einer Methode „Der Geschichte des Denkens“, „das für ihn aber nicht ausschließlich das „reine Denken“ ist, sondern auch das Denken, das eine Praxis reflektiert, die aus irgendwelchen Gründen fragwürdig wird“[7]
Als er sich in der Zeit nach seinen Abschlüssen mehr mit Nietzsches Schriften und denen Heideggers befasst, wendet der vorher so an Hegel orientierte Foucault sich von den idealistischen Philosophien Hegels ab:
„Was den tatsächlichen Einfluß Nietzsches auf mich betrifft, bekannte er einmal später, so fällt es mir schwer, ihn zu präzisieren, eben weil ich mir darüber im klaren bin, daß er sehr tiefgehend war. Ich kann nur sagen, daß ich ideologisch „Historizist“ und Hegelianer gewesen bin, solange ich Nietsche nicht gelesen hatte“
Foucaults erste Ansätze sind die Auseinandersetzung mit Psychologie und Psychopathologie. Er veröffentlicht in einem Buch über den Stand der Wissenschaftlichen Forschung in Frankreich, das einen Beitrag von ihm über Psychologie enthält.
1954 veröffentlicht er seine erste eigene Arbeit „ Psychologie und Geisteskrankheit“, in der er die Frage behandelt, in wie fern man in der Psychopathologie überhaupt von Krankheit sprechen kann und spricht sich gegen eine Festlegung des Menschen in bestimmte Kategorien aus, wie einst auch sein Lehrer Georges Canguilhem.[8]
„ Die Geschichte des Wahnsinns“ einer Arbeit auf Anfrage von Jean Delay[9] bringt Foucault dann plötzlich eine gewisse Berühmtheit.
Er schreibt diese Arbeit um klar zu stellen wie sehr ein eigener Standpunkt oder eine subjektive Sichtweise davon Abhängig ist aus Welcher „Warte“ man zum Beispiel den „Wahnsinn“ sieht; er spricht davon:„welchen Begriff man sich von etwas macht beeinflußt das Urteil“ und das dieser Begriff höchst wandelbar ist, „... was nicht heißt, daß es keinen Wahnsinn gibt“.
Er schreibt diese Arbeit in Schweden, wo er als Lektor an der Uni Uppsala arbeitet sowie in Warschau, gleichzeitig schreibt er in dieser Zeit ebenfalls eine Übersetzung Kants ins Französische[10] zusammen mit einer 128 seitigen Einleitung.
Die beiden Arbeiten zusammen bilden seine Dissertation und als Direktor des „Institut franÇais“ in Hamburg schloß er seine Arbeit ab.
Das Ergebnis, als eine „Archäologie des Zeitalters der Vernunft“ 1961 vorgelegt, stößt auf einigen Widerspruch, vor allem von Seiten der französischen Gesellschaft für Psychoanalyse.
Dieses gespannte Verhältnis zu den Psychoanalytikern begleitet ihn nun auf den nächsten Stationen seines Lebens.
Nachdem er als „Maître de conférences“ in Clermont – Ferrand arbeitet geht er 1965 auf Grund einer Einladung kurz an die Universität Sao Paulo und danach nach Tunis.
Er will auf Distanz zur Politik des Frankreichs der mittleren sechziger Jahre und möchte seine Kultur von „Außen“ betrachten um aus einem anderem Blickwinkel Beurteilen zu können.
Inzwischen hat er 1963 zwei weitere Bücher veröffentlicht, „ Die Geburt der Klinik“, eine, so nennt er sie, „Archäologie des ärztlichen Blicks“.
Wie meist in seinen Werken benutzt er einen begrenzten Zeitraum der Betrachtung, zumeist das 18. Jahrhundert im Übergang in das 19. Jahrhundert, sowie eine bestimmte Anzahl von Texten, die er zu Grunde legt;
Sowie ein Buch über den französischen Literaten „ Raymond Roussel“ von dessen Sprache er begeistert war.
Langsam verlagert Foucault seine Arbeiten, mit den nach 1963 folgenden Aufsätzen, die unter „Dits et Ecrits“[11] erscheinen taucht ein zweiter Schwerpunkt auf; der Erarbeitung einer Archäologie und Diskurstheorie.
Das 1966 erscheinendem Buch „ Die Wörter und die Dinge“[12] ein Werk das noch im selben Jahr eine Auflage von zwanzigtausend verkauften Exemplaren erreicht, ist wiederum eine historische Arbeit in der Foucault vor allem den Übergang vom achzehnten in das neunzehnte Jahrhundert beleuchtet, allerdings sich auf allgemeine Wissensformen jener Zeit beschränkt wie zum Beispiel Arbeiten, Leben und Sprache.
Er beschreibt die Veränderung der Wissensform von der Zeit der „Renaissance“ zum „Klassischen Zeitalter“ und zur Schwelle der „Moderne“, dies hieß für Foucault „hin zu KANT“.
„Die „Wörter“ bzw. Ordnung der Dinge“ bezeichnen einen Sturmlauf gegen die Festlegung des Menschen in bestimmte „Transzendalen Grenzen“ und Foucault spricht vom „Tod des Menschen“ so wie Nietzsche vom „Tod Gottes“ und wir ebenso mißverstanden.
„ Der Tod des Menschen richtet sich gegen die Festlegung des Menschen für alle Zeit und es ist damit gemeint, daß der Mensch in den Strukturen, die er selbst erschaffen hat und die in der Moderne allgegenwärtig geworden sind, untergeht (...)[13]
Er kritisiert damit die Ungreifbarkeit des Humanismus, von sich verändernden „Epistemen“ und das der Mensch selbst Teil einer normativen Ordnung wird, egal wo er lebt und wie.
Foucault wird nun endgültig Bekannt und zu den Strukturalisten gezählt, welche zu einer Bewegung des sogenannten „Strukturalismus“ gehören. Man versteht darunter eine Bewegung des „Denkens“ deren Geschichte geschrieben wird, seit es den „Begriff“ als solches gibt. Man kann dennoch zwei Momente hervorheben, welche die Arbeit all dieser sogenannten Strukturalisten charakterisieren:
1. In methodischer Hinsicht geht es ihnen darum, einen Gegenstand der Forschung, einen Bereich des Wissens nicht auf Inhalte, sondern auf formale Strukturen hin zu befragen, um die funktionalen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen zu analysieren.
2. In politischer Hinsicht stand dahinter durchaus die Absicht, das herrschende Denken des Marxismus zu untergraben. Behandelte der Marxismus die ökonomischen Strukturen als zentral und unhintergehbar für das menschliche Dasein, verantwortlich für die Entfremdung des Menschen wie für deren Aufhebung, erwies die Arbeit der Strukturalisten die Beschränktheit und Relativität dieses Standpunkts. Das dürfte dazu beigetragen haben, daß die französischen Intellektuellen in den siebziger Jahren in Scharen dem Marxismus davonliefen, als Foucaults Buch erschien, war der Strukturalismus von Foucault, Roland Barthes, Jaques Lacan, Claude Lévi Strauss und vielen anderen bereits zur Mode geworden. Sartre hatte gut wettern, einer wie Foucault sei das letzte Bollwerk der Bourgeoisie – Foucault lachte nur: „Arme Bourgeoisie, wenn ich ihr letztes Bollwerk bin“. Die marxistischen Schemata blieben noch einige Jahre in Gebrauch, um sich dann als überholt zu erweisen. Währenddessen, so heißt es, erklärten sogar die Fußballtrainer, daß sie ihre Mannschaft auf strukturalistische Weise neu organisierten.“[14]
1969 erscheint ein weiteres Werk Foucaults „Die Archäologie des Wissens“. Sie stellt ein zentrales Werk Foucaults dar, das nie ausreichend rezipiert wird, es enthält „Erkenntnistheoretische Erörterungen“ sowie Abhandlungen und Rechenschaft über seine „archäologische“ Methode, Geschichte zu schreiben anhand von Diskursen, historischen Beschreibungen und diskursiven Formation. Es beinhaltet das Handwerkszeug für eine Unzahl von Arbeiten, die nach dieser Weise Foucaults geschrieben wird.
Foucault verfaßt nach gleicher Weise auch eine „ archäologische Beschreibung der Sexualität“, dessen erster Band unter dem Titel „Der Wille zum Wissen“ erscheint, sie markiert den Übergang zum 3. Schwerpunkt Foucaults, der Analyse von Machtbeziehungen.
Foucault, der wenig Anteil nimmt an den politischen Erruptionen Frankreichs, vor allem im Mai 1968, erwirbt 1970 die Kandidatur um den Lehrstuhl für die „Geschichte der Denksysteme“ und setzt sich gegen Paul Ricoeur durch , dort hält er seine berühmte „Inauguralvorlesung“ am Collège de France:
„ Die Ordnung des Diskurses“, sie vollzieht sozusagen bereits Foucaults Verlagerung seines Schwerpunktes. Foucault entwirft dort ein Arbeitsprogramm, mit dem er die Wirkungsweise der Macht zu analysieren vermag und sie noch in den unscheinbarsten Phänomenen aufspüren kann.
Man beschreibt ihn in dieser Vorlesung als „buddhistisch im Stil“ mit „mephistophelischen Blick“ und voll von „unwiderstehlicher Ironie.“
Foucault veröffentlicht 1975 die Niederschriften seiner praktischen Erfahrung in „Überwachung und Strafen“, in der er die „Geburt des Gefängnisses historisch betrachtet, wie gewohnt über einen gewissen Zeitraum des 18. Und 19. Jahrhunderts, aber es geht thematisch um das Funktionieren von Machtbeziehungen aufzuzeigen, denen Subjekte unterliegen, nicht was das Gefängnis oder den Staat sondern die Gesellschaft betrifft.
In „Der Wille zum Wissen“[15] beschreibt er dazu die wichtigste Punkte seines Denkens, er unterscheidet nun auch zwischen Machtbeziehungen und Herrschaftsverhältnissen. Es ging ihm nicht darum die Macht abzuschaffen, sondern Herrschaftsverhältnisse zu verhindern, indem er diese als umkehrbar und durchschaubar beschreibt
Nachdem die Fortsetzung dieses Werkes ihm als zu langweilig erscheint findet er bei gleicher Thematik ein neues Aktionsfeld in der Antike, für die es um Erotik aber nicht um Sexualität geht. Er entdeckt ein neues Aktionsfeld für ein altes Problem, das ihm schon lange begleitet:
Machtanalysen: „Wie kann das Subjekt, das doch bestimmten Machtkonstruktionen unterliegt, diesen entkommen und sich selbst neu konstruieren?“
Er gleitet damit über in seinen vierten Schwerpunkt, zu Fragen der Ethik und der Lebenskünste. 1983 sagt Foucault: „ Eine Gesellschaft kann nur von der Arbeit leben, die sie an sich selbst und ihren Institutionen verrichtet“ und ein Jahr später erscheinen 2 weitere Bände Foucaults.
„Der Gebrauch der Lüste“ und „Die Sorge um sich“, als Fortsetzung des Projektes „Sexualität und Wahrheit“ dessen viertes und letztes Band „Die Geständnisse des Fleischers“ sich im Nachlaß Foucaults befinden.
Foucault stellt sich Ethik als Form von Lebenskunst vor und einer „Ästhetik der Existenz und es geht um Techniken er Existenz, wie einst in der antiken Philosophie.
Beeinflußt beim schreiben dieser Werke wird Foucault durch Pierre Hadots Buch „Geistige Übungen in der Antike“[16]
Seine letzten Jahre gibt er Vorlesungen in Berkeley, wo er wie ein Popstar gefeiert wird und spielt dort seine Rolle eine Zeit lang, bis er sich zurückzieht in die Einsamkeit.
Nachdem die ersten Anzeichen seiner unheilbaren Aids – Krankheit nun schon sichtbar werden, ahnt er das er bald sterben muß und von seinem Arzt bestätigt, will er nur noch wissen wieviel Zeit er noch hat, denn er will noch arbeiten und seine Sehnsucht, die ihn das ganze Leben begleitet, nämlich sich nie einer Identität anzuschließen oder sich in einer einzuschließen, bleibt bis zuletzt wach.
Eine Merkwürdige Begebenheit vor seinem Tod:
Foucault trägt seiner Sekretärin auf, bei allen weltweiten Einladungen zuzusagen, woraufhin sich seine Termine heillos überschneiden als er am 25. Juni 1984 starb.
Sein Traum war schließlich die Zersplitterung der Identität.
4. Erste Eindrücke
Die ersten Fragen, Antworten und Seiten des Buches, sowie sogar schon das Vorwort von Wilhelm Schmid erinnern an das, was ein Lehrer einst in der Schule sagte: „Wenn Sie studieren gehen, werden Sie lernen, dass Sie nichts Wissen...“
Fast alle Begrifflichkeiten kommen einem Fremd vor, man kommt sich vor wie in einer anderen „Welt der Sprache“, die des sogenannten Existentialismus, der Phänomenologie oder der Epistemologie. Es ist als ob Hegel, Freud und Nietzsche zusammengefaßt wären in einer Person.
Eine Unvoreingenommenheit des Lesers ist dennoch beim Lesen dieses Interviews am besten, denn ohne etwas zu wissen, ohne sich vorher einen „Begriff“ von Foucault gemacht zu haben, gelangt man besser zum wesentlichen seiner Aussagen und Gedanken.
Sieht man die Epoche, in der Foucault aufwuchs und wie seine Sozialisation seinen Lauf nahm, so erkennt man, welchen Einflüssen er „unterlag“ beziehungsweise welche epochalen Geschehnisse ihn in seiner Arbeit bewegten und sein Denken prägten. Dennoch erscheint es einem von Anfang an sehr kompliziert ihm zu folgen, bewegt er sich in seinen Aussagen und Antworten sehr schnell und geschickt; auch ohne sofort Zugang zu seinen Aussagen zu bekommen, denkt man unwillkürlich, dass etwas völlig „Anderes“ vor einem liegt, als das oft sehr einheitliche „Kauderwelsch“ manch anderer Philosophen.
So schwer es einem manchmal fällt seinen Worten zu folgen, so macht es einen doch sofort „nachdenklich“, „... der Mensch als Subjekt...“, die „Macht“ und der „Begriff“ all dessen, das hört sich zu allererst sehr „komisch“ an für einen viellecht proletarischen Leser und dennoch, wenn man darüber sinniert was es bedeuten könnte, was man sofort tut, wird einem langsam klar worüber es sich in Foucaults Werken drehen könnte.
Vielleicht möchte so mancher Leser das Buch am liebsten sofort wieder zur Seite legen, aber irgend etwas treibt einen immer wieder dazu verstehen zu wollen, was dieser Mensch sich bei seinen Aussagen denkt, man ist begeistert über all die vielen Arbeiten und Veröffentlichungen und man möchte einfach weiterlesen...
4. Das Gespräch
In dem Ende 1978 geführtem Interview mit Michel Foucault eröffnet Ducio Trombadori das Gespräch, indem er Foucault eine mögliche eigene subjektive Erklärung darüber gibt, warum das öffentliche Interesse an F´s Werken stetig ansteigt. Er „unterstellt“ Foucault das er „ ... sprunghaft, nämlich über Verschiebungen der Forschungsebenen...“[17] vorgeht und fragt dann wie Foucault heute über seine Werke von früher denkt und ob er einiges für überholt hält.
Foucault macht daraufhin auch im weiteren Gesprächsverlauf folgende Aussagen über Erfahrungen:
„ Vieles ist gewiß überholt. Mir ist durchaus bewußt. Daß ich sowohl im Verhältnis zu den Dingen, für die ich mich interessiere, als auch zu dem, was ich bisher gedacht habe meine Position verschiebe. Ich denke niemals völlig das gleiche, weil meine Bücher für mich Erfahrungen sind, Erfahrungen im vollsten Sinne, den man diesem Ausdruck beilegen kann. Eine Erfahrung ist etwas, aus der man verändert hervor geht.“ [18]
„ Jedes meiner Bücher ist eine Weise einen Gegenstand zu konturieren und eine Methode zu einer Analyse zu erfinden. Ist meine Arbeit beendet, so kann ich – gewissermaßen im Rückblick – aus der soeben gemachten Erfahrung eine methodologische Reflexion entwickeln, welche die Methode herausarbeitet, der das Buch hätte folgen sollen. So das ich nahezu abwechselnd Bücher schreibe, die ich als explorative und als methodologische bezeichnen würde.“[19]
Foucault deutet damit an, was auch im weiteren Verlauf des Gespräches deutlich wird, Foucault philosophisch zu positionieren fällt schwer und er bekräftigt seine Positionslosigkeit in philosophischer Hinsicht mit folgender Aussage:
„Ich betrachte mich nicht als Philosoph. Weder betreibe ich eine bestimmte Art Philosophie, noch möchte ich andere davon abhalten, Philosophie zu betreiben.“[20]
Foucault beschreibt im Folgenden das er vielmehr von bedeutenden Einflüssen an der Universität geprägt war, bis er wiederum durch eigene Erfahrung beim Lesen von Werken wie denen von „ ... Bataille, Nietzsche, Blanchot, Klassowski aus, die alle keine Philosophen im institutionellen Verständnis waren. (...)“ [21] sein Denken änderte.
Sein gespaltenes Verhältnis zu den Lehren von Hegel und der Phänomenologie[22] erklärt er in den folgenden Zitaten.
„ Die Erfahrung des Phänomenologen ist im Grunde eine bestimmte Weise, einen reflektierenden Blick auf einen beliebigen Gegenstand des Erlebens, auf das Alltägliche in seiner vergänglichen Gestalt zu richten, um dessen Bedeutung zu erfassen. Für Nietzsche, Bataille, Blanchot dagegen bestand Erfahrung in dem Versuch, an einen bestimmten Punkt des Lebens zu gelangen, der dem Nicht-Lebbaren so nahe wie möglich kommt. Gefordert wir das Äußerste an Intensität und zugleich an Unmöglichkeit. Die phänomenologische Arbeit liegt vielmehr darin, das gesamte Feld von Möglichkeiten zu entfalten, die mit der alltäglichen Erfahrungen verbunden sind.“[23]
„Die Idee einer Grenzerfahrung, die das Subjekt von sich selbst losreißt – genau das war es, das mich bei meiner Lektüre Nietzsches, Batailles, Blanchots für mich wichtig war und genau diese Idee hat mich dazu gebracht, meine Bücher – wie langweilig, wie gelehrt sie such sein mögen – stets als unmittelbare Erfahrungen zu verstehen, die darauf zielen, mich von mir selbst loszureißen, mich daran zu hindern, derselbe zu sein.“[24]
Es wird anhand dieser Aussagen deutlich, das Foucault eher Nietzsche und Bataille folgt als den ursprünglichen Lehren, die ihm die Universität lehrte, weil ihn faszinierte, das die „Phänomenologie Nietzsches“ nicht ein System konstruiert, sondern von persönlichen Erfahrungen lebt, die auch für Foucault immer die wichtigsten sind.
Dies wird weiterhin deutlich in seinen Aussagen zu Wahrheitskriterien bei seinen Arbeiten und „Erfahrungen“:
.“ Das Problem der Wahrheit dessen, was ich sage, ist für mich ein sehr schwieriges, ja sogar das zentrale Problem. Auf diese Frage habe ich bisher niemals geantwortet.
Gleichzeitig benutze ich jedoch ganz klassische Methoden: die Beweisführung oder zumindest das, was in historischen Zusammenhängen als Beweis gelten darf – Verweise auf Texte, Quellen, Autoritäten und die Herstellung von Bezügen zwischen Ideen und Tatsächlichem; Schemata, die ein Verständnis ermöglichen, oder Erklärungstypen. Nichts davon ist originell. Insoweit kann alles, was ich in meinen Büchern sage, verifiziert oder widerlegt werden, nicht anders als bei jedem anderen historischen Buch.“[25]
„Trotzdem sagen die Leute, die mich lesen, und besonders diejenigen, die von meiner Arbeit etwas halten, oft lächelnd: „Im Grunde weißt du ganz genau, daß alles, was du sagst, nur Fiktion ist“. Ich antworte stets: „Natürlich; daß es etwas anderes wäre, davon kann gar keine Rede sein.““[26]
Er deutet hier auf „Wahnsinn und Gesellschaft“ hin, und macht anhand der Reaktion der damaligen Psychiater deutlich, wie seiner Meinung nach sein „Diskurs“ funktioniert und sagt dazu:
„ Als ich das Buch schrieb, 1958 in Polen, gab es in Europa noch keine Antipsychiatrie; (...)“ „Trotzdem wurde dieses Buch in der Öffentlichkeit immer nur als Angriff auf die heutige Psychiatrie wahrgenommen. Warum?
Weil das Buch für mich – und für diejenigen, die es gelesen und benutzt haben – eine Veränderung unseres ( historischen, theoretischen, aber auch moralischen und ethischen) Verhälnisses zum Wahnsinn, zu den Irren, zur psychiatrischen Institution und sogar zur Wahrheit des psychiatrischen Diskurses bedeutete. Es ist also ein Buch, das dem, der es schreibt, ebenso wie dem, der es liest, als eine Erfahrung dient, viel eher denn als Feststellung einer historischen Wahrheit“[27]
„Eine Erfahrung ist immer eine Fiktion, etwas Selbstfabriziertes, das es vorher nicht gab und das es dann plötzlich gibt. Darin liegt das schwierige Verhältnis zur Wahrheit, die Weise in der sie eine Erfahrung eingeschlossen ist, die mit ihr nicht verbunden ist und sie bis zu einem gewissen Punkt zerstört.“[28]
Foucault weiß um die Austauschbarkeit seiner Erfahrungen und darum, das es für jeden Menschen zu einem Thema eine eigene Wahrheit gibt, dennoch erhofft er sich über seine Werke eine Veränderung in der Gesellschaft hin zu einem anderem Bewußtseinszustand, einem anderem Denken.
Die Wahrheit in der eine Erfahrung eingeschlossen ist, ist immer subjektiv und er spricht diesbezüglich von 4 Implikationen bei seiner Arbeit.
„ Die Erfahrung, die es uns gestattet, bestimmte Mechanismen zu verstehen und die Weise, in der wir fähig werden, uns von ihnen abzulösen, indem wir sie mit anderen Augen wahrnehmen, sind nur die beiden Seiten der selben Medaille.
Dies ist in der Tat das Herz meines Unternehmens.“[29]
Foucault möchte sich erstens auf keinen gleichbleibenden systematischen theoretischen Hintergrund stützen, er schreibt zweitens kein Buch, das nicht aus einer unmittelbaren eigenen Erfahrung entstammt, er möchte klarstellen, das es sich nicht nur um eine Übertragung persönlicher Erfahrungen in Wissen handelt, sondern das „Das Verhältnis zur Erfahrung im Buch eine Transformation oder Metamorphose gestatten muß“. Und schließlich viertens, das diese Erfahrung „mit einer kollektiven Praxis, einer Denkweise“ verknüpft sein muß.
„Eine Erfahrung ist etwas, was man ganz allein macht und dennoch nur in dem Maße uneingeschränkt machen kann, wie sie sich der reinen Subjektivität entzieht und andere diese Erfahrung – ich will nicht sagen: exakt übernehmen, aber sie doch kennenlernen und nachvollziehen können.“[30]
Er spricht damit an, das man manche Erfahrungen nicht komplett nachvollziehen kann, weil die meisten Leser schlecht nachvollziehen können wie es z. B. im Gefängnis zugeht, weil sie dort nie hinein kommen werden, es ihm aber immer wichtig war, das die Leser seiner Werke sich anhand seiner Schilderungen „einfühlen“ können und die beschriebene Problematik global gesehen wird.
Er erzählt auf den nächsten Seiten wie er sein Denken entwickelte, wie er sich orientierte zu Zeiten seines Studiums und im Frankreich nach 1945 und was Philosophie für ihn bedeutete. Es wird deutlich wie Foucault sein Denken konstruiert und unter welchen Voraussetzungen dies geschieht sowie welche Ansätze ihn beschäftigen.
„ ... Die Erfahrung des Krieges hatte uns die Notwendigkeit und die Dringlichkeit einer Gesellschaft bewiesen, die radikal verschieden wäre von jener, in der wir lebten. Diese Gesellschaft, die den Nazismus zugelassen hatte, die vor ihm im Staub gelegen hatte und dann mit fliegenden Fahnen zu de Gaulle[31] übergelaufen war. Gegenüber all dem empfand ein großer Teil der französischen Jugend tiefe Abscheu,...; wir wollten völlig andere sein in einer völlig anderen Welt...“[32]
„ ... Philosophie treiben hieß damals, wie übrigens heute auch, vor allem Geschichte der Philosophie treiben, und der Gang dieser Geschichte war, auf der einen Seite begrenzt durch die Systeme der Hegelschen Theorie und auf der anderen durch die Philosophie des Subjekts, geprägt von Gestalten der Phänomenologie und des Existentialismus. Letztlich dominierte Hegel ...“[33]
Diese Aussagen stellen klar das Foucault nach neuen Antworten suchte neben denen von Hegel und denen des Existentialismus oder der Phänomenologie, er findet schließlich, so sagt er, die Schriften von Bataille, Blanchot und Nietzsche und sie stellen für Foucault:
„Zunächst eine Einladung, die Kategorie des Subjekts in Frage zu Stellen, seine Suprematie, seine fundierende Rolle. Dann die Überzeugung, daß eine solche Operation keinen Sinn hätte, wenn sie auf Spekulationen beschränkt bliebe; das Subjekt in Frage stellen bedeutet, eine Erfahrung zu machen, die zu seiner realen Zerstörung, seiner Auflösung, seinem Zerbersten, seiner Verkehrung in etwas anderes führen würde.“[34] dar.
„ So konnte uns der Hegelianismus, der uns an der Universität angeboten wurde, mit seinem Modell durchgängiger Intelligibilität der Geschichte nicht mehr genügen; und ebensowenig Phänomenologie und Exitenzialismus, die am Primat des Subjekts und seinem grundlegenden Wert festhielten...“[35]
Foucault spricht von Sartre und Nietzsche und trifft dann einige Aussagen über sein Verhältnis zum Marxismus und der KPF während seiner Zeit bei Althusser sowie über Althussers Theorieansätze.
„ ... Damals traf ich mich oft mit Louis Althusser, der in der KPF aktiv war. Übrigens bin ich ein wenig unter seinem Einfluß eingetreten...“[36]
„... Das Interesse an Nietzsche und Bataille bedeutete für uns keine Distanzierung vom Marxismus oder Kommunismus. Es war vielmehr der einzige Zugang zu dem, was wir vom Kommunismus erwarteten. Die Ablehnung der Welt, in der wir lebten, fand gewiß keine Erfüllung in der hegelianischen Philosophie. Wir waren auf der Suche nach anderen Möglichkeiten, uns zu jenem ganz anderen zu verhalten, das wir im Kommunismus verkörpert sahen.“
„ Das war der Grund, warum ich mich 1950 – ohne große Marx-Kenntnisse, aus Ablehnung des Hegelianismus und aus einem Gefühl des Unbehagens am Existentialismus – der französischen kommunistischen Partei (KPF) anschließen konnte. Ein „nietzscheanischer Kommunist“ sein, das war natürlich nicht praktikabel und wenn Sie so wollen, lächerlich. Ich wußte das wohl.“[37]
„ Die Arbeit Althussers bestand darin, die Analysen von Marx wiederaufzunehmen und sich zu fragen, ob in ihnen diese Konzeption der menschlichen Natur, des Subjektes, des entfremdeten Menschen zum Ausdruck kommt, auf der die theoretischen Positionen bestimmter Marxisten beruhten. Etwa die Roger Garaudys...“[38]
Foucault macht Erklärungen über den Strukturalismus, den Kommunismus, Nietzsche, Bataille und Blanchot und es wird immer wieder klar, was seine Strukturen sind und wie sehr er sie verinnerlicht hat, unbeirrt von Trombadoris Fragen macht er folgende Aussage zu seinem frühen Werk, welche klar machen worum es in der ersten Phase seines „Schaffens“ ging, anhand seines Buches “Die Geschichte des Wahnsinns“:
„ (...) Es ging darum zu verstehen, wie der Wahnsinn in der abendländischen Welt erst vom achtzehnten Jahrhundert an ein präziser Gegenstand der Analyse und der wissenschaftlichen Erforschungen werden konnte, während es vorher allenfalls medizinische Traktate gab, die in einigen kurzen Abschnitten die „Krankheit des Geistes“ behandeltten. Auf diesem Wege konnte man beweisen, dass im selben Augenblick, in dem das Objek Wahnsinn Gestalt annahm, sich zugleich das Subjekt herausbildete, das imstande war, den Wahnsinn zu erkennen. Der Konstruktion des Objekts Wahnsinn entsprach die eines vernünftigen Subjekts, das den Wahnsinn zu erkennen vermochte und das ihn verstand.“[39]
Er spricht über Grenzerfahrungen bezüglich des Wahnsinns seine Entwicklung und epistemologische Probleme seiner Arbeit und sagt dann folgendes zu Bachelard:
„ Ich war kein Schüler Bachelards, doch ich habe seine Bücher gelesen; in seinen Überlegungen zur Diskontinuität in der Geschichte der Wissenschaften und in dem Gedanken, daß die Vernunft, indem sie die Gegenstände ihrer Analyse selbst konstruiert, an sich selbst konstituiert, an sich selbst arbeitet, gibt es eine ganze Reihe von Elementen, von denen ich profitieren konnte und dich ich aufgenommen habe.“[40]
Er erzählt das ihn wissenschaftlich Georges Canquilem[41] ihn beeinflusste und wie er das ganze für sich selbst mit den Werken von Nietzsche verband.
Nach der Frage Trombadoris welche Beziehung „Grenzerfahrungen“ und „Wissen“ haben antwortet Foucault folgendes:
„ Ich verwende das Wort „Wissen“ in der Abgrenzung von „Erkenntnis“. Mit „Wissen“ ziele ich auf einen Prozeß der das Subjekt einer Veränderung unterwirft, gerade indem es erkennt oder vielmehr bei der Arbeit der Erkennens. Es ist dieser Prozeß, der es gestattet, das Subjekt zu verändern und gleichzeitig das Objekt zu konstruieren. Erkenntnis ist die Arbeit, die es erlaubt, die erkennbaren Objekte zu vermehren, ihre Erkennbarkeit zu entwickeln, ihre Rationalität zu verstehen, bei der jedoch das forschende Subjekt fast und unverändert bleibt.“[42]
Foucault erzählt über die Lehren Lacans und über seine Auslandaufenthalte vor allem während der Zeit des Algerienkrieges[43] und über sein Buch „ Wahnsinn und Gesellschaft“, das er nachdem er nach Frankreich zurückkehrte fertiggestellt hatte.
„ In gewisser Weise war das Buch ein Nachhall der unmittelbaren Erfahrung dessen, was ich in jenen Jahren erlebt hatte.“
Er meint damit den Unterschied zwischen den Systemen Schwedens und Polens sowie den Vergleich mit dem Frankreich der sechziger Jahre.
Er spricht über die Reaktionen der Gesellschaft, der Politik und Psychiater Philosophen auf sein Werk sowie die „Antipsychatriebewegung“ und kommt dann zu einem weiterem wichtigem Punkt seines Denkens, dem Strukturalismus.
Auf Seite 42 und 43 machte er bereits seine Ersten Aussagen über den Strukturalismus:
„ Es gibt einen gemeinsamen Punkt zwischen all denen, die in den letzten Jahren als „Strukturalisten“ bezeichnet worden sind und – mit Ausnahme von Lévi Strauss[44] - trotzdem keine waren, nämlich Althusser, Lacan und ich. Worin lag der eigentliche Konvergenzpunkt?“
„In einem gewissen Nachdruck, die Frage des Subjekts neu und anders zu stellen, sich von dem Grundpostulat zu befreien, das die französische Philosophie – seit Descartes[45] und verstärkt durch die Phänomenologie – nie aufgegeben hatte.“[46]
Und er fügt diesen jetzt folgende hinzu:
„Die Geschichte des Strukturalismus ist schwer zu entwirren, obgleich das sehr interessant wäre. Lassen wir einstweilen eine Sache polemischer Erregungen beiseite mit all den theatralischen und manchmal grotesken Zügen in ihren Formulierungen. Dazu würde ich ganz obenan die bekannteste Äußerung Sartres über mich stellen, in der ich als „das letzte ideologische Bollwerk der Bourgeoisie“[47] bezeichnet würde. Arme Bourgeoisie, wenn sie nur mich als Bollwerk hätte, so hätte sie die Macht längst verloren!“[48]
Foucault erzählt von den auswüchsen des Strukturalismus in Frankreich und hat dafür eine Erklärung:
„Aber ich glaube, daß hinter diesem Gerangel doch etwas Tieferes lag, über das man damals wenig nachgedacht hat. Nämlich, daß der eigentliche Strukturalismus offenkundig keine Entdeckung der Strukturalisten der sechziger Jahre war und schon gar keine französische Erfindung war. In Wirklichkeit geht er auf eine ganze Reihe von Forschungen in der Sowjetunion und in Mitteleuropa unternommen worden waren.“[49]
Er erklärt das dieser ursprüngliche Strukturalismus allerdings nie aktuell wurde in der Sowjetunion, da er „von der stalinistischen Dampfwalze überrollt“[50] wurde.
In Frankreich dann stilisierte sich der Strukturalismus nahezu zu einer „Glaubensfrage“:
„Mir scheint also, daß in der Aggressivität, mit beispielsweise bestimmten französische Marxisten sich den Strukturalisten der sechziger Jahre entgegenstellten, gleichsam ein historisches Wissen enthalten war, das wir nicht hatten: Der Strukturalismus war auf kulturellem Gebiet das große Opfer des Stalinismus gewesen, eine Möglichkeit, mit welcher der Marxismus nichts anzufangen gewußt hatte.“[51]
Er erzählt im folgenden wie sehr der Strukturalismus zu dieser Zeit verpönt war und macht eine bezeichnende Aussage über das Problem, indem er erzählt was er für Erfahrungen er im Ausland machte, wie sich dies auch auf seinen Freund Louis Althusser auswirkte und warum beide zur Zielscheibe derselben „antistrukturalistischen“ Polemik wurden und kommt damit im Gespräch endgültig auf seinen zweiten Schwerpunkt zu sprechen, der Erarbeitung einer Archäologie und Diskurstheorie.
Er erzählt über das entstehen von „Die Ordnung der Dinge“ und bezeichnet es als :
„(...) ein sehr technisches Buch, das sich vor allem an Techniker der Geschichte der Wissenschaft richtete (...)“ [52] und macht außerdem noch folgende Aussage dazu:
„Mir ging es in diesem Buch darum, drei wissenschaftliche Praktiken zu vergleichen, (...) die in keinem praktischem Verhältnis zueinander stehen – Naturgeschichte, Grammatik und politische Ökonomie -, (...)[53]
Das Foucault damit zumindest in Frankreichs Gesellschaft zu den Strukturalisten gezählt wurde wird auch anhand folgender Aussagen deutlich, mit denen er beschreibt, warum er das Thema Marxismus in seinem Buch nur in ca. 12 Seiten abhandelte und damit den sich gerade formierenden Neomarxisten einen Schock versetzte.
„ Für sie war Marx Gegenstand eines höchst wichtigen theoretischen Kampfes, der natürlich gegen die bürgerliche Ideologie, aber auch gegen die kommunistische Partei geführt wurde, an der man ihre theoretische Trägheit und ihr Unvermögen kritisierte, irgend etwas außer Dogmen zu vermitteln“[54]
Es folgt eine Foucaults damalige Einstellung bezeichnende Frage von Trombadori: Frage: „Trotzdem war diese Verweigerungshaltung unter den schon aufgezählten anscheinend die letzte, wenn man sie der Reihe nach betrachtet: das Thema Strukturalismus, die Widerstände einer bestimmten marxistischen Tradition, die Dezentrierung gegenüber der Philosophie des Subjekts...“
Antwort auf: “Und, wenn Sie so wollen, auch die Tatsache, daß man einen im Grunde nicht allzu ernst nehmen konnte, der sich einerseits mit dem Wahnsinn beschäftigte und andererseits eine Geschichte er Wissenschaften auf eine so bizarre und merkwürdige Weise rekonstruierte, gemessen an den Problemen, die man für wertvoll und wichtig hielt.“[55]
Mit der Zeit kommt das Gespräch so langsam auf Foucaults dritten Schwerpunkt, die Analyse der Machtbeziehungen, wie dazu kam beschreibt er mit folgendem Satz bezeichnend:
„ Nach Algerien wurde diese Art unbedingter Gefolgschaft brüchig “[56]
Und will damit sagen, daß Frankreich nach dem Algerienkrieg seine Staatsform überdenken mußte, sowie die Gesellschaft ihre kommunistische Gesinnung.
Er spricht von seinem „Übergangswerk“ „Archäologie des Wissens“ (1969):
„Nein ich habe die „Archäologie des Wissens“ vor 1968 geschrieben, auch wenn sie erst 1969 veröffentlicht wurde. Diese Arbeit war ein Echo auf die Diskussionen über den Strukturalismus, der – wie mir schien – in den Köpfen arge Verwirrung angerichtet hatte.“
Und er spricht darauf angesprochen über die Frankfurter Schule[57]:
„ Man müßte genauer in Erfahrung bringen, wie es geschehen konnte, daß die Frankfurter Schule in Frankreich so lange ignoriert werden konnte, obwohl mehrere ihrer Vertreter in Paris gearbeitet haben, nachdem der Nazismus sie von den deutschen Universitäten vertrieben hatte.“[58]
„Was mich betrifft, so glaube ich, daß die Philosophen dieser Schule Probleme gestellt haben, mit denen wir uns noch immer abmühen: insbesondere das der Machteffekte in Verbindung mit einer Rationalität, die sich historisch, geographisch, im Abendland vom sechzehnten Jahrhundert an, definiert hat.“[59]
„Wenn ich die Verdienste der Philosophen der Frankfurter Schule anerkenne, so tue ich es mit dem schlechten Gewissen von jemandem, der ihre Bücher früher hätte lesen, sie früher hätte verstehen sollen. Hätte ich ihre Bücher gelesen, so hätte ich eine Menge Dinge nicht sagen müssen, und mir wären Irrtümer erspart geblieben (...)“[60]
Er erklärt worin sich seine Ansätze zu denen der Frankfurter Schule unterscheiden und fällt nach einer nachfolgenden Frage folgende treffende Aussage über die Unvereinbarkeit seiner Aussagen über den „Tod des Menschen“ in „Die Ordnung der Dinge“ mit der Frankfurter Schule.
„ (...) Diese Serie von Subjekten wird niemals zu einem Ende kommen und uns niemals vor etwas stellen, das „Der Mensch“ wäre. Die Menschen treten ständig in einen Prozeß ein, der sie als Objekte konstituiert und sie dabei gleichzeitig verschiebt verformt, verwandelt – und der sie als Subjekt umgestaltet. Das war es, was ich sagen wollte, als ich undeutlich und vereinfachend vom Tod des Menschen sprach; aber ich gebe nichts Grundsätzliches auf. An dieser Stelle besteht eine Unvereinbarkeit mit der Frankfurter Schule.“[61]
Foucault äußert Unmut darüber, daß die Frankfurter Schule sich zu wenig mit der Geschichte befasste und macht einige Anmerkungen über sein Verfahren bei Analysen und frühere Fehler der Analysten. Er kommt, danach gefragt, zu einigen informativen Aussagen über den Pariser Mai 68 und dessen Verlauf sowie sein Befinden zu dieser Zeit, als er gerade noch in Tunesien war und erzählt von heftigen Revolten in Tunesien im März 1968:
„ Streiks, Vorlesungssperren, Festnahmen und einen Generalstreik der Studenten. Die Polizei drang in die Universität ein, knüppelte zahlreiche Studenten nieder, verletzte mehrere von ihnen und warf sie ins Gefängnis (...)“[62]
Und Foucault spricht davon eine direkte politische Erfahrung gemacht zu haben im Zusammenhang mit dem Pariser Mai 69. Er bezieht sich auf eigene Erfahrungen des Marxismus an der Universität und was derselbe zum Beispiel für die Polen bedeutete zur gleichen Zeit bedeutete und kommt zu folgender Aussage:
„ Sehen Sie, das bedeutete Tunesien für mich: ich mußte in die politische Debatte eintreten. Nicht im Mai 68 in Frankreich, sondern im März 68 in einem Land der dritten Welt.“[63]
„Als ich im November – Dezember 1968 nach Frankreich zurückkehrte war ich eher überrascht, erstaunt und sogar enttäuscht, gemessen an dem, was ich in Tunesien erlebt hatte. Wie gewaltsam, wie leidenschaftlich die Kämpfe auch geführt worden sein mögen, sie hatten doch niemals denselben Preis, kosteten niemals dieselben Opfer(...)“[64]
„Der Mai 68, hat ohne jeden Zweifel, ganz außerordentliche Bedeutung gehabt. Ohne den Mai 68 hätte ich gewiß niemals geschrieben, was ich über das Gefängnis, die Delinquenz, die Sexualität geschrieben habe. In dem Klima vor 1968 war das nicht möglich(...). Was wirklich im Spiel war und was die Dinge wirklich verändert hat, war in Frankreich und Tunesien im Grunde das gleiche. Nur endete die Sache in Frankreich damit, daß der Mai 68 sich gewissermaßen gegen sich selbst kehrte und verschüttet wurde unter der Bildung von Sekten und der Pulverisierung des Marxismusses in kleine Dogmen Gebäude, die einander in Grund und Boden verdammten(...)“[65]
Foucault meint damit, dass die Veränderungen nach dem Pariser Mai dazu geführt haben, dass es für ihn wieder erträglich wurde in Frankreich zu leben und seine Werke wurden nun auch aus anderer Warte gesehen.
„ Die Sachen mit denen ich mich beschäftigte, gewannen Gemeingut zu werden. Probleme, die in der Vergangenheit kein Echo gefunden hatte, allenfalls in der englischen Antipsychiatrie, gewannen Aktualität (...)“[66]
Foucault wird auf die Grundlagen, die Art der Diskurse und die Inhalte der Arbeit Intellektuellen und Nicht Intellektuellen angesprochen und die nicht vorhandene gemeinsame Sprache und spricht im weiteren Verlauf über seine berühmte Inauguralvorlesung am Collège de France und um sein vielleicht kann man sagen „Leitmotiv“ bei seinem Dritten Schwerpunkt, der Analyse von Machtbeziehungen.
„ (...) es gelang sich auf der Ebene konkreter Sorgen, realer Probleme verständlich zu machen (...)“
„Worum ging es mir während meines ganzen bisherigen Lebens? Was bedeutete dieses tiefe Unbehagen, das ich in der schwedischen Gesellschaft verspürte? Und das Unbehagen, das ich in Polen empfand?(...) Worum ging es dabei jedesmal? Um eine Art und Weise der Machtausübung, nicht nur der Staatsmacht, sondern auch derjenigen , die sich über andere Institutionen oder Formen des Zwangs durchsetzt, eine Art permanenter Unterdrückung im Alltagsleben. Was man kaum ertrug, was unablässig in Frage gestellt wurde, was jenes Unbehagen hervorrief und worüber man seit zwölf Jahren nicht gesprochen hatte, das war die Macht (...)[67]
Ich spreche nicht von einer Staatsregierung in dem Sinne, den der Ausdruck im öffentlichen Recht hat, sondern von jenen Menschen, die unser alltägliches Leben mit Hilfe von Befehlen, Anweisungen, direkten oder indirekten Einflüssen – etwa denen der Medien – lenken (...) Im Grunde habe ich nichts anderes geschrieben als eine Geschichte der Macht (...)“[68]
Und spricht dann über sein Buch „Der Wille zum Wissen“, in dem eine Reflexion der geführten Diskurse über Macht und Machtbeziehungen enthalten ist, Dialoge und Interviews mit Studenten, jungen linksradikalen Aktivisten und Intellektuellen.
„ Ich habe versucht, die verschiedenen Analysen, die ich zur Frage der Macht angestellt habe, zu koordinieren, zu systematisieren, ohne ihnen das zu rauben, was an ihnen noch empirisch, das heißt, was an ihnen gewissermaßen noch blind war.“[69]
Er spricht im weiterem Verlauf des Gespräches über seine mißverstandene Sprache und die ihm vorgeworfene „politiklosigkeit“ sowie den oft beklagten Mangel an Lösungen für die angesprochenen Probleme.
„ (...) In Wirklichkeit formuliere ich allgemeine Probleme, und man überhäuft mich mit Bannflüchen; und wenn man merkt, das Bannflüche nichts bewirken, oder wenn man vielmehr zugestehen muß, daß die aufgeworfenen Problemen eine gewisse Bedeutung haben, dann hält man mir vor, nicht imstande zu sein eine ganze Reihe von Fragen eben in allgemeinen Begriffen zu stellen (...) Ich bin es, der ihnen Fragen stellt: Warum verweigert ihr euch den Problemen, die ich aufwerfe?“[70]
„ Meine Rolle besteht darin, effektiv und möglichst rigoros Fragen zu stellen; Fragen die so komplex und so diffisil sind, daß eine Lösung nicht mit einem Schlag aus dem Kopf irgendeines reformerischen Intellektuellen oder aus dem Kopf des Politbüros einer Partei entspringen kann (...) Es ist eine gesellschaftliche Arbeit, der ich den Weg bahnen möchte, eine Arbeit innerhalb des Körpers der Gesellschaft und an der Gesellschaft. Ich möchte selbst an dieser Arbeit teilnehmen, ohne Verantwortung an irgendeinen Spezialisten zu delegieren, an mich sowenig wie an andere. So handeln, daß sich im Inneren der Gesellschaft selbst die Gegebenheiten des Problems verändern und die Sackgassen sich öffnen. Kurz, Schluß machen mit den Wortführern“[71]
Er erzählt darauf angesprochen über seine Sicht eines Falles der sich in Italien zugetragen hatte, wo ein Junge seinen Vater tötete weil er die Erniedrigungen von ihm nicht mehr ertragen konnte und benutzt dabei ein Beispiel persönlicher Erfahrung, einen Fall der sich ähnlich in Frankreich zugetragen hatte und mit dem er sich beschäftigt hatte.
„ (...) Ein junger Mann von dreißig Jahren hatte zuerst seine Frau getötet, dann ein zwölfjähriges Mädchen zum Analverkehr gezwungen und ihm dann mit Hammerschlägen den Rest gegeben. Nun hatte der Mörder mehr als fünfzehn Jahre in psychiatrischen Anstalten verbracht (ungefähr vom zehnten bis zum fünfundzwanzigsten Lebensjahr): die Gesellschaft, die Psychiater, die medizinischen Institutionen hatten ihn für unzurechnungsfähig erklärt, indem die ihn in Verwahrung nahmen und ihn sein Leben unter abscheulichen Bedingungen führen ließen.“
„Er kam heraus und beging zwei Jahre später jenes schreckliche Verbrechen. Also jemand, der, bis gestern für unzurechnungsfähig erklärt, nun mit einemmal verantwortlich sein soll. Aber das Erstaunlichste an dieser Affäre ist, daß der Mörder erklärte: „Es stimmt, ich bin verantwortlich; ihr habt aus mir ein Ungeheuer gemacht, und da ich ein Ungeheuer bin, schlagt mir folglich den Kopf ab.“
„ Er wurde zu „lebenslänglich“ verurteilt (...) ; einer der Anwälte des Mörders, der mit mir zusammengearbeitet hatte, bat mich, in der Presse zu intervenieren und zu diesem Fall Stellung zu nehmen. Ich habe abgelehnt, ich hätte mich nicht wohl dabei gefühlt.“[72]
Im Zuge seiner Antwort kommt er wieder darauf zu sprechen wie er sich seinen Einfluß auf die Gesellschaft vorstellt und die Wirkung die er verfolgt mit seinen Aussagen. Er beschreibt, das er durch die Darstellung der ganzen „Komplexität“ eine Veränderung ein Gefühl des Unbehagens erzeugen möchte.
„ (...) so daß sich heute kein Reformer, kein Präsident einer psychiatrischen Standesvereinigung mehr hinstellen und sagen kann „ Das und das ist zu tun“. Heute stellt sich das Problem unter Bedingungen wie sie noch über Jahre hinweg wirken und Unbehagen schaffen werden.“[73]
Im weiterem Verlauf des geht es wiederum um Mechanismen der Macht. Foucault spricht über seine Arbeitsweise und sein herangehen an das Problem der Macht und entgegnet Einwänden und erklärt die Übertragung von Machttechniken anhand eines Beispiels.
„ Die Konzentrationslager? Man sagt, sie seien eine englische Erfindung; aber das heißt nicht und legitimiert nicht die Behauptung, England sei ein totalitäres Land (...)
Aber es hat die Konzentrationslager erfunden, die eines der wichtigsten Instrumente der totalitären Regimes waren. Da haben sie ein Beispiel für eine Übertragung von Machttechniken(...)“[74]
Das Gespräch geht weiter und Foucault beantwortet Fragen zur „neuen Philosophen“ in Frankreich und seinem Verhältnis zu diesen:
„ (...) Man schreibt ihnen die These zu, es gäbe keinen Unterschied: die Herren blieben immer Herren, und wir säßen in der Falle, was auch immer geschehe. Ich weiß nicht, ob das wirklich ihre These ist.
Jedenfalls ist es absolut nicht meine. Ich versuche, möglichst präzise und differenzierte Analysen vorzunehmen, um zu zeigen, wie sich die Dinge verändern, transformieren, verschieben (...) Ich unternehme meine Analysen nicht um zu sagen: seht, die Dinge sind so und so, ihr sitzt in der Falle. Sondern weil ich meine, daß das, was ich sage, geeignet ist, die Dinge zu ändern (...)[75]
Fast am Ende des Gespräches spricht Trombadori Foucault auf den Inhalt seines Briefes vom 01. Dezember 78 an L´Unità an und zitiert aus diesem ein paar Sätze.
Foucault wollte darin seine Bereitschaft zu einer Begegnung und einer Diskussion mit italienischen kommunistischen Intellektuellen zeigen.
„ Es handelt sich um Themenvorschläge als Grundlage einer möglichen Diskussion (...)“[76]
Weiterhin erklärt er den damit von ihm verfolgtem Zweck dieses Anstoßes.
Trombadori stellt eine Frage zu „Polemik“ und Diskussionen die Foucault nicht hinnehmen will, „ die den Krieg imitieren und die Justiz parodieren“[77] und Foucault erklärt sich wie folgt.
„ Das Modell des Krieges sitzt wie ein Parasit auf den Diskussionen über politische Themen: Wer abweichende Ideen hat, wird als Klassenfeind identifiziert, gegen den man kämpfen muß bis zum Sieg. Dieses große Thema des ideologischen Kampfes bringt mich zum Lächeln, wenn ich bedenke, daß die theoretischen Bindungen eines jeden, in ihrer Geschichte betrachtet, eher konfus und schwankend sind und nicht die Klarheit einer Grenze haben (...) Ist es nicht so, daß sich die Intellektuellen vom ideologischen Kampf ein politisches Gewicht erhoffen, das ihre reale Bedeutung übersteigt? (...)
„Wer lange genug proklamiert: „ Ich kämpfe gegen einen Feind“, wird der diesen Feind dann nicht auch als solchen behandeln, wenn es – was jederzeit geschehen kann – tatsächlich zu einer kriegerischen Situation kommt? Diese Bahn führt geradewegs in die Unterdrückung, sie ist gefährlich“[78]
Und das Gespräch endet mit folgendem letzten Sätzen zu diesem Thema, die auch im 3. Jahrtausend als wichtiger denn je erscheinen.
„ Ich versteh durchaus, daß ein Intellektueller den Wunsch hegen kann, von einer Partei oder in einer Gesellschaft ernst genommen zu werden, indem er gegen einen ideologischen Gegner Krieg spielt. Aber das scheint mir gefährlich. Man sollte lieber annehmen, daß diejenigen, mit denen man uneinig ist, sich getäuscht haben oder daß man selbst nicht verstanden hat worauf sie hinauswollten.“[79]
3. Zusammenfassung und Reflexion
Beim Betrachten von Foucaults Leben, seiner Sozialisation und seinen Gedanken, sowie seinen bezeichnenden Aussagen im Interview bekommt man viel von seinem „humanistischen“ Leitmotiven mit, Foucault als Homosexueller in einer Zeit in Frankreich nach 45 hat sehr viel an intellektuellen und gesellschaftlichen Veränderungen mitbekommen “Erfahrungen“ die sein Denken prägten. Federführend für ihn sind primär seine eigenen Erfahrungen.
Es geht los mit seiner Arbeit in der Psychiatrie, führte bis zur Hilfe für ehemalige Strafgefangene und letztendlich zu Machtkritik und Sexualität.
Immer recherchiert er „archäologisch“, meint hier die Analyse der Diskurse auf die Regeln und Prinzipien hin, die bestimmen wie überhaupt gesprochen werden kann.
Im engeren Sinne legt die Archäologie die 'Wahrheitsspiele' frei, das heißt, die Bedingungen, die Aussagen jeweils erfüllen müssen, um als wahr akzeptiert zu werden. Diese Regeln und Prinzipien des Sprechens und Denkens nennt Foucault 'Episteme'
Seine Zeilen, waren für die Zeit in der sie erschienen „revolutionär“ im Hinblick auf das humanistische Denken in Frankreich und ganz Europa, sie wirbelten das jeweilig von ihm anvisierte Thema und deren Verfechter auf eine menschliche Weise durcheinander, alles was er sagt regt zum denken an. Man befindet sich auf seiner Seite wenn er dazu aufruft mit Geisteskranken in einer Klinik anders umzugehen, weil der „Begriff“ der Verrücktheit sich in dem Moment wandelt, wo man seine eigene Perspektive verschiebt, sein eigenes festgelegtes schematisch, aber auch manchmal dogmatisches Denken immerwieder überprüft auf seine Richtigkeit.
Foucault ist weder Humanist, noch Philosoph, er ist kein „Geschichtler“ oder gar Archäologe und schon gar kein Politiker. Man könnte ihn vielleicht als wissenschaftlichen Philosoph bezeichnen mit geschichtlicher Sichtweise.
Dennoch gibt es auch eine ganze Reihe von Kritik unter anderem wirft Nancy Fraser ihm vor:
„Was Foucault offensichtlich fehlt, sind normative Kriterien zur Unterscheidung der annehmbaren von den unannehmbaren Formen der Macht.“
Es erscheint aber andererseits auch manchmal schwer ihm in der heutigen Zeit zu folgen, sich von „Sich als Subjekt“ zu lösen, und Emphatie mit Mitmenschen oder anderen Globalen Problemen zu üben.
Man hat oftmals gar keine Zeit, oder selbst genug Probleme um sich um solche „verrückt“ erscheinenden Diskussionen zu kümmern oder darüber nachzudenken.
Die Welt ist einerseits „kleiner“ geworden durch die zunehmende Globalisierung aber auch immer komplexer und undurchsichtiger, auch und vielleicht vor allem in sozialen Berufen.
Daher könnte das was Foucault im Interview sagt in Zukunft sehr aktuell sein. Vor allem seine Aussagen über Macht und Systeme erscheinen im aktuellen Kontext als modern, wo über Soziale Marktwirtschaft, Menschenrechte und Humanismus wieder mehr Diskussionsbedarf besteht, vor allem im Zusammenhang mit Hartz IV, dem Irak- Krieg oder den Gefangenlagern der Amerikaner in Kuba.
Wenn man Foucaults Worte „runterbricht“ auf eine banale Aussage, so würde man vielleicht zu folgendem Satz kommen:
„Alles ist relativ!“
Das kennt man ja und im „Einsteinjahr“ scheinen die Ausführungen dieses bedeutenden Wissenschaftlers, die bei ihm nur wissenschaftlich gemeint waren, auch andere Bedeutung zu haben. So sieht man doch an dem Beispiel der verschiedenen Eindrücke und „räumlichen“ Betrachtungsweisen der Geschwindigkeit eines Zuges, der an einem vorbeifährt die selben Schlüsse;
Der „Begriff“ von dem Foucault spricht, den man sich von Dingen oder Sachverhalten macht, ist wandelbar und verändert sich durch die Sichtweise.
Ob nun die Geschwindigkeit beim Zug oder die Verrücktheit eines geistig Kranken, der „Begriff“ schürt sich aus einer eigenen Erfahrung.
„Der Mensch ist ein Erfahrungstier“, und persönliche Fähigkeiten wie sozial- wissenschaftliches und Wirtschaftliches Denken, Empathie und Dezentrierung und eine gewisse „Menschlichkeit“ sind das Werkzeug um sich immerwieder neu zu orientieren. Wiederum etwas das auch in der sozialen Arbeit gefragt ist und vermehrt gefragt sein wird.
„Cogito ergo sum“, ich denke also bin ich, oder nach Leonardo da Vinci:
„Meine Arbeiten sind das Ergebnis reiner Beobachtung, welche die einzige wahre Geliebte ist.“[80]
Foucault mit anderen Philosophen oder Humanisten zu vergleichen ist wie bereits erwähnt sehr schwierig, andererseits aber auch leicht, da man vieles von anderen Dichtern und Denkern wiedererkennt.
Foucault vereint halt nicht nur ein oder zwei verschiedene Eigenschaften sondern er war Psychologe, Historiker, Weltenbummler, Politiker und vor allem Mensch der denken kann.
Das er sich nie festlegen lassen wollte fundamentalisiert sich auch in folgenden Worten, die sein Buch „ Die Archäologie des Wissens“ eröffnen, sowie ein Gespräch mit der Tageszeitung „Le Monde“ eröffnen, das schließlich unter „ Der maskierte Philosoph“ erschien ohne den Namen Foucaults.
„ Man frage mich nicht wer ich bin und man sage mir nicht, ich solle der gleiche bleiben: das ist eine Moral des Personenstandes; sie beherrscht unsere Papiere.“[81]
7. EXKURS Frankreich von 1870 bis 1981
Die 3. Republik 1870 - 1940
Nach der Niederlage im Französisch-Preußischen Krieg und der Gefangenschaft Napoleons III., wurde am 4. September 1870 in Paris die 3. Republik ausgerufen und somit das 2. Kaiserreich beendet. Die Republikaner Gambetta und Favre bildeten eine provisorische «Regierung der Nationalen Verteidigung» und setzten den Krieg erfolglos fort. Auf Grund der militärischen Unterlegenheit war die Regierung jedoch gezwungen, am 28. Januar 1871 einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Die provisorische Regierung war aber nicht befugt die Nation zu repräsentieren und es wurden Neuwahlen zur Nationalversammlung ausgerufen. Das neue Parlament wählte den erfahrenen Adolphe Thiers zum Präsidenten, der am 26. Februar 1871 den Präliminarfrieden mit Bismarck unterzeichnete. Am 1. März 1871 ratifizierte die Nationalversammlung diesen Vertrag, nach welchem Deutschland außer 5 Milliarden Francs Entschädigung noch das Elsass und Lothringen bekam.
Dass die unpopuläre monarchistisch geprägte Nationalversammlung einen Vertrag mit derart ungünstigen Bedingungen akzeptierte, löste in Paris einen Aufstand (Oktober 1870 – Mai 1871) aus, der als Pariser Kommune bekannt ist. Nach zweimonatiger Belagerung und achttägigen Barrikadenkämpfen im Mai 1871 wurde die Pariser Kommune schließlich blutig niedergeschlagen.
Der darauffolgende Frieden brachte jedoch keine Erleichterung: das Fallen der Agrarpreise führte zur Beschleunigung der Landflucht und zur Verstärkung der allgemeinen Wirtschaftskrise. Die politische Situation blieb ebenfalls nicht stabil. Monarchistische Abgeordnete stürzten am 24. Mai 1873 Thiers durch ein Misstrauensvotum, um den Enkel Karls X., den Grafen von Chambord, als Thronanwärter durchzusetzen. Die Bedingungen des Grafen von Chambord (Abschaffung der Trikolore als Nationalflagge, Einführung der absoluten Monarchie) konnten jedoch nicht akzeptiert werden und mit knapper Mehrheit wurde Mac-Mahon zum neuen Präsidenten ernannt. Er fand aber keine Mehrheit in der Nationalversammlung und trat vorzeitig am 30. Januar 1879 zurück.
Der Republikaner Jules Grévy wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Ihm folgte Sadi Carnot (1887-1894). Zu dieser Zeit verbreitete sich eine nationalistische Bewegung um den Kriegsminister Georges Boulanger, der den mangelnden sozialen Fortschritt und die Instabilität der Regierungen als Anlass nahm, einen Staatsstreich vorzubereiten. Er versammelte seine Anhänger (Boulangisten) mit dem Ziel, die Präsidentschaft abzuschaffen, die Kammer aufzulösen und die Verfassung zu erneuern. Er schreckte jedoch im entscheidenden Moment vor der Anwendung von Gewalt zurück und die Regierung konnte den Staatsstreich verhindern. Boulanger trat zurück und flüchtete nach Belgien. Nach der Ermordung Carnots bei einem Attentat in Lyon wurde Jean Casimir-Perier (1894-1895) und darauf Félix Faure (1895-1899) zum Präsidenten gewählt. Seit 1898 wurde Frankreich durch die Dreyfus-Affäre erschüttert, die das Land in zwei Lager spaltete. Die nationalistischen und antisemitischen Kreise beharrten auf der Schuld des jüdischen Offiziers Alfred Dreyfus, während die Intellektuellen für seine Rehabilitation eintraten. Aus diesen Debatten entstanden einerseits die Parti Sozialiste, die Parti Radical und der Gewerkschaftsbund CGT, andererseits die Action française unter Charles Maurras.
Unter den nächsten beiden Präsidenten Emile Loubet (1899-1906) und Armand Fallières (1906-1913) verschärften sich die Spannungen zwischen Bourgeoisie und Arbeitern, die den Streik als wirksames Mittel im Klassenkampf entdeckt haben. Ebenfalls konfliktbeladen waren die Beziehungen zwischen Staat und katholischer Kirche. Eine Reihe von Gesetzen verankerte den Laizismus und einen konsequenten Ausschluß der Kirche aus dem öffentlichen Schulsystem.
Die außenpolitische Situation war ebenfalls nicht einfach, da sich Frankreich für längere Zeit in einer Art Isolation befand. Dem 1913 gewählten Präsidenten Raymond Poincaré (1913-1920) gelang es Frankreichs Position durch die Bildung der Triple Entente mit Großbritannien und Russland, als Gegenpol zum Dreierbund zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien, zu stärken. Dadurch wurde in der Folge Frankreich in den 1. Weltkrieg hineingezogen.
Erster Weltkrieg (1914 – 1918)
Nach der außenpolitischen Isolation in den ersten Jahren der 3. Republik versuchte Frankreich, unter dem Präsidenten Raymond Poincaré (1913-1920), seine Position durch die Bildung einer Triple Entente mit Großbritannien und Russland, als Gegenpol zum Dreierbund zwischen Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien, zu verstärken.
Als der österreichisch-ungarische Thronfolger am 28. Juni 1914 in Sarajewo erschossen wurde, trat Frankreich an der Seite seiner Verbündeten, denen sich später Italien und die Vereinigten Staaten anschlossen, in den Krieg gegen Deutschland und Österreich-Ungarn ein.
Nach Beginn des 1. Weltkrieges bildtete Poincaré die Union Sacrée, ein Bündnis zwischen den bürgerlich-konservativen Parteien und den Sozialisten, mit dem Ziel die politische Einheit der Republik zu gewähren. Die Regierung bekam für die Kriegsführung außergewöhnliche Vollmachten. Poincaré erklärte als Kriegsziele die Rückgabe des im Französisch-Preußischen Krieg 1870 verlorenen Elsass-Lothringens sowie die Annexion des Rheinlands und der Saar, was auf allgemeine Zustimmung der Bevölkerung stieß.
Der Kriegsbeginn verlief ungünstig für Frankreich, da das weit entfernte Russland viel Zeit für die Mobilisierung benötigte und Deutschland sich dazu entschloss, mit aller Kraft zunächst gegen den westlichen Nachbarn Frankreich vorzugehen. Nach den ersten Niederlagen in den Ardennen gelang es den französischen Truppen jedoch in der Schlacht an der Marne, den Vormarsch der deutschen Truppen zu stoppen. Inzwischen war die russische Armee in die aktive Phase des Krieges eingetreten und Deutschland zog einen Teil der Truppen nach Osten ab. Zu Beginn des Jahres 1916 wagten die Deutschen eine Offensive. Sie wählten das Gebiet um Verdun für einen gezielten Angriff, den Frankreich mit sehr hohen Verlusten abwehren konnte. Seit 1917 übernahm General Philippe Pétain das Kommando der schlecht organisierten Nordarmee und stabilisierte die Situation in kürzester Zeit.
Die Februarrevolution in Russland und Streitigkeiten innerhalb der Regierung bewogen die Sozialisten aus der Regierung auszuscheiden. Georges Clemenceau, der starke Mann im bürgerlichen Lager, übernahm die Regierung am 16. November 1917 mit weitgehenden Vollmachten, sowohl im zivilen, als auch im militärischen Bereich.
An der Front begann am 18. Juli 1918 eine entscheidende Offensive der Alliierten unter dem Oberbefehl von General Foch, die am 11. November zur Kapitulation Deutschlands führte. Der Tag des Waffenstillstandes ist heute ein Feiertag in Frankreich.
Der 1. Weltkrieg dauerte somit über vier Jahre (3. August 1914 - 11. November 1918). Frankreich verlor in diesem Krieg 1325000 Menschen. Die materiellen Verluste waren ebenfalls sehr bedeutend und betrugen schätzungsweise ein Viertel des Staatsvermögens.
Die folgende Periode bis zum Ausbruch des 2. Weltkrieges (sogenannte Zwischenkriegszeit) war eine Zeit des wirtschaftlichen Aufbaus und durch ein turbulentes politisches Leben geprägt.
Zwischenkriegszeit
Nach dem Sieg der Alliierten im 1. Weltkrieg versuchte Frankreich durch Schwächung von Österreich und Deutschland seine Stellung in Europa zu festigen. Der Vertag von Versailles vom 28. Juni 1919, der die Friedensbedingungen festlegte, sicherte Frankreich die Rückgabe des nach dem Französisch-Preußischen Krieg 1870 verlorenen Elsass-Lothringen und hohe Reparationszahlungen. Außerdem forderte die französische Regierung unter der Präsidentschaft von Poincaré die Besetzung des Rheinlandes, die Annexion des Saargebietes, eine Beschränkung der deutschen Berufsarmee auf max. 100000 Soldaten... Diese Politik stieß auf den Widerstand der Linken in Frankreich, die auch durch die allgemeine Weltwirtschaftskrise, Kriegslasten und die Oktoberrevolution in Russland Zulauf bekamen. Die bürgerlichen Rechten vereinten ihre Kräfte im „Nationalen Block“ unter den Präsidenten Paul Deschanel (Februar 1920 - September 1920) und Alexandre Millerand (1920-1924) und gewannen die Wahlen zur Nationalversammlung, nicht zuletzt durch eine antikommunistische Wahlpropaganda, die die Angst vor einer bolschewistischen Revolution schürte. Ein Teil der Sozialistischen Partei, enttäuscht von den Wahlergebnissen und der bürgerlichen Regierungspolitik, spaltete sich auf dem Parteitag von Tours ab und gründete die Kommunistische Partei Frankreichs, die sich der Kommunistischen Internationale anschloss und nach bolschewistischen Prinzipien arbeitete.
Das bürgerliche Lager des „Nationalen Blocks“ war ebenfalls nicht homogen. Die Parti Radical, die bisher im „Nationalen Block“ mitwirkte, zeigte ihre Unzufriedenheit mit der Politik des Kabinetts von Briand (1921 – 1922) und Poincaré (1922 – 1924) und wechselte vor den Wahlen 1924 das Lager. Die Radikalsozialisten bildeten mit den Sozialisten ein „Linkskartell“ und gewannen knapp die Parlamentswahlen. Der radikale Politiker Gaston Doumergue (1924-1931) wurde zum Präsidenten gewählt. Er ernannte Edouard Herriot zum Premierminister, dessen Regierung von den Sozialisten parlamentarisch unterstützt wurde, obwohl sie nicht in seine Regierung eintreten wollten. Die große Unzufriedenheit der Katholischen Kirche und der Widerstand der Geschäftswelt blockierten Herriots Regierung und in der Folge noch sechs weitere Kabinette. Erst als der Präsident im Jahre 1926 Poincaré zum Premierminister ernannte, kam es zu einer relativen Stabilität in der Wirtschafts- und Finanzlage, verbunden mit einer Annäherung an Deutschland. Die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre traf Frankreich später als die USA, England und Deutschland, dafür aber umso heftiger. Die Wirtschaftskrise war von innenpolitischer Instabilität und ständigen Regierungswechseln begleitet.
Unter den Präsidenten Paul Doumer (1931-1932) und Albert Lebrun (1932-1940) gab es 19 verschiedene Regierungen, die in der zweiten Hälfte der 30er Jahre auch von Sozialisten gebildet wurden. Nach den Parlamentswahlen 1936 erlangte die sogenannte Volksfront aus Sozialisten, Radikalsozialisten und Kommunisten einen beachtlichen Sieg. Die Volksfrontregierung unter dem Sozialisten Léon Blum führte wichtige Sozialreformen durch, wie z.B. den bezahlten Urlaub für Arbeiter, die 40 Stunden Woche, die Schulpflicht bis 14 Jahre u.a. Nach Auseinandersetzungen mit dem Senat trat Blum 1937 zurück und überlies dem Radikalsozialisten Édouard Daladier die Regierung. Er verstärkte entscheidend die Exekutive, der weitgehende gesetzgebende Befugnisse eingeräumt wurden. So erklärte Daladier am 3. September 1939 nach dem Scheitern seiner Beschwichtigungspolitik Deutschland ohne Zustimmung des Parlaments den Krieg und führte Frankreich an der Seite Großbritanniens in den Zweiten Weltkrieg.
Der Zweite Weltkrieg
Am 3. September 1939 begann für Frankreich mit der Kriegserklärung von Premierminister Édouard Daladier der 2. Weltkrieg. Die Franzosen vertrauten auf die Wirksamkeit der Maginot-Linie als Verteidigungssystem und unternahmen keine aktiven militärischen Aktionen. Daladier geriet in Bedrängnis und wurde durch Reynaud in seinem Amt ersetzt. Im Mai 1940 marschierte die deutsche Armee in Frankreich ein und eroberte blitzschnell Gebiete an der Mosel, Aisne und der Somme. Der rasche Vormarsch der deutschen Truppen hinderte die Franzosen am Aufbau einer wirksamen Verteidigung. Am 14. Juni, kurz nach dem Beginn der militärischen Handlungen, wurde die französische Hauptstadt von der deutschen Armee besetzt und alle Regierungseinrichtungen zogen sich zunächst nach Bordeaux und später nach Vichy zurück. Premierminister Reynaud übertrug Marschall Pétain, Held des 1. Weltkrieges, die Verantwortung. Anstatt mit dem Feind zu kämpfen, handelte Pétain eine Kapitulation aus, die am 22. Juni unterschrieben wurde und Frankreich in zwei Zonen teilte. Nordfrankreich wurde der Besatzungsverwaltung unterstellt und Südfrankreich blieb zunächst unbesetzt. Am 10. Juli desselben Jahres löste sich die Dritte Republik auf und das Parlament übertrug die Vollmacht an Pétain (1940-1944). Er setzte sofort eine neue Regierung ein mit Sitz in Vichy und praktizierte eine Politik der Kollaboration mit Hitler.
Gleichzeitig rief General de Gaulle von London aus die Franzosen über das Radio dazu auf, Widerstand gegen die Besatzer zu leisten. Obwohl fast niemand seinen Aufruf hörte, wurde der Text schriftlich verteilt und bekam eine breite Zustimmung. Nach und nach bildeten sich einzelne Gruppen von Partisanen, die einerseits Aufklärung und Sabotage betrieben, andererseits viele Franzosen vor der Zwangsarbeit in Deutschland retteten, als die sogenannte „Service du Travail Obligatoire“ in Frankreich eingeführt wurde.
Im Mai 1943 vereinten sich unterschiedliche Résistance-Gruppen mit Hilfe von Widerstandsgruppen im Exil und durch aktive organisatorische Arbeit von Jean Moulin in Frankreich in einem Nationalen Widerstandsrat – Conseil National de Résistance, der die Arbeit der einzelnen Gruppen koordinierte und aktiv die Befreiung Frankreichs vorbereitete. Dies beinhaltete u.a. die Vorbereitung der Verwaltungsstrukturen, die gleich nach der Befreiung zum Tragen kommen sollten. Eine große Rolle in der Résistance spielten die engagierten Intellektuellen, die im Untergrund Artikel, Essays und sogar ganze Romane veröffentlichten, wie z.B. Albert Camus und Vercors.
Die Résistance-Gruppen unterstützten aktiv die französischen Truppen, die zusammen mit den Alliierten im Juni 1944 in der Normandie landeten. Pétain wurde von den Deutschen nach Sigmaringen gebracht, wo die aus Frankreich geflohenen Kollaborateure eine Exilregierung unter Fernand de Brinon bildeten, die jedoch keine politische Rolle mehr spielte. Zwei Monate später, am 25. August, wurde Paris befreit. Die beiden wichtigsten Funktionäre des Vichy-Regimes Marschall Pétain und Pierre Laval wurden zum Tode verurteilt. Auf Grund der von der Résistance gesammelten Informationen erfolgte in ganz Frankreich eine politische Säuberung, bei der sowohl aktive Kollaborateure, als auch Mitläufer vor Gericht gestellt wurden. Viele wichtige Unternehmen (besonders aus den Bereichen Energieversorgung, Transport und Finanzen), deren Führung an der Kollaboration beteiligt war, wurden verstaatlicht. Alle Zeitungen, die unter dem Vichy-Regime erschienen, wurden verboten. Andererseits wurde als Zeichen der Demokratisierung der Politik am 5. Oktober 1944 das Wahlrecht für Frauen eingeführt und somit herrschte zum ersten Mal in der französischen Geschichte ein allgemeines Wahlrecht.
Gleich nach der Befreiung Zentralfrankreichs bildete General de Gaulle eine Provisorische Regierung (26.08.44 – 21.10.45), die den Übergang zur 4. Republik vorbereiten sollte. Den Verfassungsentwurf lehnte er jedoch ab und zog ,sich zunächst aus dem politischen Leben zurück.
3. Die Vierte Republik 1946 – 1958
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte General de Gaulle sein Projekt der Staatsreform nicht durchsetzten und am 20. Januar 1946 trat er als Regierungschef zurück. Durch eine Volksabstimmung am 13. Oktober 1946 wurde die Verfassung der 4. Republik angenommen, die eine starke Legislative vorsah. Das Parlament wählte zum Beispiel den Präsidenten, der Premierminister brauchte die Zustimmung der Nationalversammlung bei vielen wichtigen Fragen – Ernennung der Minister, Verabschiedung des Regierungsprogramms usw.
Die Wahlen am 10. November 1946 zur ersten Nationalversammlung der 4. Republik ergaben einen deutlichen Sieg der Parteien, die sich an der Résistance aktiv beteiligt hatten – Kommunisten (PCF), Gaullisten (MRP) und Sozialisten (SFIO), die eine gemeinsame Regierung unter der Präsidentschaft des Sozialisten Vincent Auriol (1947-1954) bildeten. Auf Grund großer Unterschiede zwischen den drei beteiligten Parteien war eine konsequente Regierungspolitik aber nur schwer möglich. Die Differenzen zeigten sich deutlich in Fragen der Außenpolitik. Die Moskautreuen Kommunisten konnten nicht zulassen, dass Frankreich im Kalten Krieg Partei für die USA einnahm und gingen in Opposition. Dies erlaubte Frankreich die europäische Politik voranzutreiben. Frankreich trat der OECD und der NATO bei und suchte eine Annäherung an Deutschland, die die Grundlage für eine europäische Verständigung schuf.
Die Unabhängigkeitsbewegung der französischen Kolonien wurde zum ständigen Begleiter der 4. Republik. Im November 1946 brach der Indochinakrieg aus, der mehrere Jahre die französische Politik prägte. Trotz gewaltiger Investitionen und militärischer Hilfe der USA unterlag Frankreich. Am 7. Mai 1954 unterschrieb der neu gewählte Präsident René Coty (1954-1959) ein Friedensabkommen und Frankreich zog sich aus diesen Gebieten zurück. Zwei Jahre später erlangten Marokko und Tunesien ihre Unabhängigkeit. Der Algerienkonflikt, der im Jahre 1954 in einen Krieg mündete spaltete die französische Politik und lähmte das Land. Um diesen Konflikt zu lösen, wurde General de Gaulle am 29. Mai 1958 von Coty als Premierminister eingesetzt. De Gaulle verlangte Sondervollmachten und grundlegende Verfassungsänderungen. Die neue Verfassung wurde am 4. Oktober 1958 verabschiedet und markierte den Anfang der 5. Republik.
1955: Der relativ beliebte und erfolgreiche Mendès-France wird gestürzt, als er sich vom Parlament Vollmachten geben zu lassen versucht zur Bremsung der erneut ins Galoppieren geratenen Inflation. Im Land wächst wieder mal die Unzufriedenheit. Besonders gebeutelt von der zunehmenden Steuerlast und von den Konzentrationsprozessen in der Wirtschaft fühlt sich das Kleinbürgertum. Es wird zum Mitglieder- und Wählerreservoir der Union pour la défense des commerçants et des artisans des rechten Protestlers Pierre Poujade, der lautstark gegen ziemlich alles ist, was die Regierenden sagen und tun, und der sich zugleich in agressivem Rassismus und chauvinistischem Hurrah-Patriotismus gefällt.
1956: Bei den élections législatives im Januar bekommen die Poujadistes aus dem Stand beachtliche 11,5 %; einer ihrer Abgeordneten in der Assemblée Nationale ist der junge Jean-Marie Le Pen. Die Regierung wird jedoch von einer Koalition aus Sozialisten und radicaux unter Sozialistenchef Guy Mollet gebildet, der von den Kommunisten mitgewählt und danach toleriert wird. Mollet gewährt als erstes den unbeherrschbar gewordenen Protektoraten Tunesien und Marokko Unabhängigkeit (und wird dafür von rechts als "bradeur d'Empire", "Reichsverschleuderer", geschmäht). Da er im Wahlkampf einen sofortigen Frieden in Algerien versprochen hatte, reist er bald nach Amtsantritt zur Information nach Algier. Hier erlebt er eine ihn tief beeindruckende profranzösische Massendemonstration und kehrt als Falke nach Paris zurück. Er lässt sich sofort Sondervollmachten für eine schärfere Repression der Befreiungsbewegung durch die Polizei und vor allem auch die Armee geben. Der so verstärkte Druck verstärkt den Gegendruck, die "événements" in Algerien nehmen nunmehr wirklich Kriegsform an und halten die französische Öffentlichkeit in Atem, zumal die algerische Befreiungsfront mehr und mehr auch in Frankreich selbst mit Attentaten und Terroranschlägen operiert. Ende Oktober überfallen englische und französische Truppen Ägypten, das kurz zuvor den Suez-Kanal verstaatlicht hatte und das in Frankreich als Drahtzieher der algerischen Rebellen gilt. Russische Atombomben-Drohungen gegen England und Frankreich und amerikanischer Druck auf das englische Pfund zwingen zuerst die englische und dann auch die französische Regierung zum Rückzug, was in Frankreich Groll gegen England und Trotz gegenüber dem gesamten Ausland auslöst. Die französische Armee stürzt sich nun ganz auf Algerien, wo die "bataille d'Alger" entfesselt wird, die im Verständnis der rechten und der regierungsoffiziellen Propaganda das Abendland vor Islam und Kommunismus zugleich retten soll.
1957: Während Frankreich einerseits im März die Römischen Verträge unterzeichnet, die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft begründen, macht andererseits in Algerien die Armee hemmungslos und grausam Jagd auf die Mitglieder der Befreiungsfront und ihre tatsächlichen und vermeintlichen Sympathisanten (und empört damit auch die letzten noch frankophilen Algerier). Parallel dazu entwickelt sich in Frankreich selbst ein ungutes Klima, das von irrationalen Ängsten, agressivem Nationalismus, Rassismus, Antiparlamentarismus und einem Verteufeln aller Kritiker und Oppositioneller als Defaitisten bestimmt wird.
Ein erschrockener englischer Journalist diagnostiziert den Ausbruch des "National-Molletisme", das Umsichgreifen eines kollektiven rechtsextremistischen Wahns, dem Franzosen aller politischen Couleur verfallen seien (und den Ionesco in der Novelle Rhinocéros und Boris Vian in seinem Stück Les Bâtisseurs d'Empire thematisieren). Es galoppiert zugleich die Inflation aufgrund der wachsenden Militärausgaben in Algerien.
Die 5. Republik
Die Entstehung der 5. Republik ist eng mit dem Namen des Generals de Gaulle (1958 – 1969) verbunden. Er nutzte die Algerienkrise[82] um im Jahre 1958 wieder an die Macht zu kommen und eine neue Verfassung durch ein Referendum durchzusetzen. Diese Verfassung vom 4. Oktober 1958 stärkte die Exekutive und besonders das Amt des Präsidenten. Nach der Verabschiedung der neuen Verfassung sanierte die Regierung die Staatsfinanzen mit der Abwertung des Francs. Der neue Franc hatte den Wert von 100 alten Francs. Obwohl dies besonders die ärmeren Schichten im Land hart traf, war es dennoch ein auf Grund der hohen Inflation notwendiger Schritt. Nach anfänglichem Zögern erkannte de Gaulle, dass Algerien als französische Kolonie keine Zukunft hatte und trat für die Unabhängigkeit Algeriens ein. Nach einem Referendum im Jahre 1962 wurde Algerien unabhängig. Außenpolitisch verfolgte de Gaulle das Ziel eines starken und politisch unabhängigen Frankreichs und setzte auf nukleare Abschreckung.
Im Bezug auf Deutschland unternahm er zusammen mit Konrad Adenauer wichtige Schritte in Richtung der Intensivierung der bilateralen Beziehungen, die am 22. Januar 1963 im Elysée-Vertrag festgeschrieben wurden.
Im Dezember 1965 wurde de Gaulle für weitere 7 Jahre als Präsident gewählt. Seine Amtszeit konnte er jedoch nicht in vollem Umfang ausüben. Die Unruhen im Mai 1968 zeigten eine breite Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der wirtschaftlichen Lage und der politischen Stagnation des Staatsapparates. Auch seine Reformvorschläge fanden keine Unterstützung mehr und als sein Gesetzentwurf für die Regional- und Parlamentsreform am 27. April 1969 durch ein Referendum abgelehnt wurde, trat de Gaulle zurück.
Nach dem Rücktritt von de Gaulle übte der Präsident des Senats Alain Poher (April – Juni 1969) das Amt des Präsidenten der Republik bis zu den Neuwahlen aus. Die nächsten Präsidentschaftswahlen gewann Georges Pompidou (1969-1974). Er liberalisierte die Wirtschaft und vertrat vor allem die Interessen des Großbürgertums. Sowohl außen- als auch innenpolitisch führte er die gaullistische Politik im Großen und Ganzen fort. Sein Tod auf Grund eines schweren Krebsleidens unterbrach 1974 Pompidous Amtszeit. Alain Poher übernahm ein zweites Mal die Staatsgeschäfte (April – Mai 1974). Neuwahlen brachten dem Kandidaten der UDF Valéry Giscard d'Estaing (1974 - 1981) den Sieg, der die liberale Politik weiterführte.
Als französischer Präsident setzte er auf eine intensive europäische Integration und arbeitete Konzepte zu einer gemeinsamen europäischen Währung aus (ECU). Seine Amtszeit wurde jedoch von der allgemeinen Wirtschaftskrise überschattet, die ihn zu unpopulären Sparmaßnahmen zwang. Außerdem ergab sich eine schwierige Situation auf Grund von Konkurrenzkämpfen innerhalb des rechten Lagers, durch die Giscard d’Estaing letztendlich die Wiederwahl im Jahre 1981 knapp verlor.
Am 10. Mai 1981 gelang es dem sozialistischen Kandidaten François Mitterrand (Präsidentschaftszeit: 1981-1995) für die nächsten 14 Jahre das Amt des Präsidenten zu übernehmen. Dies bedeutete für die Sozialisten jedoch nicht 14 Jahre Regierungszeit, da die Sozialistische Partei zwei Mal bei den Wahlen in die Nationalversammlung die parlamentarische Mehrheit verlor und der Präsident gezwungen war, einen Premierminister aus den Reihen der Gaullisten zu ernennen. Während seiner Amtszeit gelang es ihm jedoch, wichtige Reformen auf den Weg zu bringen.
Dazu zählt vor allem die Abschaffung der Todesstrafe, die breit angelegte Dezentralisierung, Aussetzung der Atomversuche und die Verwirklichung einer Reihe von baulichen Großprojekten in der Provinz und in der Hauptstadt (Geschäftsviertel La Défense, Pyramide im Louvre, Finanzministerium, Nationalbibliothek...). Die letzten Jahre seines Lebens waren von einer schweren Krankheit überschattet und nach und nach zog er sich aus dem politischen Leben zurück.
Am 7. Mai 1995 wurde Jacques Chirac zum Präsidenten der Französischen Republik gewählt. Zunächst versuchte er einige Initiativen von Mitterand rückgängig zu machen. So nahm er z.B. 1996 die Atomversuche wieder auf, intensivierte die Zusammenarbeit mit der NATO, verkürzte die Renten- und Krankenkassensubventionen... 1997 löste er die Nationalversammlung auf. Die rechten Parteien verloren die neuen Wahlen und Jacques Chirac war gezwungen, einen Premierminister aus den Reihen der Sozialisen zu ernennen. Er ernannte Lionel Jospin, der bis zum Juni 2002 die Regierung führte. 2002 gewannen die rechten Parteien die Wahlen. Dies erlaubte Chirac aktiver am politischen Leben teilzunehmen.
1968: Mit den schlechten Studienbedingungen unzufriedene Studenten in der überfüllten neuen Universität Paris-Nanterre setzen am 13. Mai die "événements de mai" in Gang, eine Art Jugendrevolte, die von den geburtenstarken Jahrgängen der späten Kriegs- und frühen Nachkriegsjahre getragen wird. Es folgen Studenten-Demonstrationen, Straßenschlachten mit der Polizei und bald auch Streiks und Fabrikbesetzungen der Arbeiter. Während Premierminister Pompidou erfolgreich mit den Gewerkschaften verhandelt und so die Arbeiter zufriedenstellt, ist de Gaulle tagelang verschwunden. Als er wie ein Deus ex machina wiederauftaucht (er war inzwischen beim Oberbefehlshaber der französischen Truppen in Deutschland), verkündet er Neuwahlen zur Assemblée Nationale für Ende Juni Diese bringen aufgrund der Angst vieler Franzosen vor einem wirklichen Umsturz und dank dem Ruhebedürfnis der großen Mehrheit, die mit den herrschenden Verhältnissen weitgehend zufrieden ist, einen überwältigenden Sieg für die gaullistische Partei. De Gaulle kann also weitermachen.
Er meint aber, die Zeichen der Zeit verstanden zu haben und tiefgreifende Reformen durchführen zu müssen, darunter vor allem eine stärkere Dezentralisierung bzw. Regionalisierung des gar zu zentralistischen französischen Staates sowie eine Neubestimmung der Funktion und eine Änderung der Wahlmodalitäten der zweiten Kammer des Parlaments, des Sénat (der alle drei Jahre zu einem Drittel durch indirekte Wahlen neu besetzt wird). Das entsprechende réferendum im April 1969 bringt jedoch keine Mehrheit, obwohl oder vielleicht gerade weil de Gaulle im Fall einer Ablehnung zurückzutreten gedroht hatte. In der Tat tritt er zurück und stirbt wenig später. Eine Ära ist zu Ende. De Gaulles Nachfolger, der "Gaullist" Georges Pompidou, ist bezeichnenderweise ein Politiker, der seine politische Karriere schon ganz in der Nachkriegszeit absolviert hat.
1971: François Mitterand schafft es auf dem legendären "congrès d'Épinal", die nicht-kommunistische Linke (SFIO, PSU und linke "clubs") zu einer neuen Partei zu vereinen, dem Parti socialiste. Dieser schließt 1972 ein Wahlbündnis mit dem PC, der damit erstmals aus seiner Isolation herauskommt. Die élections législatives von 1973 bringen zwar keinen Sieg, aber deutliche Stimmengewinne der vereinigten Linken, zu der sich auch die linke Fraktion des inzwischen arg geschrumpften und gespaltenen Parti radical gesellt hat, das Mouvement des radicaux de gauche (MRG). Bei den vorzeitigen Präsidentschaftswahlen (élections présidentielles), die 1974 durch den Tod im Amt von G. Pompidou erforderlich sind, unterliegt Mitterand nur knapp dem rechten Kandidaten Valéry Giscard d'Estaing. Dieser versucht nun seinerseits, die französische Rechte neu zu ordnen und eine große Volkspartei ähnlich der deutschen CDU/CSU zu kreieren. Er scheitert aber und bringt 1978 nur die UDF (Union pour la Démocratie française) zustande, einen Zusammenschluss seiner eigenen Partei, des Parti républicain, mit Resten des Parti radical, des MRP und anderer gemäßigt rechter Kleingruppen. Der stärkste rechte Block, die sich als Erben de Gaulles definierenden Gaullistes, sind nämlich schon 1976 neu formiert worden als Rassemblement pour la République (RPR) durch einen jungen Intimfeind Giscards, Jacques Chirac.
Auf Seiten der Linken läuft inzwischen ein Umschichtungsprozess weg von dem zunehmend erstarrenden PC und hin zum neugegründeten PS; spätestens ab 1974 ist nicht mehr der PC die stärkste Linkspartei, sondern der PS. Insgesamt etabliert sich so in den siebziger Jahren ein Vier-Parteien-System: links der PC und der PS (die gemeinsam ungefähr dieselben ideologischen Positionen vertreten wie in Deutschland die SPD), rechts die UDF (deren Positionen ungefähr denen von von FDP und CDU entsprechen) und der RPR (der in vielen seiner Positionen der CSU ähnelt). Dieses Vier-Parteien-System wird Frankreich fast zwanzig Jahre lang, bis in die neunziger, beherrschen. De Gaulles Pläne einer Dezentralisierung sind übrigens von seinen Nachfolgern Pompidou und Giscard d'Estaing nur halbherzig fortgeführt worden.
1981: Eindeutiger Wahlsieg François Mitterands bei den Präsidentschaftswahlen (présidentielles) im Mai. Mitterand versucht, den Linksruck im Land zu nutzen, und löst sofort die Assemblée Nationale auf. Die législatives im Juni machen den PS mit 38 % der Wählerstimmen zur stärksten politischen Kraft und verschaffen ihm dank dem Mehrheitswahlrecht der Cinquième République eine satte Mehrheit der Mandate. Vermutlich um das Potential der Kommunisten noch mehr auszusaugen, holt Mitterand dennoch auch einige kommunistische Minister in die Regierung. Seine Rechnung geht auf: tatsächlich schrumpft in den achtziger Jahren der PC zu einer Partei, die maximal 10 % der Stimmen erhält und so zu der Funktion absinkt, Protestwähler auf der Linken zu binden und damit eine Art Gegengewicht zu bilden gegen den nach 1981 wachsenden Front national des ehemaligen Poujadisten Jean-Marie Le Pen auf der äußeren Rechten. Zugleich hat sich mit den beiden linken Wahlsiegen und dem Machtwechsel (alternance) von rechts nach links die Cinquième République als fähig erwiesen zu friedlichen Wechseln. Frankreich ist nun endlich eine normale moderne Demokratie wie die USA, England oder - inzwischen - Deutschland. Die föderale Struktur der Bundesrepublik steht Pate bei der von Mitterand nun relativ energisch vorangetriebenen régionalisation, bei der je ca. 5 der knapp 100 départements zusammengelegt werden zu knapp 20 régions, die allerdings längst nicht so viel Selbständigkeit erhalten wie die deutschen Bundesländer.
Als ein Anachronismus dagegen erscheint die Wirtschaftspolitik der neuen sozialistisch-kommunistischen Regierung, die durch die Verstaatlichung (nationalisation) von Banken und einigen größeren Konzernen sowie durch Schuldenmachen zum Zweck des Ankurbelns der französischen Wirtschaft dem im übrigen westlichen Europa herrschenden Trend entgegenarbeitet. Tatsächlich erweist sich diese Politik rasch als Fehlschlag, und das stark vergrößerte Staatsdefizit zwingt die Regierung zu drastischen Schuldenbegrenzungsversuchen. Der Staat wird in Zukunft auch in Frankreich bestrebt sein, sich aus der Wirtschaft zurückzuziehen. Dennoch bleibt der staatliche Anteil im Produktions- und Dienstleistungsbereich bis in die Gegenwart hinein erheblich größer als in vergleichbaren europäischen Ländern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Charles de Gaulle Militär und Politiker
1890
22. November: Charles André Joseph Marie de Gaulle wird in Lille als Sohn des Gymnasiallehrers Henri de Gaulle geboren.
1911
Nach Beendigung der Offiziersschule St. Cyr Eintritt in die französische Armee als Infanterieoffizier.
1914-1918
Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg. De Gaulle nimmt an den Kämpfen um das Fort Douaumont bei Verdun als Hauptmann teil. Er wird schwer verwundet und gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er fünfmal vergeblich versucht zu entkommen. In dieser Zeit erlernt er die deutsche Sprache.
1918
Nach Kriegsende und Entlassung aus der deutschen Gefangenschaft, tritt de Gaulle wieder in die französischen Armee ein.
1920/21
De Gaulle arbeitet im Stab von General Maxime Weygand (1867-1965) in Polen.
1924 und 1927
Aufenthalt in Deutschland im Stab der Rheinarmee in Mainz (1924) und als Bataillonskommandeur in Trier (1927).
1925
Versetzung zum Kabinett von Marschall Henri Philippe Pétain.
1932-1936
Generalsekretär des Nationalen Verteidigungsrates.
1937-1939
De Gaulle ist zuerst Oberst eines Panzerregiments und 1939 Kommandeur einer Panzerdivision.
1938
Veröffentlichung der militär-philosophischen Schrift "Frankreich und seine Armee".
1940
19. Mai: Beförderung zum jüngsten General der französischen Armee.
6. Juni: Berufung auf den Posten eines Unterstaatssekretäres für Nationale Verteidigung.
15. Juni: Nachdem sich die Befürworter für einen Waffenstillstand um Pétain durchsetzen, fliegt de Gaulle nach London.
18. Juni: Über Radio London Aufruf an die französische Nation, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen.
25. Juni: Gründer des Londoner Komitees "Freies Frankreich", Chef der "Freien Französischen Streitkräfte" und Chef des "Nationalen Verteidigungskomitees" (1940-1943).
Juli: Vom Kriegsrat der Vichy-Regierung in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
1942
Juni: Mitbegründer und ab November 1943 Präsident des "Comité Francais de Libération Nationale" (Nationales Befreiungskomitee).
1944
Mai: Das "Comité Francais de Libération Nationale" konstituiert sich in Algier zur "provisorischen Regierung der französischen Republik".
August: Rückkehr nach Paris.
September: De Gaulle wird Chef der provisorischen Regierung Frankreichs.
1945
13. November: Die konstituierende Nationalversammlung wählt de Gaulle zum Ministerpräsidenten Frankreichs.
1946
Januar: Rücktritt vom Ministerpräsidentenamt wegen seiner Kritik an der Verfassung der IV. Republik.
1947
Gründer der "Sammlungsbewegung des französischen Volkes" (Rassemblement du Peuple Francais, RPF) mit dem Hauptprogrammpunkt, einer durchgreifenden Verfassungsreform.
In der Folge lehnt de Gaulle den Beitritt Deutschlands zur NATO, den Schumanplan und die Gründung der EWG mit der Begründung ab, daß Deutschland in diesen Gemeinschaften militärisch und wirtschaftlich das Übergewicht erhalten werde.
1953
Nach Wahlniederlage Auflösung der RPF als politische und parlamentarische Gruppe.
1954-1959
De Gaulle schildert seine politischen Aktivitäten bis 1946 in der Memoirenserie "L'Appel", "L'Unite" und "Le Salut".
1958
1. Juni: De Gaulle wird Ministerpräsident Frankreichs mit Sondervollmachten zur Niederschlagung des Aufstandes in Algier.
28. September: Durch Volksentscheid wird die auf de Gaulle zugeschnittene Verfassung der V. Republik angenommen: Sie legt die bestimmende Rolle des Staatspräsidenten fest und beschränkt die Rechte des Parlaments erheblich.
14./15. September: Gespräche mit Bundeskanzler Konrad Adenauer auf de Gaulles Landsitz in Colombey-les-deux-Eglises.
21. Dezember: De Gaulle wird mit 78 % der Stimmen zum französischen Staatspräsidenten gewählt.
1960
14. Juni: Nach fortdauernden Unruhen in Algerien spricht de Gaulle erstmalig von einem "algerischen Algerien".
1961
8. Januar: 75 % der Wähler entscheiden sich in Frankreich per Volksentscheid für die Algerienpolitik de Gaulles, die eine unabhängige Republik Algerien vorsieht. In Algerien selbst stimmen nur 40 % der Wahlberechtigten für diese Lösung.
April: General-Putsch in Algier, der jedoch bald zusammenbricht.
1962
18. März: Beendigung des siebenjährigen Algerienkrieges durch das Abkommen von Evian.
2.-8. Juli: Der Staatsbesuch Adenauers in Frankreich wird als Akt der feierlichen Versöhnung des deutschen und des französischen Volkes gestaltet.
3. Juli: Nach entsprechendem Volksentscheid erhält Algerien die Unabhängigkeit.
4.-9. September: Der Staatsbesuch de Gaulles in der Bundesrepublik wird von großen Sympathiebekundungen seitens der Bevölkerung begleitet.
28. Oktober: Per Volksentscheid votieren 61 % der Wähler für eine Verfassungsreform, nach der der Staatspräsident direkt vom Volk gewählt wird.
De Gaulle forciert die Bildung einer französischen Nuklearstreitmacht.
1962/63
Anhänger der "Organisation Armée Secrète" (OAS) verüben insgesamt sieben Attentate auf de Gaulle.
1963
14. Januar: De Gaulle bringt durch seine ablehnende Haltung die Brüsseler Verhandlungen zum Eintritt Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zum Scheitern.
22. Januar: Adenauer und de Gaulle unterzeichnen im Elysée-Palast den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.
1965
19. Dezember: Wiederwahl zum französischen Staatspräsidenten im zweiten Wahlgang gegen François Mitterrand.
1965/66
Frankreich boykottiert sieben Monate die Tagungen des europäischen Ministerrats. De Gaulle protestiert mit dieser "Politik der leeren Stühle" gegen die Vorschläge der Europäischen Kommission zur Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik.
1966
21. Februar: In einer Fernsehansprache erklärt de Gaulle, daß Frankreich nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des NATO-Vertrages im April 1969 die Unterstellung sämtlicher ausländischer militärischer Einrichtungen in Frankreich unter seinen Oberbefehl fordere.
20.-30. Juni: Reise in die Sowjetunion.
1. Juli: Da die NATO-Partner nicht auf de Gaulles Forderungen eingehen, wird der Abzug der französischen Offiziere aus den integrierten Stäben vollzogen und das NATO-Hauptquartier sowie die politische NATO-Spitze von Paris nach Belgien verlegt.
1967
6.-12. September: Auf seiner Polen-Reise spricht sich de Gaulle für die Anerkennung der Oder- Neiße-Grenze, aber gegen die Zweistaatentheorie aus.
1968
Die Studentenrevolte in Paris und die folgende große Streikwelle erschüttern de Gaulles Autorität.
1969
27. April: De Gaulle verbindet das Referendum über die sogenannte Regionalreform und die praktische Abschaffung des Senats mit der persönlichen Vertrauensfrage. Mit 47,5 % der Stimmen scheitert der Volksentscheid. Noch in der Nacht zum 28. April erklärt de Gaulle daraufhin seinen Rücktritt.
1970
Erscheinungsbeginn der zweiten Memoirenserie de Gaulles. Im ersten Band, "Le Renouveau" schildert er die ersten vier Jahre seiner Präsidentschaft. Die neue Folge unter dem Gesamttitel "Memoire d'Espoir" ist auf drei Bände konzipiert.
9. November: Charles de Gaulle stirbt auf seinem Landsitz in Colombey-les-deux-Eglises in Lothringen.
12. November: Beisetzung in Colombey-les-deux-Eglises. Da er ein Staatsbegräbnis ausdrücklich abgelehnt hatte, findet am selben Tag in Paris nur ein offizieller Trauergottesdienst statt, an dem über 80 ausländische Staats- und Regierungschefs teilnehmen.
8. Literaturliste:
Bücher:
Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ Suhrkamp Verlag Frankfurt, 1996
Ulrich Brieler: „Die Unerbitterlichkeit der Historizität. Foucault als Historiker, Köln/Weimar/Wien 1998
Nancy Fraser: „Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht, Frankfurt a. Main 1994
Pierre Hardot: Philosophie als Lebensführung“; Berlin 1991
Bernhard Schmid: Algerien - Frontstaat im globalen Krieg? Neoliberalismus, soziale Bewegungen und islamistische Ideologie in einem nordafrikanischen Land. ISBN 3-89771-019-6
Müller, Olaf: Theodor W. Adorno. In: Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungen. Von Adorno bis v. Wright. Stuttgart: Kröner 1991, 1 - 9
Michel Foucault: „Überwachen und Strafen“ übersetzt von Walter Seitter, Frankfurt/ Main 1976; 1969: L'archéologie du savoir; dt. Ausg.: Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2002. ISBN 3518279564
Les mots et les choses - Une archéologie des sciences humaines, Paris; dt. Ausg.: Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main 1974; Taschenbuchausgabe: Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003. ISBN 3518067346
Honneth, Axel und Saar, Martin [Hrsg.]: Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption: Frankfurter Foucault-Konferenz 2001. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003.
Kögler, Hans Herbert: Michel Foucault. Stuttgart.Weimar: Verlag J.B. Metzler, 1994.
Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analysen der modernen Gouvernementalität. Hamburg: Argument, 2001.
Rehmann, Jan: Postmoderner Links-Nietzscheanismus. Deleuze & Foucault. Eine Dekonstruktion. Hamburg: Argument-Verlag, 2004.
Schmid, Wilhelm: Auf der Suche nach einer neuen Lebenskunst. Die Frage nach dem Grund und die Neubegründung der Ethik bei Foucault Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000.
Internetrecherche
* Internetportal
www.frankreich-experte.de
- geschichte
KriegeArchiv (http://www.sozialwiss.unihamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege/035_algerien.htm) der Universität Hamburg (Fachbereich Sozialwissenschaft)
9. Erklärung
Ich versichere hiermit, dass die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe angefertigt wurde und dass ich außer der von mir angegebenen Literatur keine weitere benutzt habe.
Die wörtlich übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht!
08.12.16
Tim Werner
[...]
[1] Gille Deleuze, „Kontrolle und Werden“ in: ders., „Unterhandlungen 1972 – 1990, Frankfurt a. Main 1993, S. 250; Hervorheb. Im Orig..
[2] Michel Foucault, „Polèmipue, politique et problématisations“ in: Dits et Ecris IV, Paris 1994, S 185. Diese kritisch-transformative Perspektive illustriert Foucault anhand jener Teile der Frauenbewegung, die gegen jede Festlegung auf eine biologische Natur oder eine weibliche Identität ankämpfen: „[...] die feministischen Bewegungen haben die Herausforderung angenommen. Wir sind von Natur aus Sex? Na gut, seien wir das, aber in seiner Einzigartigkeit. In seiner irreduziblen Besonderheit. Ziehen wir die Konsequenzen und erfinden wir unsere eigene Weise politischer, ökonomischer, kultureller Existenz[...] (ebd., S 184 f.; vgl. auch S. 160-162) In ähnlicher Weise stellt Foucault klar, daß Homosexualität „... keine Form des Begehrens, sondern etwas Begehrenswertes ist. Wir müssen also darauf hinarbeiten, homosexuell zu werden, und dürfen uns nicht hartnäckig darauf versteifen, daß wir es schon sind“ (ders., „Von der Freundschaft, Berlin 1984, S. 86).
[3] Ulrich Brieler , „Die Unerbitterlichkeit der Historizität. Foucault als Historiker. Köln/Weimar/Wien 1998. S. 5; Hervorheb. Im Orig.).
[4] Nancy Fraser, „Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht, Frankfurt a. Main 1994, S. 53
[5] Foucault war, durch Althusser inspiriert, 2 Jahre in der KPF (Kommunistische Partei Frankreichs)
[6] Wilhelm Schmid, „ Wer war Michel Foucault?“ Vorwort in Michel Foucault „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 8
[7] Wilhelm Schmid, „ Wer war Michel Foucault?“ Vorwort in Michel Foucault „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 8
[8] Georges Canguilhem, „ Das Normale und das Pathologische“, 1943
[9] Jean Delay, arbeitete 2 Jahre mit Foucault im „Psychiatrischen Krankenhaus Sainte – Anne“ in Paris und praktizierte dort
[10] Kant, „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“
[11] Michel Fourier, „Dits et Ecrits“ (Gespräche und Schriften) 1994, Paris
[12] Sollte erst „Die Ordnung der Dinge“ heißen, er Name war aber urheberrechtlich geschützt
[13] vgl. Wilhelm Schmid, „ Wer war Michel Foucault?“ Vorwort in Michel Foucault „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 16
[14] Wilhelm Schmid, „ Wer war Michel Foucault?“ Vorwort in „ Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ Foucault „“ S. 13 und 14
[15] Im Deutschen „Sexualität und Wahrheit“ nach Wunsch F.´s so genannt
[16] Pierre Hadot, „Philosophie als Lebensführung“, Berlin 1991
[17] Ducio Trombadori: S.23 „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“
[18] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 24
[19] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 25
[20] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 26
[21] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 26
[22] Phänomenologie: die von e. Husserl begründete Lehre von den Bewusstseinsgegebenheiten, unter Ausklammerung ihrer Realität
[23] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 26 und 27
[24] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 27
[25] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S. 28
[26] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S. 28
[27] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 30
[28] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S. 30
[29] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 32
[30] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 33
[31] siehe Exkurs: „de Gaulle“ eine Personalie
[32] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 37
[33] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 35
[34] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 36
[35] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 37 ff.
[36] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 42
[37] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S. 39
[38] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 44
[39] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S.48 ff
[40] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S.50+51
[41] Georges Canguilhems großer Verdienst ist die archivarische Niederlegung und oft auch kritische Offenlegung der Geschichte der Medizin, ihrer Paradigmen, ihrer Irrtümer und vor allem: ihrer Philosophie. „Da wir alle von Ärzten auf die Welt gebracht werden und von Ärzten für tot erklärt werden, ist die Frage nach der Philosophie der Medizin vielleicht die wirkliche Frage nach dem letzten Sinn unseres Daseins.“ Ob es sich zur Klärung dieser Frage allerdings lohnt, sich durch Canguilhems fast unverständliche Sprache zu quälen, muss der Leser selbst entscheiden.
[42] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S.52
[43] siehe Exkurs Frankreich
[44] Claude Lévi –Strauss, Humanist und Völkerkundler, u.a.: „Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft“ 1949 und „Das wilde Denken“ 1962; Mit seinem von überkommenen Vorurteilen befreiten Blick auf die sogenannten "Wilden" hat der Ethnologe Claude Lévi-Strauss die moderne Völkerkunde revolutioniert und eine eigenwillige Methode mit Elementen der Strukturanalyse und der Psychoanalyse eingeführt, um beim Studium der Urvölker Mythen zu interpretieren, Denkweisen zu erforschen oder soziale Funktionen zu erklären. Sein Werk gab den Begriffen "Rasse", "Kultur" und "Fortschritt" eine neue Bedeutung.
[45] Frz. Philosoph, Mathematiker, 1596-1650, erster kritischer und Systematischer Denker der Neuzeit, „cogito ergo sum“ - ich denke also bin ich -
[46] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 44/45
[47] „Bourgeoisie“: das „Besitzende Bürgertum“, als Stand und geistige Haltung; „Bourgeois“ = der wohlhabende Bürger
[48] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 60
[49] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S.61
[50] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S.61
[51] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 62
[52] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S. 70
[53] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 71
[54] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 74
[55] Ducio Trombadori +Michel Foucault: „Der Mensch ist ein“ Erfahrungstier S. 75
[56] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 77 ff.
[57] Frankfurter Schule Als die Frankfurter Schule wird die neomarxistische, dialektische Kritische Theorie bezeichnet, die von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno im Institut für Sozialforschung begründet worden war Kern der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule ist die ideologiekritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen und historischen Bedingungen der Theoriebildung. Mit Kritik und Erkenntnis ist zugleich der Anspruch verbunden, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Die Bezeichnung Kritische Theorie geht auf den Titel des programmatischen Aufsatzes Traditionelle und kritische Theorie von Max Horkheimer aus dem Jahre 1937 zurück. Als Hauptwerk der Schule gilt die von Horkheimer und Theodor W. Adorno 1944 bis 1947 gemeinsam verfaßte Essay-Sammlung Dialektik der Aufklärung.
[58] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 80
[59] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 81
[60] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 82
[61] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 85
[62] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 90
[63] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 92
[64] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 94
[65] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 95 ff.
[66] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 96
[67] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 97 ff.
[68] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 98
[69] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 99
[70] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 104 ff.
[71] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 106 ff.
[72] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 108 ff.
[73] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 109
[74] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 115
[75] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 116/ 117
[76] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier “ S. 118
[77] Trombadori: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 121
[78] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 122
[79] Michel Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 122
[80] Gehirn & Geist Nr. 6/2005
[82] Foucault: „Der Mensch ist ein Erfahrungstier“ S. 6
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses HTML-Dokuments?
Dieses HTML-Dokument enthält OCR-Daten aus einer Veröffentlichung, wahrscheinlich ein akademischer Text oder eine Hausarbeit über Michel Foucaults Werk "Der Mensch ist ein Erfahrungstier". Es umfasst ein Inhaltsverzeichnis, Zitate, Informationen über Foucaults Leben und Denken, eine Zusammenfassung des Gesprächs zwischen Ducio Trombadori und Foucault, eine Eigenreflexion der Thesen Foucaults, einen Exkurs über die Geschichte Frankreichs und eine Personalie von Charles de Gaulle, sowie eine Liste der verwendeten Literatur. Die Arbeit befasst sich mit der Analyse von Machtbeziehungen und deren Wirkung auf die Gesellschaft.
Was ist das Hauptthema der Hausarbeit?
Das Hauptthema der Hausarbeit ist Michel Foucaults Leben, seine Philosophie und seine Auswirkungen auf die soziale Arbeit und die Gesellschaft. Es untersucht seine Entwicklung als Denker, seine Auseinandersetzung mit Macht, Wissen und Wahrheit, und die Übertragbarkeit seiner Ideen.
Wer ist Michel Foucault?
Paul Michel Foucault (1926-1984) war ein französischer Philosoph, Soziologe, Historiker, und Literaturkritiker. Er ist bekannt für seine kritischen Analysen von Institutionen, Machtstrukturen, Wissen und Diskursen.
Was sind Foucaults „Eckpunkte seines Denkens“?
Laut Wilhelm Schmid sind die vier Eckpunkte von Foucaults Denkens:(1) Auseinandersetzung mit Psychologie, Psychiatrie und Medizin. (2) Die Erarbeitung einer „Archäologie“ und Diskurstheorie. (3) Die Analyse der Machtbeziehungen. (4) Die Zuwendung zu Fragen der Ethik und der Lebenskünste.
Was bedeutet der "Tod des Menschen" bei Foucault?
Foucaults Aussage vom "Tod des Menschen" richtet sich gegen die Festlegung des Menschen für alle Zeit. Es bedeutet, dass der Mensch in den Strukturen, die er selbst erschaffen hat und die in der Moderne allgegenwärtig geworden sind, untergeht. Es kritisiert die Ungreifbarkeit des Humanismus und das der Mensch selbst Teil einer normativen Ordnung wird.
Was versteht Foucault unter "Erfahrung"?
Für Foucault ist Erfahrung etwas, aus dem man verändert hervorgeht. Es ist eine Weise, einen Gegenstand zu konturieren und eine Methode zu einer Analyse zu erfinden. Erfahrung ist immer eine Fiktion, etwas Selbstfabriziertes, das es vorher nicht gab und das es dann plötzlich gibt.
Was sind Foucaults Gedanken zum Strukturalismus?
Foucault sieht einen gemeinsamen Punkt zwischen Strukturalisten, nämlich, die Frage des Subjekts neu und anders zu stellen und sich von dem Grundpostulat zu befreien, das die französische Philosophie seit Descartes nie aufgegeben hatte. Er glaubt das der eigentliche Strukturalismus offenkundig keine Entdeckung der Strukturalisten der sechziger Jahre war, sondern auf eine ganze Reihe von Forschungen in der Sowjetunion und in Mitteleuropa zurückgeht.
Was ist Foucaults Meinung zu Machtbeziehungen?
Foucault unterscheidet zwischen Machtbeziehungen und Herrschaftsverhältnissen. Es ging ihm nicht darum, die Macht abzuschaffen, sondern Herrschaftsverhältnisse zu verhindern, indem er diese als umkehrbar und durchschaubar beschreibt.
Was ist der Exkurs über Frankreich von 1870 bis 1981?
Der Exkurs über Frankreich von 1870 bis 1981 gibt einen Überblick über die politische und gesellschaftliche Entwicklung Frankreichs in diesem Zeitraum. Er behandelt die Dritte, Vierte und Fünfte Republik, die Weltkriege, die Kolonialkriege, sowie wichtige politische Persönlichkeiten wie de Gaulle.
Was ist der Zweck der Zitate im Dokument?
Die Zitate dienen dazu, verschiedene Perspektiven auf Foucaults Werk und Denken darzustellen, sowohl zustimmende als auch kritische. Sie sollen dem Leser helfen, sich ein eigenes Urteil über Foucaults Philosophie zu bilden.
Wer war Charles de Gaulle?
Charles de Gaulle war ein französischer General und Staatsmann. Er spielte eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg als Führer der Freien Französischen Streitkräfte und war später Präsident Frankreichs.
Welche Kritik wird an Foucault geübt?
Nancy Fraser wirft Foucault vor, dass ihm normative Kriterien zur Unterscheidung der annehmbaren von den unannehmbaren Formen der Macht fehlen.
Was ist das Fazit der Hausarbeit?
Das Fazit der Hausarbeit ist, dass Foucaults Werk auch in der heutigen Zeit noch relevant ist, insbesondere seine Analysen von Macht und Systemen. Seine Ideen regen zum Nachdenken an und fordern dazu auf, bestehende Denkmuster zu hinterfragen und eigene Perspektiven zu überdenken. Alles ist relativ und der "Begriff" von dem man sich Dinge macht ist wandelbar und verändert sich durch die Sichtweise.
- Quote paper
- Tim Werner (Author), 2005, Michel Foucault "Der Mensch ist ein Erfahrungstier", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109752