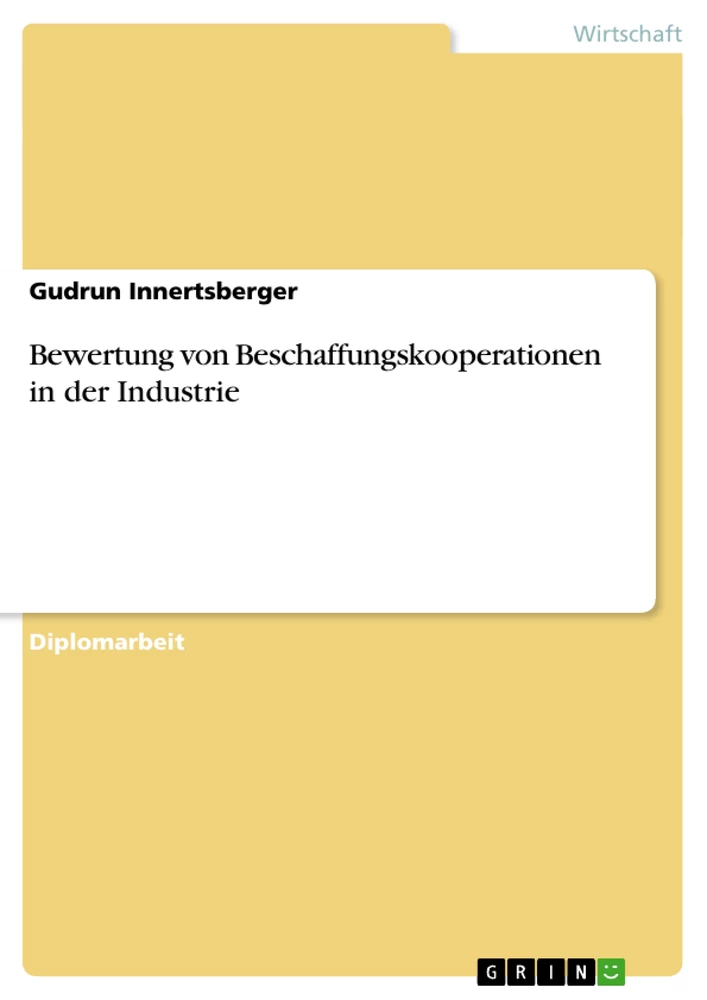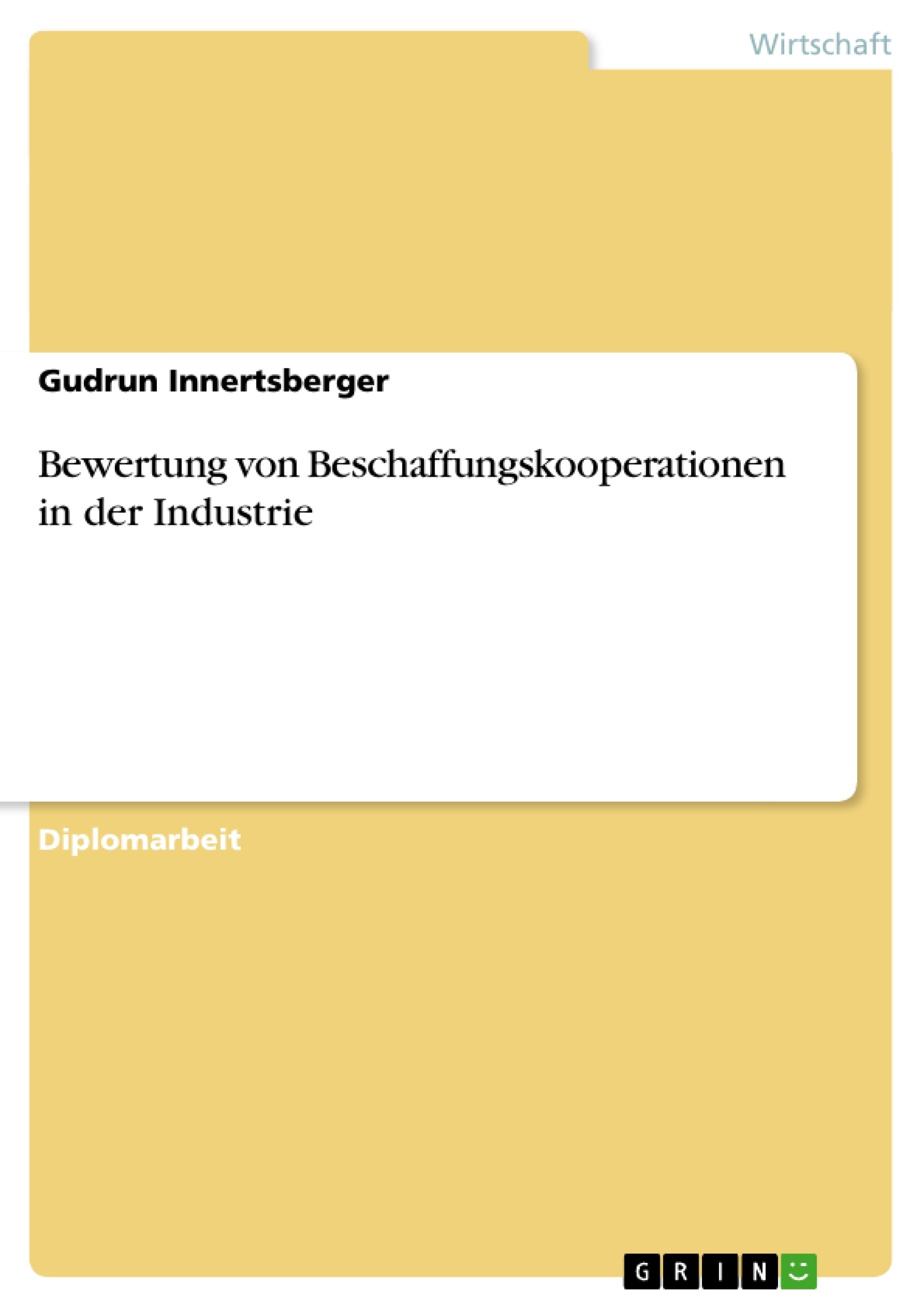Einleitung
Kooperationen sind in der heutigen Wirtschaft in vielfältiger Weise vorhanden. Sie betreffen sämtliche Bereiche der Wertschöpfung in den Unternehmen, wie die Produktion, die Entwicklung, den Vertrieb oder die Beschaffung.(1)
Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sind Kooperationen interessant, da sie dadurch ihre Größennachteile ausgleichen und zusätzliches Know-how gewinnen können. Dies führt zu einer Stärkung ihrer Position im Wettbewerb. Die Globalisierung oder auch die jüngste Erweiterung der Europäischen Union erleichtern hierbei Kooperationen über die nationalen Grenzen hinweg.
Ein näherer Blick auf den Bereich der Beschaffung offenbart Unterschiede in der Verbreitung von Kooperationen zwischen verschiedenen Branchen:
In Handel und Handwerk sind Beschaffungskooperationen weit verbreitet: Der Lebensmittelhandel beschaffte nach einer Studie aus dem Jahr 1998 bereits 40% der in Deutschland abgesetzten Lebensmittel durch Einkaufskooperationen.(2) Bekannte Beispiele sind Edeka und Rewe. Das Handwerk ist durch das Genossenschaftswesen geprägt, welches zurückgeht in die Mitte des 19. Jahrhunderts auf Hermann Schulze-Delitsch und Wilhelm Raiffeisen.(3) Damals als Einkaufsgenossenschaften
gegründet, haben sich diese Kooperationen mittlerweile zu Marketing-Unternehmen weiterentwickelt. Sie bieten ihren Mitgliedern verschiedene Dienstleistungen an und richten sich zunehmend auch auf die Absatzmärkte aus.(4)
Im öffentlichen Sektor wie dem Gesundheits- oder Schulwesen sind Beschaffungskooperationen vor allem in den USA seit langem erfolgreich tätig. In Deutschland sind sie dagegen noch wenig verbreitet.(5)
[...]
______
(1) Vgl. Arnold, Eßig (1997): S. 1; Geisen (2003): S. 13; Voegele, Schindele (1998a): S. 5.
(2) Vgl. Krups Consultants (1998): S. 1.
(3) Vgl. Servet (1998): S. 91–94.
(4) Vgl. Olesch (1998): S. 71f; Servet (1998): S. 96–98.
(5) Vgl. Arnold (1998c): S. 199; Eßig (1999): S. 117f.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Formen von Beschaffungskooperationen
- Eingliederung des Beschaffungswesens in das Unternehmen
- Allgemeine Charakterisierung von Beschaffungskooperationen
- Formale Gestaltung von Beschaffungskooperationen
- Kartellrechtliche Aspekte
- Das Pilotprojekt „Einkaufskooperation mittelständischer Unternehmen in Baden-Württemberg“ als Beispiel
- Motive für Beschaffungskooperationen
- Erklärung und Motive für Kooperationen generell
- Erläuterung der Motive für Beschaffungskooperationen
- Synergiepotenziale in der Beschaffung nutzen
- Know-how in der Beschaffung bündeln
- Risiko in der Beschaffung senken
- Beurteilung von Kooperationserfolg und Kooperationsform
- Voraussetzungen für den Erfolg von Beschaffungskooperationen
- Partnerwahl
- Erfolgskontrolle
- Bewertung der Kooperationsformen auf Basis der Motive
- Bewertung der Nutzung des Synergiepotenzials
- Bewertung der Know-how-Bündelung
- Bewertung der Risikosenkung
- Zusammenfassende Bewertung der Kooperationsformen in der Beschaffung
- Voraussetzungen für den Erfolg von Beschaffungskooperationen
- Schlussbetrachtung
- Anhang A
- Literaturverzeichnis
- Eidesstattliche Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Bewertung von Beschaffungskooperationen in der Industrie. Ziel ist es, die verschiedenen Formen von Beschaffungskooperationen zu analysieren, die Motive für deren Bildung zu erläutern und die Erfolgsfaktoren für die Zusammenarbeit zu identifizieren. Dabei werden die verschiedenen Kooperationsformen anhand ihrer Eignung zur Nutzung von Synergiepotenzialen, zur Bündelung von Know-how und zur Risikosenkung bewertet.
- Formen von Beschaffungskooperationen
- Motive für Beschaffungskooperationen
- Erfolgsfaktoren von Beschaffungskooperationen
- Bewertung der Kooperationsformen
- Praxisbeispiele für Beschaffungskooperationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von Beschaffungskooperationen in der heutigen Wirtschaft dar und beleuchtet die Verbreitung von Kooperationen in verschiedenen Branchen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den verschiedenen Formen von Beschaffungskooperationen, wobei die Eingliederung des Beschaffungswesens in das Unternehmen, die allgemeine Charakterisierung von Beschaffungskooperationen, die formale Gestaltung und kartellrechtliche Aspekte sowie ein Praxisbeispiel beleuchtet werden. Kapitel 3 analysiert die Motive für Beschaffungskooperationen, indem es die allgemeinen Ziele von Unternehmen und die spezifischen Motive für die Zusammenarbeit in der Beschaffung beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit der Beurteilung von Kooperationserfolg und Kooperationsform. Hier werden die Voraussetzungen für den Erfolg von Beschaffungskooperationen, insbesondere die Partnerwahl und die Erfolgskontrolle, untersucht. Darüber hinaus werden die verschiedenen Kooperationsformen anhand ihrer Eignung zur Nutzung von Synergiepotenzialen, zur Bündelung von Know-how und zur Risikosenkung bewertet. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Beschaffungskooperationen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Beschaffungskooperationen, Industrie, Synergiepotenziale, Know-how-Bündelung, Risikosenkung, Partnerwahl, Erfolgskontrolle, Kooperationsformen, Bewertung, Praxisbeispiele.
- Arbeit zitieren
- Gudrun Innertsberger (Autor:in), 2004, Bewertung von Beschaffungskooperationen in der Industrie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109739