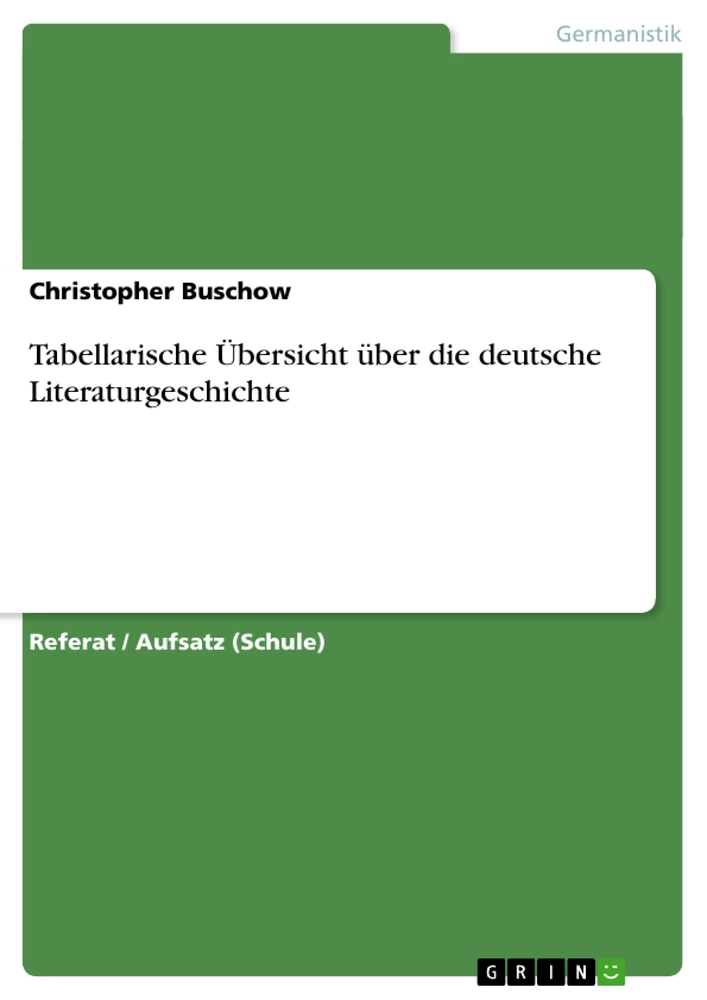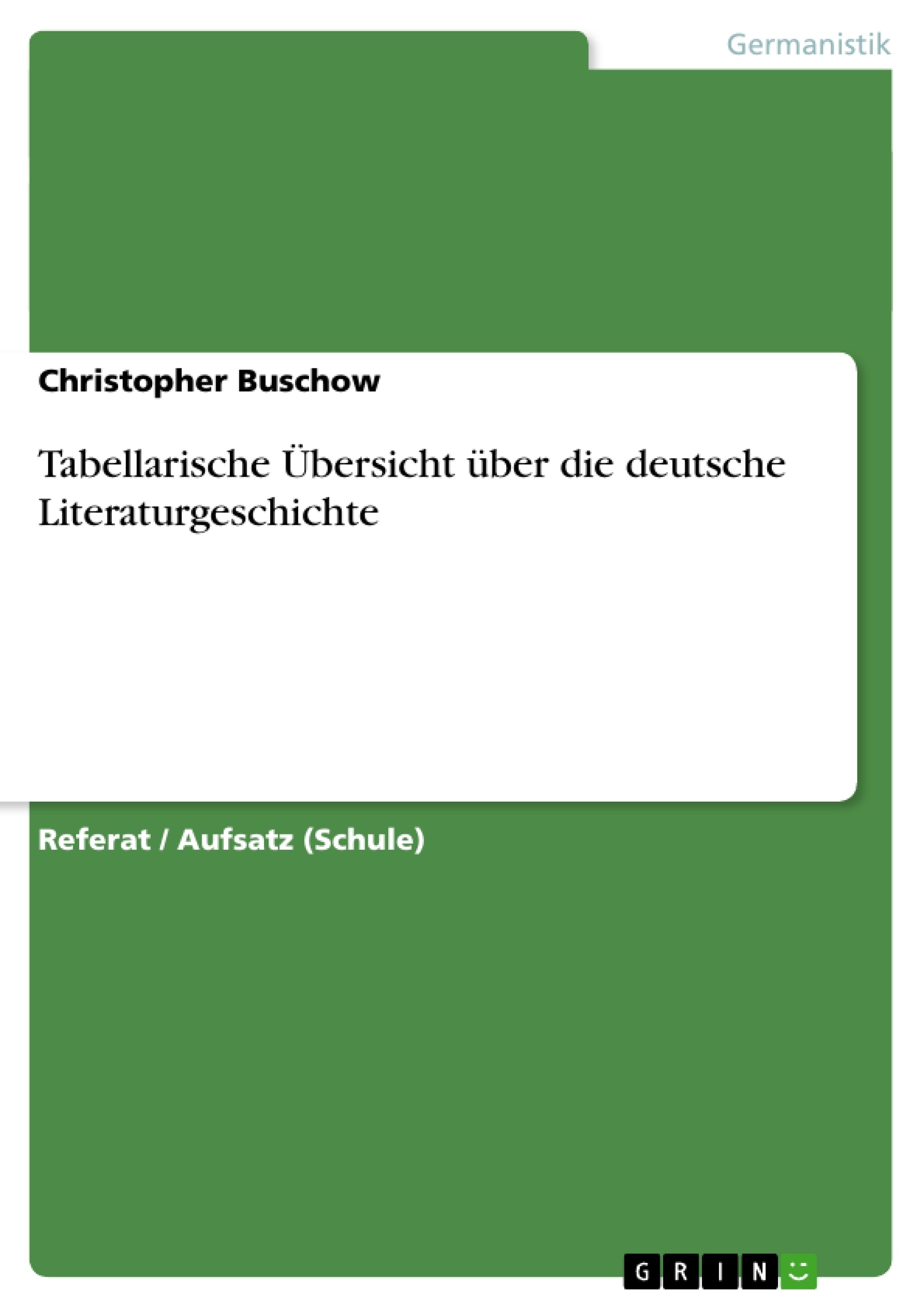| Epoche | Sturm und Drang (1767 – 1785) |
| Werk | Johann Wolfgang von Goethe – Die Leiden des jungen Werther |
| Klausur / Thema | 12-1 / Werther, Ende |
| Künstler | Bewertung: positiv · Jugendbewegung („dynamische Phase der Aufklärung“) · Interesse an der Gefühlswelt des eigenen Ichs und anderer Subjekte · Selbstverwirklichungsanspruch, Folge: Spontaneität · Freundschaftskult, Interesse an den eigenen und den Gefühlen anderer · theoretischer Drang zum Handeln <=> praktische Tatenlosigkeit |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · Ablehnung des reinen Vernunftsmenschen (Kritik an der Aufklärung) · Ablehnung von gesellschaftlichen Normen und religiösen Dogmen · Kritik am Absolutismus, an der Ständeordnung (aber: keine Versuche der Auflösung des adligen Standes) · Radikale Freiheit für die Entwicklung des Individuums · Pessimismus (Ablehnung des Fortschrittsoptimismus der Aufklärung) => Kulturpessimismus |
| Aufgabe der Kunst | · Betonung der menschlichen Subjektivität · Verherrlichung des Genies, „Geniekult“ (der titanische Rebell Prometheus) · Betonung des Gefühls, der Leidenschaft („Tränenseligkeit“) · „Originalwerke“ schaffen um die Schöpferkraft des Genies auszuleben · Kunst gilt als naturgebunden · teils revolutionäre Züge, aber keine Belehrung |
| Natur | Bewertung: positiv · Betonung des Göttlichen in der Natur (Pantheismus), „allesdurchdringende Weltseele in Form der ewigen Natur“ · Idealisierung der Natur als Andachtsraum => Naturoptimismus |
| Zentrale Thematik | · behindernde Kräfte der Zeit <=> uneingeschränkte Subjektivität des Ichs |
| Formen | · Drama (feste Formen aufgebrochen => Abkehr von der klassischen Dramenform) · Erlebnislyrik · Ballade (Hymnen, Oden) · Epik (eher im Hintergrund, Briefromane, Tagebücher) => Bekenntnisdichtung |
| Sprache | · Emotional, affektgeladen, spontan · Auflösung der Syntax · Grammatisch falsche Konstruktionen |
| Vorbilder | · J. J. Rousseau: Kulturpessimismus (Mensch von Natur aus gut, Gesellschaft schlecht) => „zurück zur Natur“ · Ossian: Natur und Empfindungswelt (Oden, Hymnen) · Shakespear: „Geniekult“, offene Dramenform, Bezug Natur <=> Kunst · Homer: Idealisierung der Natur („heile Welt“), Antike · Klopstock: Empfindsamkeit · Pietismus: gefühlsbetonte Beziehung zu Gott |
| Vorbildfunktion | · Vormärz (Jugendbewegung, Erneuerungsbewegung) · Expressionismus (Jugendbewegung, Erneuerungsbewegung) · Klassik (Aspekte des Gefühls) · [Naturalismus (Aufbrechen der Dramenform, Dialekte etc.)] |
| Epoche | Klassik (1786 – 1805) |
| Werk | Friedrich Schiller – Don Karlos |
| Klausur / Thema | 12-2 / Interpretation: Ideenballade "Die Bürgschaft" + Vergleich: Don Karlos |
| Künstler | Bewertung: positiv · Intellektuellenbewegung (hohe Kulturstufe) · zeitlose und mustergültige Werke => "Autonomieerklärung der Kunst" (Trennung der Kunst von der Wirklichkeit) · geschichtsphilosophisches Konzept zur Lehre der Humanität über ästhetische Erziehung · Toleranz · Weltbürgertum (Desinteresse an der Tagespolitik) · Erschaffen des Schönen durch Beachten von Gesetzen und Regeln (Ethos der Form, in dem sich die Idee der Freiheit spiegelt) |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · Verbesserung der Gesellschaft durch die einzelne Bildung (=> Veredlung) der Individuen mittels der Kunst (Theorie Schillers) · Freiheit (nach Schiller: sich den Regeln und Gesetze der Sittlichkeit zu unterwerfen) · Ideal des Menschen: "Schöne Seele" (Intuitive moralisch-korrekte Handlung ausgehend vom Gefühl, ideale Konsens zwischen Vernunft und Gefühl) · strenge Gesetze auch im Staatswesen |
| Aufgabe der Kunst | · Veranschaulichung des Wahren und Guten, nach dem der Mensch streben soll · ästhetische Erziehung (mit der Folge der ästhethischen Harmonie, "Schöne Seele") => Befreiungsmöglichkeit · Rückkehr zur Antike, Orientierung an deren Schönheitsideal · Ausgleich zwischen Extremen, sich "widerstreitenden Trieben" · Themen: übergeordnetem Leitgedanken folgen => Allgemeingültigkeit |
| Natur | Bewertung: neutral · von ewigen Gesetzen bestimmter neutraler Kosmos · Mensch ist in die Natur integriert und soll mit ihr im Einklang leben · fruchtbares und ewiges Lebensprinzip · Naturwissenschaftliche Ansätze (Studium der Natur gilt als Voraussetzung für jede Kunstproduktion) |
| Zentrale Thematik | · Harmonie von Vernunft / Verstand (Aufklärung) und Gefühl / Seele (Sturm und Drang) |
| Formen | · Drama (feste aristotelische Dramenpoetik) · Roman (Erziehungs- und Bildungsroman) · Ballade (Ideenballade) · Allgemeine Symbolik der Lyrik |
| Sprache | · stilisierte Kunstsprache (rhythmisch) · Mundart oder Dialekt unbekannt · Dämpfung und Ausklammerung von Gefühlen und Extremen |
| Vorbilder | · Aufklärung: Meschenwürde, Menschenrechte, freie Selbstbestimmung und Toleranz ("Bausteine der Humanitätsidee") · Sturm und Drang / Empfindsamkeit: Gefühlskultur und Individualität · Winckelmann: Verweis auf die Schönheit der griechischen Antike · Kants Idealismus beeinflusst besonders Schiller |
| Vorbildfunktion | ! |
| Epoche | Romantik (1795 – 1830) |
| Werk | Heinrich von Kleist – Die Marquise von O. (Spätromantik) |
| Klausur / Thema | keine [!] |
| Künstler | Bewertung: positiv · Vielseitigkeit und Subjektivität · von Gott gegebenes außergewöhnliches, grenzüberschreitendes Wahrnehmungsvermögen (z.B. Verständnis der Sprache der Natur) Folge: Einsicht in den Weltzusammenhang, der dem empirisch-rationalen Denken verschloßen bleibt · "schöpferisches Genie", das alle Lebensbereiche poetisch zu erfassen sucht => Interesse an allen Künsten und Wissenschaften · Schlichtheit und Harmonie (Naivität, Kindlichkeit) · Sehnsucht nach dem Unbekannten, Unerreichbaren und Geheimnisvollen (Novalis Symbol der "blauen Blume") · politisches Desinteresse auf Grund der Unterdrückung liberaler Hoffnungen · Frauen sind erstmals im literarischen Leben [z.T.] anerkannt · biedermeierlicher Romantiker: Tennung Theorie <=> Praxis: Romantik lediglich als eine Form des Nachempfindens der erschaffenen Wunschgebilde · gefährdeter Romantiker: tatsächliches "Ausleben" der Romantik => kritische Reflexion nötig, romantische Ironie bietet Distanz |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · politische Stagnation, "Maschinenzeitalter" => Werteverluste, Einschränkungen (bspw. in der Erkenntnis des Überirdischen) · Ablehnung der sog. "Philister" (engstirnige, leistungs-, erfolgs-, und zukunftsorientierte "Spießer") · Ziel: Mensch als Gefühlswesen, das sich über die durch Vernunft geschaffenen Begrenzungen hinwegsetzt |
| Aufgabe der Kunst | · Blick auf die menschliche Innenwelt · der Dichter als "höheres Wesen" kann mit der Natur und ihrer Sprache in Kommunikation treten und die Eindrücke in Form der dichterischen Sprache an den Leser weitervermitteln · die so entstehende "Gemütserregungskunst" dient der gedanklichen Befreiung aus allen gesellschaftliche und politischen Eingrenzungen (vgl. zentrale Motive wie Fernweh, Traum oder Wanderschaft) => Poetisierung der Gesellschaft · Rückbesinnung auf die Vergangenheit, Distanzierung von der Antiken-Rezeption der Klassik · christliches Mittelalter und Renaissance als utopische, aber überschaubare Gegenwelten · Musik als höchste Gattung der Kunst ("Vorschein des Unendlichen", "tiefster Gefühlsausdruck", "Sehnsucht nach dem Wunderbaren") · "Nachtseite der Romantik" (Blick auf die bedrohliche, tribehafte Innenwelt des eigenen Ichs, Traum) · wissenschaftliche Erforschung der deutschen Sprache und Literatur (kulturelle deutsche Volkstradition => Nationalismus) |
| Natur | Bewertung: positiv / negativ · gefühlsbetonter Ort · Möglichkeit, die überirdische Welt ahnend zu erkennen · der Künstler kann die göttliche Sprache der Natur wiedererlernen, indem er sich dieser öffnet und ihr "zuhört" · Musikalität der Natur als Inspiration · zwiespältige Doppelgesichtigkeit der Naturverbundenheit (idyllische Natur <=> bedrohliche Natur) |
| Zentrale Thematik | · "Universalpoesie" => Verschmelzung von Leben und Kunst |
| Formen | · Epik (Roman, Novelle, Kunstmärchen) · Auflösung von starren Gattungsgrenzen durch Einfügen von Märchen, Liedern, Briefen oder Episoden (=> Perspektivenfülle und Vielschichtigkeit der Romantik) · Lyrik ("Stimmungslyrik" persönliche Gefühle, Volkstümlichkeit) · Drama eher im Hintergrund (Kombination von Tragödie und Komödie) |
| Sprache | · Synästhesie (Verbindung verschiedener Sinneseindrücke) · einfache, volkstümliche (Natur-)Bilder |
| Vorbilder | · Empfindsamkeit, Pietismus: individuelle Gefühlswelt · Sturm und Drang: Freiheits- und Geniebegriff, Natur · Klassik: Harmoniestreben (aber: Abgrenzung, "ästhetische Revolution") · Mittelalter: Utopie der (alt-)deutschen Volkskunst, christliche Religion · Johann Gottlieb Fichte: radikaler Subjektivismus (menschliches Bewusstsein als Schöpfer der Welt) · Friedrich von Schelling: Identität zwischen Natur und Geist · Friedrich Schleiermacher: religiöser Individualismus |
| Vorbildfunktion | ! |
| Epoche | Junges Deutschland / Vormärz (1815 – 1850) |
| Werk | Georg Büchner – Woyzeck |
| Klausur / Thema | 12-3 / Erörterung einer Theaterrezension zu Woyzeck |
| Künstler | Bewertung: keine · politisches Engagement gegen die Restauration · Ablehnung der idealistischen Klassik => Kontrastmodell in Form eines demokratischen Prinzips der Literatur · im Vormärz große Anzahl an Exilliteratur · keine politischen Agitatoren (Ausnahme: Büchner) |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · Ablehnung jedes politischen, religiösen und moralischen Dogmatismus · politisches Mitspracherecht für alle Bürger · Presse- und Meinungsfreiheit · Frauenemanzipation · Sozialismus, Aufhebung der Standesunterschiede · Trennung von Staat und Kirche => im Vormärz als "illusionärer Liberalismus" betitelt |
| Aufgabe der Kunst | · soziale Anklage · aktuelle, das politische und soziale Leben kritisch betrachtende Dichtkunst · Parteinahme für das Volk · kritische Reflexion der Wirklichkeit · Bruch von gesellschaftlichen Tabus · bewusst populär, keiner Elite vorbehalten (breites Publikum) |
| Natur | Bewertung: keine |
| Zentrale Thematik | · Änderung der politischen und gesellschaftlichen Missstände |
| Formen | · Abkehr von den reglementierenden Doktrin der normativen Poetik (erstmals: Hauptfigur aus niederem Volk, Dialekt usw.) · Epik / Drama: kleinere Formen · politische Lyrik · neue Gattung: Reisebilder · journalistische Tätigkeiten (Witz, Satire und Pointenreichtum) · "Ideenschmuggel" mit Hilfe von Anspielungen und Plauderein => Aussagen hinter Reiseberichten, Romanen oder Abhandlungen über den Zweck der Kunst getarnt (Schutz vor Zensur) |
| Vorbilder | · Aufklärung: Voltaire und Denis Diderot · Auseinandersetzung mit Romantik und Klassik (keine Vorbildfunktionen) |
| Vorbildfunktion | |
| Georg Büchners dichterisches Selbstverständnis | · Determiniertheit des Menschen durch Natur (Körper und Triebe) und Gesellschaft (Materialismus) => Marionetten-Symbol, Pessimismus · Dichter als Geschichtsschreiber, der die Welt zeigt, wie sie ist (=> dokumentarisches Material als Quelle) · keine Idealisierung (niedere Stände auf der Bühne, Dialekte) => Naturalismus · keine Belehrung, kein Aufzeigen besserer Möglichkeiten (Dichter darf kein „Lehrer der Moral sein“) · keine Unterscheidung zwischen „Schönem“ und Häßlichem“ => Expressionismus => „Ich will es nicht besser machen, als der liebe Herrgott es gemacht hat“ · Abkehr von einem idealistischem Pathos => neues Weltbild, dass im Gegensatz zur Klassik nicht mehr durch Harmonie sondern durch Disharmonie geprägt ist |
| Heinrich Heines dichterisches Selbstverständnis | · Ablehnung der alten Kunst (Flucht vor den Leiden der Zeit in eine idealisierte, schein-artige Vergangenheit) · Forderung nach einer autonomen Kunst, die die Zeit widerspiegelt, geschaffen durch einen politischen, gottfreien und in Harmonie mit der Umgebung lebenden Künstler · Gegensätze prägen Heines Werke (Gefühl <=> Ratio, Tradition <=> Revolte) · Ironisierung der Romantik (z.B. romantische Gedichte mit kritischen Schlusspointen => Prinzip der Stimmungsbrechung) |
| Epoche | Poetischer Realismus (1850 – 1890) |
| Werk | Theodor Fontane – Effi Briest |
| Klausur / Thema | 12-4 / Auszug aus Frau Jenny Treibel Charakterisierung + Interpretation + Analyse |
| Künstler | Bewertung: keine · der Künstler beseelt den Rohstoff („die Wirklichkeit“) und verleiht ihm dadurch ein eigenes Leben (Prozess der Läuterung) · Abkehr vom Idealismus der Klassik, vom Irrationalismus der Romantik, von der Radikalität der Vormärz-Autoren · Resignation auf Grund der Nichteinlösbarkeit des Ideals (=> Determiniertheit) · Auffassung des Dichtens als bürgerliche Arbeit mit spezifischen Verpflichtung zu „Sauberkeit´“ der Komposition und des Stils · Zügelung der Subjektivität (vgl. Fontanes objektive Erzähltechnik), Treue zum Werk als ästhetische Einheit, Verzicht auf publizistische Grenzüberschreitung |
| Gesellschaft | Bewertung: keine · keine konkrete Kritik an der Gesellschaft, vielmehr Darstellung (der Roman als Kunstform) · Ablehnung eines „Elendsrealismus“ als direkte soziale Anklage · mehr Interesse an der „Welt“, als an der Gesellschaft · „wo die Wirklichkeit trivial ist, zerfällt die Literatur in triviale Schilderungen einerseits, haltlosen Subjektivismus, frivole Geistreichelei und rhetorische Deklamationen andererseits.“ |
| Aufgabe der Kunst | Poetischer Realimus: künstlerische Wiedergabe (Fontane) [Balzacs Realismus: reiner Wiedergabecharakter] [Kritischer Realimus: Aufdeckung der Wirklichkeit (Brecht)] · unparteiische, detaillierte Darstellung des Wirklichen und Wahren (unabhängig von der Größenordnung) · aber: subjektive, gefilterte Wiedergabe mittels einer poetischen Gestaltung (Wahrheit = Glaubwürdigkeit) · Realität muss verklärt werden, d.h. auf eine glaubwürdige Versöhnung hin transparent gemacht werden · über das Alltägliche hinausgehoben („Klorealität“ wird ausgegrenzt) · Eliminierung des Abenteuerlichen, Romantischen, sozial Randständigen; Verzicht auf „problematische“ Charaktere · Unterhaltung, Idylle, Verherrlichung des Bestehenden, distanzierter Humor · Intention des Künstlers wird in der Kunst sichtbar · Vermeidung von Stoffen und Formen, die exklusive literarische Bildung voraussetzen; statt dessen allgemein interessierende und zugängliche Werke => Analyse der psychischen Beweggründe für das Verhalten der Personen, Aufzeigen der gesellschaftlichen Normen, an denen diese sich orientieren (konservative Haltung <=> notwendiger Fortschritt) |
| Natur | Bewertung: keine |
| Zentrale Thematik | · Widerspiegelung alles Wirklichen |
| Formen | · Epik: Zeitroman / Gesellschaftsroman => Spiegel der Zeit (Fontane), Novelle zur Darstellung konzentrieter Konflikte · Lyrik / Drama: sehr begrenzt |
| Sprache | · eine charakterisierende Sprache, daher auch Bevorzugung der Prosa; jedoch kein Soziolekt in der Erzählerrede · unterschwelliger Humor und Ironie schafft Distanz |
| Vorbilder | · Positivismus: Erfahrungen und Tatsachen als Lösung für Erkenntnisfragen · Relativismus: Kritik an absoluten Werten · Pessimismus: Schopenhauers Weltbild · Sozialdarwinismus, Naturwissenschaften |
| Vorbildfunktion | · bildet die Basis für den Naturalismus · Thomas Mann wird durch Fontanes Erzähl- und Schreibstil beeinflusst |
| Epoche | Naturalismus (1880 – 1900) |
| Werk | Gehart Hauptmann – Die Weber |
| Klausur / Thema | keine [!] |
| Künstler | Bewertung: keine · Protestbewegung / Jugendbewegung · Ergründung der Kausalzusammenhänge des Lebens und der psychologschen Gesetzmässigkeiten · Ablehnung der verklärenden Wirklichkeit des poetischen Realismus und der klassischen / romantischen Kunstformen („verfault“) => Naturalismus als „modernes“ Gegenstück · Pessimismus: Befreiungsversuche der „passiven Helden“ scheitern (vgl. Büchner) · meist aus kleinbürgerlichem Milieu: Erkenntnis der „Wirklichkeiten der Straße“ · Oppositionshaltung gegen die wilhelminische Gesellschaft und deren Kulturverständnis, das der Kunst allenfalls eine Kompensationsfunktion zusprach |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · Naturalismus als literarische Reaktion auf den rasanten Zivilisationsprozeß des 19. Jh. · Herkunft, soziales Umfeld und Zeitumstände bestimmen das Wesen des Menschen („Milieutheorie“) · menschliche Handlungsarmut durch gesellschaftliche / politische Beschränkungen und Triebdeterminiertheit |
| Aufgabe der Kunst | · Kunst als naturwissenschaftliches Mittel, naturgetreue Annährung an die Wirklichkeit; gewisse Subjektivität bleibt bestehen (Arno Holz: „Kunst = Natur – x“) · „Seelendramen“, d.h. im Äußeren sollte sich das Innere zu erkennen geben. · Kritik an der Gesellschaft => soziales Mitgefühl · Aufklärung der Menschen zur Veränderung der sozialen Situation · aktuelle Thematiken, Probleme der Zeit (Standeskonflikte, „fünfter Stand“, Massengesellschaft, Gesellschaftsordnung, kleinbürgerliches Elend) · Einbindung der Kunst in die Lebenspraxis |
| Natur | Bewertung: keine · Kunst als Naturwissenschaft |
| Zentrale Thematik | · soziale Missstände der in der Kunst gespiegelten Wirklichkeit aufzeigen und -möglicherweise- verbessern |
| Formen | · Suchbewegung: neue Formen und Inhalte · soziales Drama steht eindeutig im Vordergrund: ausführliche Regieanweisungen, geringe Personenzahl (=> konzentrierte Aussage), keine Ständebegrenzungen mehr (=> vierter Stand), kein herkömmliches Theaterjargon (=> Dialekte usw.) Einheit des Ortes und der Zeit (=> Wahrscheinlichkeit), Auflösung der geschlossenen Form (=> minutiöse Stimmungsbilder, Ausschnitte aus dem Leben) [freie Bühne als Aufführungsort (vor der Zensur geschützt)] · Epik: Roman / Novelle greifen ebenfalls auf genaue Beschreibungen und Sekundenstil zurück => „konsequenter Naturalismus“ · Lyrik: erst aktuelle Themen in klassischen Formen, später komplett neue Gestaltung durch Arno Holz verlangt; Ablehnung von Musikalität, Reim und Strophe => neue Beziehung wzischen Sprache und Wirklichkeit, Konzentration auf den Sprachrhytmus („Prosalyrik“) |
| Sprache | · präzies Abbild der Realität => reportagehafte Formen · Bestandsaufnahme von Zeit und menschlichen Eigenschaften · Sekundenstil: akribisch-genaue, möglichst vollständige Darstellung von Zeitabläufen, Gedanken und Äußerlichkeiten · Umgangssprache, Dialekt, Stottern, Stammeln, Ausrufe, Emphasen, Stöhnen, Seufzen, Pausen => schichtspezifische Sprechweise d. Figuren, „Sprache des Lebens“ (Holz) |
| Vorbilder | · Emile Zola (französischer Naturalist): Literatur als ein Ausschnitt der Natur, wahrgenommen durch eine individuelle (dichterische) Persönlichkeit => mehr als fotografische Abbilder · Wissenschaftsgläubigkeit der Zeit (Darwin: „Sozialdarwinismus“, Marx / Engels: „Gesetzmässigkeit der Geschichte“) · Politische Implikationen: Fortsetzung des Jungen Deutschlands => materialistisches Menschenbild |
| Vorbildfunktion | · epochaler Beginn der Moderne · Holz Lyrik wirkt auf den „fin de siecle“ |
| Epoche | Symbolismus (1890 – 1910) |
| Werk | keins |
| Klausur / Thema | keine [!] |
| Künstler | Bewertung: positiv / elitär · „Avantgarde“: Sammlebegriff für eine formale und inhaltliche Opposition gegenüber Bestehendem · Symbole, die der Dichter in der Realität erkennt, werden ihm zum „Zeichen einer Erkenntnis“ · Exklusivität der Literatur: auf kleine, elitäre Kreise beschränkt (Georges Wunsch nach einer eigenen subjektiven Sprache) · moderne Sprach- und Bewusstseinskrise (Hoffmannsthals Chandos-Brief) => Dekadenz · Ohmacht und damit Distanz gegenüber politischer und gesellschaftlicher Entwicklung => Außenseiter (gewollte Abwendung und mangelnde Akzeptanz) · Rückzug in den sog. Elfenbeinturm (z.B. Stefan George), Flucht vor dem Alltag in eine ästhetischideele Welt · Künstlerwelt (Boheme) steht in Opposition zur Gesellschaft (Bourgeoisie) [Kunst <=> Leben] · teils priesterliche Funktion (Stefan George) => elitärer Machtmensch, Auserwählter (kein Einfluss sozialer Stellungen) |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · Existenz einer jenseitigen Welt · Einseitigkeit der Gesellschaft mit Einseitigkeit der Kunst beantwortet · Jahrhundertwende => allgemeiner Niedergang, sterbende Kultur |
| Aufgabe der Kunst | · Kunst als Selbstzweck, Autonomie der Kunst („l′art pour l′art“) · totale Subjektivität · über alle praktischen Einflüsse und ethischen Werte erhaben und nur aus sich selbst heraus zu verstehen · Lösung der Literatur aus fremder Zweckgebundenheit · Inhalt tritt hinter der ästhetischen Gestaltung eines Textes zurück · Darstellung des „Schönen“, „Nutzlosen“ und „Überflüssigen“ · Reflexion des tiefsten Seelenempfindens des Menschen durch künstlerische Zerlegung der Wirklichkeit in Symbole, die mit Hilfe der Kunst z.T. neu zusammengefügt und wiedergegeben werden · grundsätzliche Ablehnung des Naturalismus, kein Interesse an politisch-sozialer Aktualität, Ablehnung einer realistisch-naturwissenschaftlichen Weltsicht => Ästhetizismus · reine Dichtung („poesie pure“) => keine Belehrung, keine aufklärerische Funktion · suggestive, psychisch- / emotional-wirkende Kraft der Sprache deutete symbolhaft die hinter allem Sein liegende Idee (Daseinshintergrund) an · Poesie soll über die verbrauchte Mitteilungssprache erhoben werden => Exklusivität (Idealisierung der Musik; nicht mit pragmatischen Aufgaben wie Kommunikation belastet) |
| Zentrale Thematik | · Idealismus für die Kunst – zweckfrei |
| Formen | · betontes Formbewußtsein, strenger Versbau (Sonett, Terzine) · überwiegend Lyrik: streng-gefügte Gedichte (Stefan George), melodische Lyrik Hoffmannsthals Dinggedichte (Rilke) [distanziert-sachliche Erfassung des Wesens eines Objektes] · Drama (Einakter) / Epik im Hintergrund |
| Sprache | · Magie (Einbau mystischer Elemente) und Musikalität · äußerste Konzentration des Wortes auf seine sinnbildliche Aussagekraft · Bildkraft der Sprache steht über dem Erkenntnisvermögen des Verstandes · Reim, Synästhesie, Onomatopöie (lautmalende Wörter oder Wortneubildungen, Klangmalerei), Exotik, Wortneuschöpfungen, freie Verse (Reimordnung und Strophengliederung sind frei) · Analogien, Assoziationen, Klangkorrespondenzen, Mehrdeutigkeit, Metaphorik, Rhytmik |
| Vorbilder | · Beginn der Moderne in jeder Hinsicht · Frankreich: Schlagwörter „fin de siecle“ und „decadence“ (Stephane Mallarme) · Sigmund Freud: Psychoanalyse („neuer Zugang zu menschlichen Psyche“) · Nietzsche: Nihilismus (abendländische Wertebegriffe sind lediglich Hilfskonstrukte zur Aufrechterhaltung menschlicher Herrschaftsgebilde, bürgerliche Werte und Normen sind Heuchelei und Schein) => durchweg negatives Weltbild („Wille zur Macht“ als Gesetz des Lebens) · Albert Einstein: feste Begriffe von Raum und Zeit in Frage gestellt · Charles Baudelaire: Mitbegründer der modernen Lyrik · deutsche Romantik: Novalis |
| Vorbildfunktion | · Dadaismus · Futurismus · Surrealismus |
| Epoche | Expressionismus (1910 – 1920) |
| Werk | keins |
| Klausur / Thema | keine [!] |
| Künstler | Bewertung: keine · Jugendbewegung: Künder einer neuen Zeit · Abgrenzung von der Wirklichkeitsnachbildung und dem materiellen Weltbild des Naturalismus, vom Schönheitsideals und der Vordergründigkeit des Impressionismus / Symbolismus und der „fin de siecle“-Formel „l′art pour l′art“ · Bemühung um Intensität des Ausdrucks · Vernichtungs- / Untergangsstimmung <=> Fortschrittsoptimismus · Hassliebe zur Großstadt |
| Gesellschaft | Bewertung: negativ · Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und Dissoziation (Verlust der Einheit) auf Grund des Verlust fester Werte · Forderung nach Neubeginn, neues Weltbild (politischer Aktivismus, Pazifismus: „Der Sturm“, „Die Aktion“) · der Expressionismus spiegelt den „Keim [...] eines neuen Menschen“ => lautstarken Utopie des neuen Menschen · Protest gegen die bürgerlichen Strukturen der Wilhelminischen Epoche, gegen rücksichtslosen technischen Fortschritt und die Selbstentfremdung des Menschen („Individualitätsverlust“) · Glaube an einen Wandel zur Humanität <=> Resignation |
| Aufgabe der Kunst | · fundamentale Zivilisationskritik · als Gegenstück zum Nihilismus, als Wirklichkeitszertrümmerung · öffentliche Freiheit durch die Gesellschaft genommen => „Aufschrei“ in der Kunst durch persönliche Gefühle · Themen / Motive: Auflösung des Ich, neuer Mensch, Krieg (Weltkrieg als Symbol für die animalische Natur des Menschen) und Großstadt (Symbol für die Verdinglichung des Menschen in einer seelenlosen, automatisieten Welt) => Motive des Alltäglichen in verfremdeter Gestalt · kein Eindruck der Außenwelt (vgl. Realismus => Naturalismus, „Kunstform“), sondern ein Ausdruck der Innenwelt („Erlebnisform“), intensive Darstellung des Menschlichen · Kunst auf eine bisher „unerwartete Weise“ darstellen (vgl. „Ästhetik des Hässlichen“) |
| [Natur] / Großstadt | Bewertung: negativ · Natur tritt eindeutig in den Hintergrund, viel aktueller ist das sog. Großstadtmotiv · Weiterführung der Zivilisationskritik Rousseaus im Bezug auf die Großstadt |
| Zentrale Thematik | · Ausdruck der inneren Wirklichkeit, des Wesentlichen zur Erneuerung, Veränderung der „zur Unmöglichkeit gewordenen Welt“ |
| Formen | · Sprengung formaler Traditionen und der Grenzen der künstlerischen Gattungen · Lyrik: Großstadtdichtung (dämonisierte Gesamtmetaphern [Objektwelt wird dämonisch belebt], Verdinglichung des Menschen, großstädtische Nachtwelt, sprach- / typusexperimentelle Tendenzen [Simultangedicht, Reihungsstil usw.]) · expressionistisches Drama: abstrakte Büdhne, spärliche Requisiten, Wandlungs- / Erlösungsdrama, Stationendrama (Auflösung der Einheit des Ortes [isolierte Stationen des Weges], Perspektive des zentrale Ichs, Monolog verliert Ausnahmecharakter => Eröffnung eines „verborgenen Seelenlebens“, subjektive Dramatik · Epik: erst gegen Ende der Epoche treten Roman und Novelle in den Vordergrund; aussschnitthaftes und subjektives Aufzeigen durch Veränderung der Erzähltechnik (Figurenperspektive und innerer Monolog anstelle eines auktorialen Erzählers) |
| Sprache | · rauschhafte Sprache · Verkürzungen, Intensivierungen <=> pathetisch, barock, hymnisch · Reihungsstil in der Lyrik (Kombination von Unzusammenhängendem und Ungleichartigen, gleichzeitige oder kurz hintereinander Auftreten von zusammenhanglosen Metaphern) · direkte Benennung des Häßlichen und Trivialen · Wortneuschöpfungen · gebrochener und gekürzte Syntax (Wortfetzen, „Telegrammstil“) · übersteigerte Methaphorik · äußerst verkürzter Sprachstil (vgl. August Stramm) · Personifikation von Gegenständen, Verdinglichung des Ichs => Ausdruck des Ich-Verlusts · filmische Darstellungstechniken beeinflussen Erzählweise und Dramatugie => Montage- und Simultantechnik (Gleichzeitigkeit verschiedener, räumlich disparater Ereignisse; Ziel: Veranschaulichung der Vielheit verschiedener Erscheinungen, die Mehrschichtigkeit der Wirklichkeit und die Diskrepanzen der Lebensanschauungen zwischen den Menschen) |
| Vorbilder | · Sigmund Freud: Psychoanalyse · Nietzsche: Nihilismus (abendländische Wertebegriffe sind lediglich Hilfskonstrukte zur Aufrechterhaltung menschlicher Herrschaftsgebilde) => durchweg negatives Weltbild („Wille zur Macht“ als Gesetz des Lebens) · Henri Bergson: interlektuelle Erkenntnisfähigkeit ist begrenzt, „tiefere Wirklichkeit“ kann man nur durch Intuition erkennen, allesdurchdrigende Lebensenergie · Sören Kierkegaards: Betonung des „Christlich-Absoluten“ als Sinn des Lebens, der nötig ist, damit der Mensch nicht in Angst und Verzweiflung verfällt |
| Vorbildfunktion | · Bertolt Brecht · Friedrich Dürenmatt · Gesellschaftskritik und visionäre Bildlichkeit beeinflussten Dadaismus und Surrealismus · Warnutopien des ausgehenden 20. Jh. knüpfen an die Zivilisationskritik an |
Frequently asked questions
Was ist die Epoche des Sturm und Drang und welches Werk ist repräsentativ?
Der Sturm und Drang war eine Epoche von 1767 bis 1785. Ein repräsentatives Werk ist "Die Leiden des jungen Werther" von Johann Wolfgang von Goethe.
Wie wurde der Künstler im Sturm und Drang bewertet?
Der Künstler wurde positiv bewertet. Es gab eine Jugendbewegung, Interesse an der Gefühlswelt, Selbstverwirklichungsanspruch, Freundschaftskult und einen Drang zum Handeln, der jedoch oft in Tatenlosigkeit endete.
Wie wurde die Gesellschaft im Sturm und Drang bewertet?
Die Gesellschaft wurde negativ bewertet. Es gab Ablehnung des reinen Vernunftsmenschen (Kritik an der Aufklärung), Ablehnung von gesellschaftlichen Normen und religiösen Dogmen, Kritik am Absolutismus und Pessimismus, was zu Kulturpessimismus führte.
Welche Aufgabe hatte die Kunst im Sturm und Drang?
Die Kunst betonte die menschliche Subjektivität, verherrlichte das Genie, betonte das Gefühl und die Leidenschaft, schuf Originalwerke und galt als naturgebunden. Sie hatte teils revolutionäre Züge, aber keine Belehrung.
Wie wurde die Natur im Sturm und Drang bewertet?
Die Natur wurde positiv bewertet. Es gab eine Betonung des Göttlichen in der Natur (Pantheismus) und eine Idealisierung der Natur als Andachtsraum, was zu Naturoptimismus führte.
Welche Formen und Sprache waren typisch für den Sturm und Drang?
Typische Formen waren Drama (mit Aufbrechen fester Formen), Erlebnislyrik, Ballade (Hymnen, Oden) und Epik (Briefromane, Tagebücher). Die Sprache war emotional, affektgeladen, spontan, mit Auflösung der Syntax und grammatisch falschen Konstruktionen.
Wer waren die Vorbilder des Sturm und Drang?
Vorbilder waren J.J. Rousseau, Ossian, Shakespeare, Homer, Klopstock und der Pietismus.
Was ist die Epoche der Klassik und welches Werk ist repräsentativ?
Die Klassik war eine Epoche von 1786 bis 1805. Ein repräsentatives Werk ist "Don Karlos" von Friedrich Schiller.
Wie wurde der Künstler in der Klassik bewertet?
Der Künstler wurde positiv bewertet. Es gab eine Intellektuellenbewegung, zeitlose und mustergültige Werke, ein geschichtsphilosophisches Konzept zur Lehre der Humanität, Toleranz, Weltbürgertum und die Erschaffung des Schönen durch Beachten von Gesetzen und Regeln.
Wie wurde die Gesellschaft in der Klassik bewertet?
Die Gesellschaft wurde negativ bewertet. Es gab eine Verbesserung der Gesellschaft durch Bildung der Individuen mittels Kunst, ein Ideal des Menschen als "Schöne Seele" und strenge Gesetze auch im Staatswesen.
Welche Aufgabe hatte die Kunst in der Klassik?
Die Kunst veranschaulichte das Wahre und Gute, bot ästhetische Erziehung zur Befreiung, orientierte sich an der Antike und glich Extreme aus.
Wie wurde die Natur in der Klassik bewertet?
Die Natur wurde neutral bewertet. Es gab einen von ewigen Gesetzen bestimmten neutralen Kosmos, in den der Mensch integriert war und mit dem er im Einklang leben sollte.
Welche Formen und Sprache waren typisch für die Klassik?
Typische Formen waren Drama (feste aristotelische Dramenpoetik), Roman (Erziehungs- und Bildungsroman), Ballade (Ideenballade) und allgemeine Symbolik der Lyrik. Die Sprache war stilisierte Kunstsprache, ohne Mundart oder Dialekt, mit Dämpfung von Gefühlen und Extremen.
Wer waren die Vorbilder der Klassik?
Vorbilder waren die Aufklärung, der Sturm und Drang, Winckelmann und Kants Idealismus.
Was ist die Epoche der Romantik und welches Werk ist repräsentativ?
Die Romantik war eine Epoche von 1795 bis 1830. Ein repräsentatives Werk ist "Die Marquise von O." von Heinrich von Kleist.
Wie wurde der Künstler in der Romantik bewertet?
Der Künstler wurde positiv bewertet. Er verfügte über Vielseitigkeit, Subjektivität, ein außergewöhnliches Wahrnehmungsvermögen, war ein "schöpferisches Genie", sehnte sich nach dem Unbekannten und war teils politisch desinteressiert.
Wie wurde die Gesellschaft in der Romantik bewertet?
Die Gesellschaft wurde negativ bewertet. Es gab politische Stagnation, das "Maschinenzeitalter", Ablehnung der "Philister" und das Ziel, den Menschen als Gefühlswesen zu sehen.
Welche Aufgabe hatte die Kunst in der Romantik?
Die Kunst blickte auf die menschliche Innenwelt, der Dichter konnte mit der Natur kommunizieren und seine Eindrücke weitervermitteln, was zur "Poetisierung der Gesellschaft" führte. Es gab eine Rückbesinnung auf die Vergangenheit und Musik galt als höchste Gattung der Kunst.
Wie wurde die Natur in der Romantik bewertet?
Die Natur wurde sowohl positiv als auch negativ bewertet. Sie war ein gefühlsbetonter Ort, der Möglichkeit zur Erkenntnis der überirdischen Welt bot, aber auch zwiespältige Doppelgesichtigkeit aufwies.
Welche Formen und Sprache waren typisch für die Romantik?
Typische Formen waren Epik (Roman, Novelle, Kunstmärchen), Lyrik ("Stimmungslyrik") und Drama. Die Sprache war Synästhesie und einfache, volkstümliche (Natur-)Bilder.
Wer waren die Vorbilder der Romantik?
Vorbilder waren Empfindsamkeit, Pietismus, Sturm und Drang, Klassik, das Mittelalter, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich von Schelling und Friedrich Schleiermacher.
Was ist die Epoche Junges Deutschland / Vormärz und welches Werk ist repräsentativ?
Junges Deutschland / Vormärz war eine Epoche von 1815 bis 1850. Ein repräsentatives Werk ist "Woyzeck" von Georg Büchner.
Wie wurde der Künstler in Junges Deutschland / Vormärz bewertet?
Es gab kein eindeutiges Urteil. Es gab politisches Engagement gegen die Restauration und Ablehnung der idealistischen Klassik.
Wie wurde die Gesellschaft in Junges Deutschland / Vormärz bewertet?
Die Gesellschaft wurde negativ bewertet. Es gab Ablehnung von Dogmatismus, Forderung nach politischem Mitspracherecht, Pressefreiheit, Frauenemanzipation und Sozialismus.
Welche Aufgabe hatte die Kunst in Junges Deutschland / Vormärz?
Die Kunst sollte soziale Anklage erheben, das aktuelle Leben kritisch betrachten, Partei für das Volk ergreifen, Tabus brechen und bewusst populär sein.
Welche Formen und Sprache waren typisch für Junges Deutschland / Vormärz?
Es gab eine Abkehr von normativer Poetik, Epik/Drama in kleineren Formen, politische Lyrik, Reisebilder und journalistische Tätigkeiten. Es gab "Ideenschmuggel" aufgrund von Zensur.
Wer waren die Vorbilder von Junges Deutschland / Vormärz?
Vorbilder waren Voltaire und Denis Diderot.
Was ist Georg Büchners dichterisches Selbstverständnis?
Büchner glaubte an die Determiniertheit des Menschen, sah den Dichter als Geschichtsschreiber, der die Welt zeigt, wie sie ist, idealisierte nicht und wollte kein "Lehrer der Moral" sein. Er unterschied nicht zwischen "Schönem" und Hässlichem".
Was ist Heinrich Heines dichterisches Selbstverständnis?
Heine lehnte alte Kunst ab, forderte autonome Kunst, die die Zeit widerspiegelt, und sah Gegensätze als prägend für seine Werke. Er ironisierte die Romantik.
Was ist die Epoche des Poetischen Realismus und welches Werk ist repräsentativ?
Der Poetische Realismus war eine Epoche von 1850 bis 1890. Ein repräsentatives Werk ist "Effi Briest" von Theodor Fontane.
Wie wurde der Künstler im Poetischen Realismus bewertet?
Es gab kein eindeutiges Urteil. Der Künstler beseelte die Wirklichkeit, kehrte vom Idealismus ab, resignierte angesichts nicht einlösbarer Ideale und zügelte die Subjektivität.
Wie wurde die Gesellschaft im Poetischen Realismus bewertet?
Es gab kein eindeutiges Urteil. Es gab keine konkrete Kritik an der Gesellschaft, sondern vielmehr Darstellung. Ein "Elendsrealismus" wurde abgelehnt.
Welche Aufgabe hatte die Kunst im Poetischen Realismus?
Die Kunst sollte unparteiische, detaillierte Darstellung des Wirklichen bieten, aber subjektiv gefiltert und poetisch gestaltet sein. Die Realität musste verklärt und das Alltägliche überhöht werden.
Welche Formen und Sprache waren typisch für den Poetischen Realismus?
Typische Formen waren Epik (Zeitroman, Gesellschaftsroman, Novelle). Lyrik und Drama waren begrenzt. Die Sprache war charakterisierend, mit unterschwelligem Humor und Ironie.
Wer waren die Vorbilder des Poetischen Realismus?
Vorbilder waren Positivismus, Relativismus, Pessimismus, Sozialdarwinismus und die Naturwissenschaften.
Was ist die Epoche des Naturalismus und welches Werk ist repräsentativ?
Der Naturalismus war eine Epoche von 1880 bis 1900. Ein repräsentatives Werk ist "Die Weber" von Gerhart Hauptmann.
Wie wurde der Künstler im Naturalismus bewertet?
Es gab kein eindeutiges Urteil. Der Künstler war Teil einer Protestbewegung, ergründete Kausalzusammenhänge, lehnte die verklärende Wirklichkeit ab und war pessimistisch.
Wie wurde die Gesellschaft im Naturalismus bewertet?
Die Gesellschaft wurde negativ bewertet. Der Naturalismus war eine Reaktion auf den Zivilisationsprozess des 19. Jahrhunderts, wobei Herkunft, soziales Umfeld und Zeitumstände das Wesen des Menschen bestimmten.
Welche Aufgabe hatte die Kunst im Naturalismus?
Die Kunst war ein naturwissenschaftliches Mittel, strebte nach naturgetreuer Annäherung an die Wirklichkeit, zeigte "Seelendramen", kritisierte die Gesellschaft und wollte die Menschen zur Veränderung der sozialen Situation aufklären.
Welche Formen und Sprache waren typisch für den Naturalismus?
Es gab eine Suchbewegung nach neuen Formen und Inhalten. Das soziale Drama stand im Vordergrund, mit ausführlichen Regieanweisungen und der Einbeziehung des "vierten Standes". Die Sprache war präzises Abbild der Realität, mit Sekundenstil, Umgangssprache und Dialekt.
Wer waren die Vorbilder des Naturalismus?
Vorbilder waren Emile Zola, wissenschaftliche Erkenntnisse der Zeit (Darwin, Marx/Engels) und das Junge Deutschland.
Was ist die Epoche des Symbolismus?
Die Epoche des Symbolismus war von 1890 bis 1910.
Wie wurde der Künstler im Symbolismus bewertet?
Der Künstler im Symbolismus wurde als positiv oder elitär bewertet. Er wurde als Avantgarde verstanden, der Symbole in der Realität erkennt, eine exklusive, subjektive Sprache verwendet und sich aufgrund von Ohnmacht aus Politik und Gesellschaft zurückzieht.
Wie wurde die Gesellschaft im Symbolismus bewertet?
Die Gesellschaft wurde negativ bewertet. Es wurde von der Existenz einer jenseitigen Welt ausgegangen, wobei Einseitigkeit der Gesellschaft mit Einseitigkeit der Kunst beantwortet wird. Der Symbolismus sah das Jahrhundertende als einen allgemeinen Niedergang einer sterbenden Kultur.
Welche Aufgabe hatte die Kunst im Symbolismus?
Die Kunst war Selbstzweck und autonom. Inhalt trat hinter der ästhetischen Gestaltung zurück und der Symbolismus lehnte den Naturalismus ab. Suggestive und emotional wirkende Kraft der Sprache deutete symbolhaft die Idee, die hinter allem Sein liegt, an. Reine Dichtung ohne Belehrung war das Ziel.
Welche Formen und Sprache waren typisch für den Symbolismus?
Betontes Formbewusstsein, strenger Versbau (Sonett, Terzine), überwiegend Lyrik (Dinggedichte), Drama und Epik eher im Hintergrund. Magie, Musikalität, Konzentration des Wortes auf sinnbildliche Aussagekraft, Klangmalerei, Wortneuschöpfungen und freie Verse.
Wer waren die Vorbilder des Symbolismus?
Der Symbolismus war der Beginn der Moderne. Vorbilder waren Stephane Mallarme, Sigmund Freud, Nietzsche, Albert Einstein, Charles Baudelaire und deutsche Romantiker wie Novalis.
Was ist die Epoche des Expressionismus?
Die Epoche des Expressionismus war von 1910 bis 1920.
Wie wurde der Künstler im Expressionismus bewertet?
Es gab keine eindeutige Bewertung des Künstlers im Expressionismus. Es war eine Jugendbewegung, die neue Zeiten verkündete, sich von Wirklichkeitsnachbildung, materiellem Weltbild und Schönheitsidealen abgrenzte. Es gab eine Bemühung um Intensität des Ausdrucks.
Wie wurde die Gesellschaft im Expressionismus bewertet?
Die Gesellschaft wurde im Expressionismus negativ bewertet. Es gab Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Dissoziation aufgrund von Werteverlust und die Forderung nach einem Neubeginn. Der Expressionismus spiegelte den Keim eines neuen Menschen wieder und protestierte gegen die bürgerlichen Strukturen.
Welche Aufgabe hatte die Kunst im Expressionismus?
Die Kunst war fundamentale Zivilisationskritik und das Gegenstück zum Nihilismus. Durch die persönliche Freiheit, öffentliche Gefühle zu äußern, gab es in der Kunst einen Aufschrei. Motive waren Auflösung des Ich, Krieg und die Großstadt, Kunst auf eine bisher unerwartete Weise darzustellen.
Welche Bedeutung hatte die Großstadt im Expressionismus?
Die Großstadt war im Expressionismus von großer Bedeutung und wurde negativ bewertet. Es war eine Weiterführung der Zivilisationskritik Rousseaus im Bezug auf die Großstadt.
Welche Formen und Sprache waren typisch für den Expressionismus?
Sprengung formaler Traditionen. Die Lyrik war eine Großstadtdichtung. Abstrakte Bühnen, Wandel- und Erlösungsdramen und Stationendramen sind typisch für das expressionistische Drama. Der Verfasser nutzte rauschhafte Sprache, verkürzte und intensivierte Ausdrücke, Reihungsstil, direkte Benennung des Hässlichen, Wortneuschöpfungen, Telegrammstil und filmische Darstellungstechniken.
Wer waren die Vorbilder des Expressionismus?
Vorbilder waren Sigmund Freud, Nietzsche, Henri Bergson und Sören Kierkegaard.
- Quote paper
- Christopher Buschow (Author), 2005, Tabellarische Übersicht über die deutsche Literaturgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109562