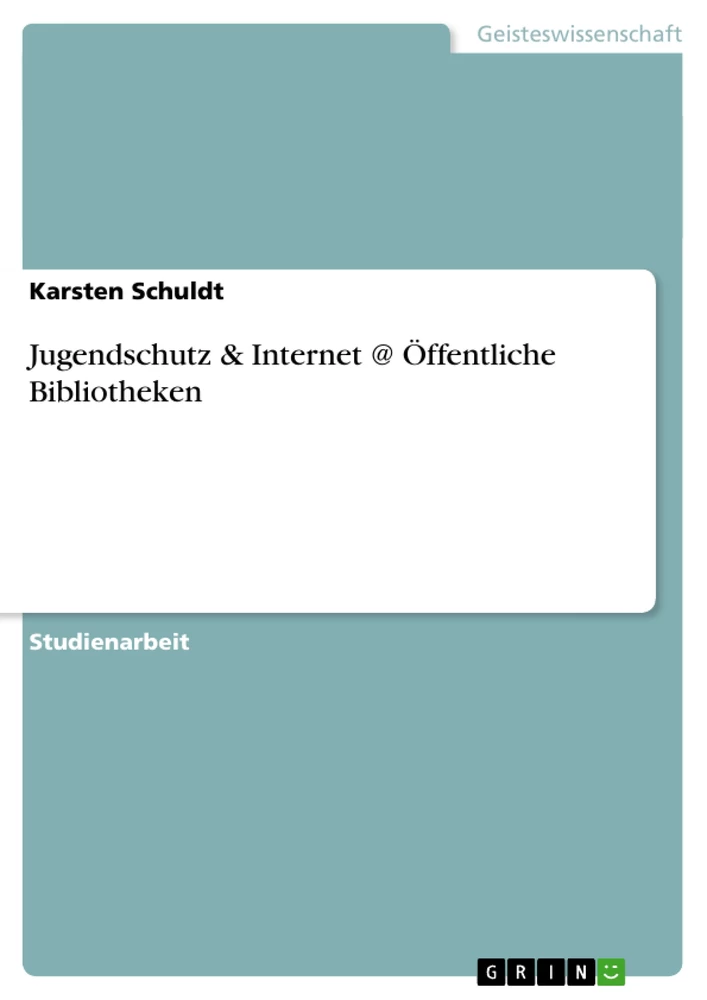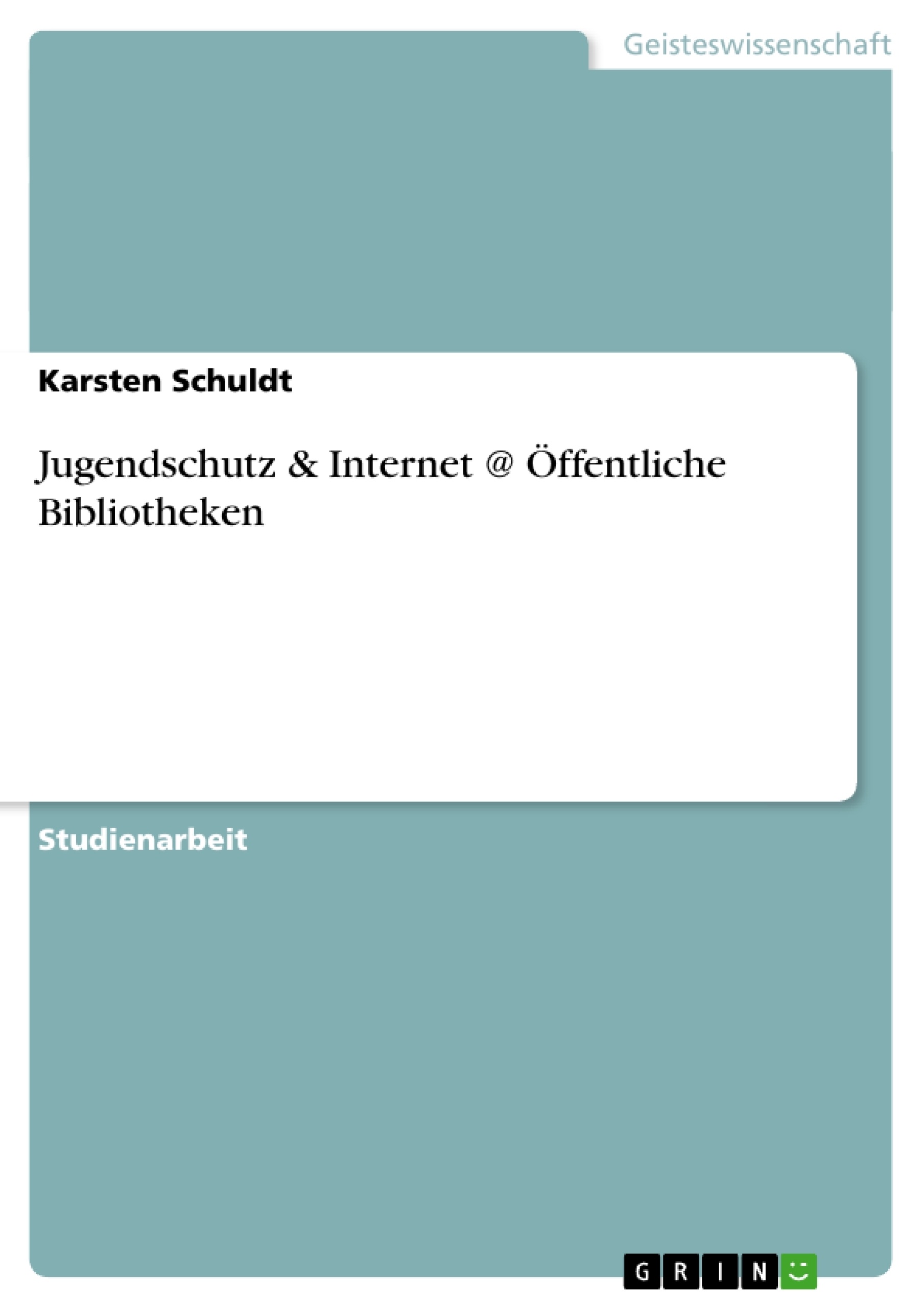In einer Welt, in der digitale Grenzen verschwimmen und das Internet zum allgegenwärtigen Spielplatz für junge Menschen geworden ist, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie schützen wir unsere Kinder vor den Schattenseiten dieser grenzenlosen Freiheit, ohne ihre Entdeckerfreude und ihren Wissensdurst zu ersticken? Diese hochaktuelle Analyse des Jugendschutzes im digitalen Zeitalter wirft einen schonungslosen Blick auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen, die komplexen Gesetze und die ethischen Dilemmata, die mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet einhergehen. Von den Paragraphen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) bis hin zu den Grauzonen der Meinungsfreiheit und der elterlichen Verantwortung werden alle relevanten Aspekte beleuchtet. Dabei werden nicht nur die Probleme schonungslos aufgedeckt – von der Internationalität des Internets und der Schwierigkeit, einheitliche moralische Standards durchzusetzen, bis hin zur Frage der Medienkompetenz und der Rolle öffentlicher Bibliotheken –, sondern auch innovative Lösungsansätze präsentiert. Leserinnen und Leser erhalten einen fundierten Überblick über die Herausforderungen, vor denen Eltern, Pädagogen, Gesetzgeber und die Gesellschaft als Ganzes stehen, sowie praktische Empfehlungen, wie sie Kinder und Jugendliche verantwortungsvoll im Umgang mit den digitalen Medien unterstützen können. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich für den Schutz unserer Jugend in der digitalen Welt engagieren und die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit finden wollen. Es ist eine Einladung, sich aktiv an der Gestaltung einer medienkompetenten und verantwortungsbewussten Gesellschaft zu beteiligen, in der Kinder und Jugendliche ihre Persönlichkeit frei entfalten können, ohne unnötigen Gefahren ausgesetzt zu sein. Ein Weckruf für eine zeitgemäße und wirksame Jugendschutzstrategie im 21. Jahrhundert, die auf Prävention, Bildung und dem mündigen Umgang mit digitalen Medien basiert. Tauchen Sie ein in die brisante Debatte um Jugendschutz, Internet und die Zukunft unserer Kinder – eine Auseinandersetzung, die uns alle betrifft.
Inhalt
Jugendschutz als Verfassungsrecht
Gesetzliche Grundlagen des Jugendschutzes
Gesetze
Spezielle Ausführungen zum JUSchG und zum JMStV
Jugendschutz im Internet : Probleme & Lösungsvorschläge
Jugendschutz, Internet & Öffentliche Bibliotheken
Literatur
Jugendschutz als Verfassungsrecht
Der Jugendschutz in der Bundesrepublik Deutschland wird als ein Verfassungsrecht angesehen. Dieses Recht ergibt sich aus Artikel 2, Absatz 1 und Artikel 6, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes, die wie folgt lauten:
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Strafgesetz verstößt“ [GG Art.2 Abs.1][1]
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht.“ [GG Art.6 Abs.2 Satz 1]
Das Recht auf den, nicht nur körperlichen, Schutz der eigenen Kindheit und Jugend wird somit allen Deutschen – nach Definition des Grundgesetzes – zugestanden und ist Rahmen für alle weiteren Bundes- und Landesgesetzgebungen.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Jugendschutz gegebenenfalls die in Artikel 5 gegebene Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit einschränken könnte. Dort heißt es:
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. […] Eine Zensur findet nicht statt.“ [GG Art.5 Abs.1 Satz 1]
Diese Rechte sind untereinander abzuwägen.
Gesetzliche Grundlagen des Jugendschutzes
Gesetze
Am 1. April 2003 trat sowohl das neuen Jugendschutzgesetz [JuSchG], als auch der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrag [JMStV] in Kraft. Ziel dieser beiden Gesetzeswerke war es, eine einheitliche Rechtsgebung auf dem Gebiet des Jugendschutzes zu gewährleisten.
Bis dahin hatte eine Reihe von Verordnungen und Gesetze den Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes vorgegeben. Einige dieser Regelungen wurden durch die zwei neuen Gesetze ersetzt, einige andere sind weiterhin in Kraft. Als wichtigste davon sind das Strafgesetzbuch mit dem Sexualstrafrecht [§174 - §184c StGB] und das Achte Buch des Sozialgesetzbuches [Kinder- und Jugendhilfe] zu nennen.
Zudem existieren in den einzelnen Ländern unterschiedliche Rechte. Dennoch vermerkt die Amtliche Begründung zum JUSchG: „Bund und Länder streben für den Jugendmedienschutz insgesamt einen einheitlichen Standard an“ [BJUschG: 109].
Auf internationaler Ebene sind vor allem die UN-Konvention über die Rechte des Kindes und das EU-Grünbuch über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde in den audiovisuellen und den Informationsdiensten zu nennen. Allerdings hat die Bundesrepublik die UN-Konvention noch nicht vollständig ratifiziert, sondern sich rechtlich nur weitgehend an sie angelehnt, so dass es schwer ist, sich auf sie zu berufen.
Spezielle Ausführungen zum JUSchG und zum JMStV
Nach der in unterschiedlichen Gesetzen wiederholten Definition ist Kind, wer nicht 14 Jahre als ist und Jugendliche / Jugendlicher, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. Diese Grenzen gelten vor allem für den Jugendschutz.
In den Medien, und speziell hier im Internet, sind einige Inhalte allgemein verboten und andere Inhalte im Sinne des Jugendschutzes untersagt. Für letztere muss der Zugang für Kinder und Jugendliche eingeschränkt werden.
Unter anderem im §4 JMStV werden die verbotenen Angebote definiert als solche, „deren Inhalt gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist“, die Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen darstellen, „Hass gegen Teile der Bevölkerung […] aufstacheln“, Verbrechen des Nationalsozialismus verleugnen und verharmlosen, die den Krieg verherrlichen, „Anleitung zu einer […] rechtswidrigen Tat“ bieten, Gewalttätigkeiten verherrlichen oder verharmlosen, gegen die Menschenwürde verstoßen oder aber Pornographie und Gewalttätigkeiten mit „Kinder und Tieren“[2] darstellen.
Für Kinder und Jugendliche untersagt sind Pornographie, sowie Angebote
„die offensichtlich geeignet sind, der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit […] schwer [zu] gefährden.“ [§4 JMStV]
Diese Formulierung kann als Normativ für den Jugendschutz genommen werden. Es geht bei der Bewertung von Medieninhalten nicht vorrangig um die sofortige Wirkung auf Kinder und Jugendliche, sondern um die längerfristigen Folgen. Die Enquete–Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft : Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ des Deutscher Bundestages formulierte diese Grundlage wie folgt:
„Nicht die medialen Inhalte als solche werden für schädlich gehalten, sondern mögliche Effekte bei Kindern und Jugendlichen, die von der Beeinflussung durch mediale Inhalte herrühren.“ [Enquete : 20]
Zur Durchführung des Jugendschutzes wurde die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien [BPjM] mit erweiterten Aufgaben betraut. Die BPjM kann alle Medien, außer Radioprogrammen, die Ländersache sind, überprüfen und wenn es nötig erscheint eine Indizierung veranlassen.
Indizierte Medien dürfen Kindern und Jugendlichen nicht mehr zugänglich gemacht, noch dürfen sie verkauft oder für sie geworben werden. Unter Umständen ist auch der Besitz strafbar.[3]
Durfte die Bundesprüfstelle bis zum 1. April 2003 nur auf Anträge staatlicher Institutionen hin tätig sein, so darf sie heute selber aktiv werden. Im Jahr 2004 hat die BPjM insgesamt 388 Medien indiziert, davon 190 [49%] Onlineangebote[4].
Des Weiteren wurde mit dem §14 JMStV eine Kommission für Jugendmedienschutz [KJM], bestehend aus 12 Sachverständigen aus den Landesmedienanstalten, sowie den Bundes- und Landesbehörden für Jugendschutz, eingeführt. Diese setzt Werte fest, an denen sich die BPjM in ihren Entscheidungen zu orientieren hat.
Mit der Initiative jugendschutz.net wurde eine Institution geschaffen, die – der KJM zugeordnet – zentral alle relevanten Nachrichten und Texte zum Jugendschutz im Internet sammeln und gleichzeitig Onlineangebote beobachten soll.
Mit §7 JMStV wurden Jugendschutzbeauftragte eingeführt, deren Aufgabe die Überwachung des Jugendschutzes bei den einzelnen Anbieterinnen und Anbietern ist. Solche Jugendschutzbeauftragten müssen eingestellt werden, wenn entweder bundesweites Fernsehen angeboten oder aber allgemein zugängliche Telemedien betrieben werden. Einzig bei weniger als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder weniger als 10 Millionen Zugriffen pro Monat kann auf solche Beauftragten verzichtet werden, so die Anbieterinnen und Anbieter einer Organisation der Freiwilligen Selbstkontrolle beitreten[5].
Als Strafbestimmung wurde in §23 JMStV festgehalten, dass Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr für die Verbreitung jugendgefährdender Medien verhängt werden können, und dass für Fahrlässigkeiten in diesem Bereich bis zu 6 Monaten Freiheitsstrafe drohen.
Dabei ist zu beachten, dass nach §6 JMStV und §9 JMStV der oder die für Informationen verantwortlich ist, die oder der sie zur Verfügung stellt. „Diensteanbieter“ dagegen, die einzig Daten bereithalten oder übermitteln sind nicht verantwortlich, sie sind auch nicht für eine Überwachung der Daten zuständig. Erst wenn sie Kenntnis von der Rechtswidrigkeit von Daten erhalten, sind sie verpflichtet zu handeln.
Jugendschutz im Internet : Probleme & Lösungsvorschläge
Das größte Problem für die Durchsetzung des Jugendschutzes im Internet ist die Internationalität des Mediums. Auch wenn die reale Situation in Betracht gezogen wird, dass die Welt immer mehr in „information rich“ und „information poor“ aufgeteilt ist[6], so ist doch festzustellen, dass Daten in unterschiedlichsten Ländern mit unterschiedlichsten Rechtskulturen und Moralausfassungen gespeichert und zur Verbreitung bereitgestellt werden können.
Immer wieder wird deshalb ein internationaler Regelungsbedarf angemahnt. Es solle, so scheint es manchmal, eine in allen Ländern gleiche Grundlage für den Jugendschutz geschaffen werden.
Diese Idee allerdings lässt, wie zum Beispiel Hausigmann [Hausigmann: 179-191] feststellt, vollkommen außer acht, dass ein solcher internationaler Jugendschutz in unterschiedlichen Kulturen und insoweit auch innerhalb unterschiedlicher Moralen zu agieren hätte. Letztlich ist diese Idee nicht umsetzbar, solange es radikal differente Positionen zu Freiheiten, Rechten und Pflichten in den unterschiedlichen Rechtsauffassungen gibt.
Zudem ist kritisch anzumerken, dass ein internationaler Jugendschutz, der unter den heutigen Machtverhältnissen in der Welt geschlossen würde, ein Jugendschutz mit westlich-liberalen und christlichen Werten und Annahmen wäre, der in anderen Ländern nicht anders als kolonial wirken würde[7].
Bisher haben unterschiedliche Beispiele vor allem gezeigt, dass Indizierungen und Verbote keine Effekte zeigen oder aber relativ schnell und einfach umgangen werden können. Insoweit ist eher an der Arbeit von jugendschutz.net zu konstatieren, dass sich staatliche Akteure und Akteurinnen immer mehr Strategien bedienen, die so nicht im Gesetz vorgesehen sind, sondern von anderen für das Internet entwickelt wurden. Da ist zum einen die internationale Zusammenarbeit zu nennen, zum anderen der Versuch indizierte Seiten durch das Schalten eigener Seiten in großer Zahl im Datenmüll verschwinden zu lassen.
Neben gesetzlichen Regelungen wurde im Internet der Versuch gemacht eine Netiquette zu installieren. Diese solle als netzspezifische Moral gelten und Verstöße gegen sie von der Netzgemeinde geahndet werden. Von der einen Seite hoch gelobt, wird von der anderen Seite berechtigt gefragt, wo bei diesem Konzept die Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative bleibe.
Ein gerne zitiertes Konzept, mit dem Problem der Internationalisierung des Internets umzugehen, stellt die so genannte Medienkompetenz dar. Diese definiert die schon zitierte Enquete-Kommission
„als die Fähigkeit, Medien nicht allein kritisch analysieren und reflektieren zu können, sondern sie auch im Kontext selbstbestimmten und sozialen Handelns nutzen zu können, [sie] schließt die Fähigkeit ein, sich von desorientierten Medieninhalten abzuwenden und ihnen die Grundlage, den Konsumakt zu entziehen.“ [Enquete : 15]
Grundidee ist, dass die Kinder und Jugendlichen, die medienkompetent seien, ihren Jugendschutz quasi selbst betreiben würden. Auffällig ist hierbei, dass von den gesetzlichen Grundlagen des Jugendschutzes keine Rede mehr ist.
Jugendschutz, Internet & Öffentliche Bibliotheken
Für öffentliche Bibliotheken haben das Internet und die Diskussion um den Jugendschutz sowohl neue Felder eröffnet, als auch Unsicherheiten geschaffen. Zum einen sind gerade Bibliotheken, neben Kindergärten, Schulen und Jugendclubs, die Stätten, an denen Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche vermittelt werden kann.
Gleichzeitig ist die Situation unübersichtlicher geworden. War es vor dem Internet noch möglich, durch Medienauswahl und Zugangsbeschränkung in den Bibliotheken Jugendschutz durchzusetzen, ist dies auf diesem Weg nicht mehr möglich, so in Bibliotheken Internetzugänge angeboten werden. Da aber gerade Bibliotheken der Ort sind, an dem Informationen erwartet werden, an denen Kinder und Jugendliche den Umgang mit Informationen lernen sollen und denen im Allgemeinen von Eltern ein großer Vertrauensvorschuss in Sachen Jugendschutz gewährt wird, sollte dieses Thema nicht umgangen werden.
Dabei gilt es Ängste abzubauen. Zum einen ist die Haftungsfrage entscheidend. Eine Bibliothek sollte sich darüber klar sein, dass sie nur für die eigenen Inhalte und die Inhalte, die sie sich zu eigen macht haftbar ist. Für die reine Zugangsvermittlung ist sie es nicht, solange sie bei Rechtsverstößen die ihr bekannt werden, einschreitet.
Dabei sollte die Gefahr für Kinder und Jugendliche im Internet nicht überschätzt werden. Die meisten jugendgefährdenden Angebote sind heute schon geschützt oder waren nie öffentlich zugänglich. So stellte die schon genannte Enquete-Kommission fest, dass noch nie der Fall eines so genannten Snuff-Video[8] bekannt wurde, dass auch wirklich existierte, obwohl dies in den Medien immer wieder thematisiert wurde. Ebenso ist Kinderpornographie gerade nicht offen im Netz zugänglich, sondern wird von den daran Beteiligten – schon im Eigeninteresse - geheim gehalten. Die Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zufällig auf jugendgefährdende Angebote zu stoßen sind relativ gering. Gezieltes Suchen würde sie aber auch ohne Internet zum Erfolg führen.
Es wurden in den letzten Jahren einige Strategien für den Einsatz des Internet gerade in Kinder- und Jugendbibliotheken diskutier[9]. Die effizientsten scheinen zu sein:
- Das Festhalten der Haftungsfreiheit der Bibliothek und der Verantwortung der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer in der Nutzungsordnung
- Die Zugangsbeschränkung nach Alter und / oder mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
- Die zentrale Aufstellung der Rechner, so dass von den Angestellten und anderen Besucherinnen und Besucher der Bibliothek ein sozialer Druck auf die Internet-Nutzerinnen und -Nutzer ausgeübt wird
Nicht sonderlich bewährt dagegen haben sich bisher der Einsatz von Filtersoftware und der Versuch eigene, teilweise oder vollständig abgeschottet, Netze für Kinder und Jugendliche aufzubauen.
Festzuhalten bleibt, dass sowohl der Jugendschutz, als auch die Bibliotheken durch das Internet vor neuen Probleme gestellt wurden, die bisher nicht adäquat gelöst wurden. Die Inkraftsetzung des JMStV und des JuSchuG haben die Situation zwar übersichtlicher gemacht, ob sie dadurch besser wurde ist eine andere Frage.
Das beste Mittel des Jugendschutzes scheint im Rahmen des Internet die Befähigung der Kinder und Jugendlichen zu sein. Ob die Gesetzgebung überhaupt je wirksam auf diese Anforderung reagieren kann, bleibt fraglich.
Allerdings darf dies nicht dazu führen, das Internet einzig als gefährlichen Raum wahrzunehmen und das Problem zum Beispiel durch Abschottung der eigenen Bibliothek zu lösen.
Literatur
- Jugendschutz: Sonderdruck aus Hartstein / Ring / Kreile / Dörr / Steffner : Jugendschutzmedien-Staatsvertrag ; [Textausgabe] / [Hartstein ...]. – 1. Aufl. – München [u.a.] : Rehm, 2003
- Jugendschutz: Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Vorschriften des Strafgesetzbuches, des Teledienstgesetzes und des Rundfunkstaatsvertrages sowie weiterer Bestimmungen zum Jugendschutz ; Kommentar / von Marc Wiesching ... Rainer Scholz begr. Werk. – 4. Überarb. Aufl. – München : Beck, 2003
- [BJMStV] Amtliche Begründung zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag – in: Hartstein : 23-64
- [BJuSchuG] Amtliche Begründung zum Jugendschutzgesetz – in: Hartstein : 107-144
- Thomas Hausmanniger [Hrsg.] / Handel im Netz : Bereichsethik und Jugendschutz im Internet – München : Wilhelm Fink, 2003 [Schriftenreihe des International Center of Information Ethics (ICIE); 2]
- Markus Wolf / Befähigung statt Repression : Jugendschutz unter Bedingungen der globalen Kommunikation – in: Hausmanniger : 193-204
- Rainer Richard / Jugendschutz im Internet : ein aktueller und kritischer Wegweiser für Lehrer und Eltern – Kissing : WEKA Fachverlag für Behörden und Institutionen, 2001
- Susanne Klötzer / Jugendschutz und Internet in Öffentlichen Bibliotheken – Köln : Fachhochschule Köln, Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen, 1998 [Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft; 8]
- Enquete – Kommission Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft: Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft ; Deutscher Bundestag [Hrsg.] / Kinder- und Jugendschutz im Multimediazeitalter – Bonn : ZV Zeitungsverlag, 1998 [Schriftenreihe „Enquete Kommission: Zukunft der Medien“; 6]
[...]
[1] Sowohl hier, als auch im Rest des Grundgesetzes fällt die nicht geschlechtergerechte Sprache auf. Zwar hat sich die Bundesregierung in einem Kabinettbeschluss vom 23. Juni 1999 darauf festgelegt mit Gender Mainstreaming die Geschlechtergleicheit auch in Gesetzestexten anzuwenden, doch scheint dieser Beschluss auch heute nicht vollständig durchgeführt worden zu sein. Siehe auch: www.gender-mainstreaming.de
[2] Diese unglückliche Formulierung, die den Anschein erwecken kann, dass Kinder mit Tieren gleichgesetzt werden, geht auf den Text in §4,(10) JMStV zurück. Das Missverständnis ist dort angelegt.
[3] Die jeweils aktuellen Rechtslagen sind auf der Homepage der BPjM [www.bundespruefstelle.de] nachzulesen.
[4] BPjM : Jahresstatistik 2004 ; http://www.bundespruefstelle.de/Texte/m1_Ea_txt.htm#Erledigungen, Zugriff 30.05.2005
[5] Für die Telemedien wurde 1997 die Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia [fsm] gegründet. Allerdings wird verschiedentlich betont [z.B. (Richard: 2001) und (Hausmanniger: 2003)], dass in ihr nur ein Bruchteil der Anbieterinnen und Anbieter in diesem Bereich beigetreten sind. Bei anderen Medienformen sei die Quote höher. Allerdings ist fraglich, ob diese Aussage zur Bewertung der Arbeit der fsm etwas beiträgt.
[6] Was sich bekanntlich auch auf die Infrastruktur auswirkt, in/auf der Daten gespeichert und zur Verfügung gestellt werden können.
[7] Das sollte nicht als Verteidigung nicht-westlicher Kulturen verstanden werden. Deren Moralvorstellungen, die sich im Jugendschutz niederschlagen würden, sind meist noch konservativer und menschenverachtender, als die europäischen oder us-amerikanischen/kanadischen/australischen. Fakt wäre aber, dass ein internationaler Jugendschutz entweder zwingend gegenüber anderen Kulturen auftreten müsste oder aber so flexibel zu sein hätte, dass seine Wirksamkeit bezweifelt werden kann.
[8] Snuff-Videos sollen die reale grausame Tötung eines Menschen darstellen. Bisher scheinen nur Fälschungen aufgetaucht zu sein. Das hält allerdings solche unverantwortlichen Autoren wie Rainer Richard [Richard: 2001] nicht davon ab das Internet als Sündenpfuhl voller Pornographie, Gewalt, Rechts- und Linksextremismus zu zeichnen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Jugendschutz als Verfassungsrecht in Deutschland?
Der Jugendschutz ist in Deutschland ein Verfassungsrecht, das sich aus Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes ergibt. Diese Artikel gewährleisten das Recht auf freie Persönlichkeitsentfaltung und die Pflicht der Eltern zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Der Jugendschutz kann jedoch die Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit (Artikel 5 GG) einschränken.
Welche Gesetze bilden die gesetzlichen Grundlagen des Jugendschutzes?
Die wichtigsten Gesetze sind das Jugendschutzgesetz (JuSchG), der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV), das Strafgesetzbuch (insbesondere das Sexualstrafrecht §§174 - §184c StGB) und das Achte Buch des Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe). Auch die UN-Konvention über die Rechte des Kindes und das EU-Grünbuch über den Jugendschutz spielen eine Rolle, obwohl die UN-Konvention noch nicht vollständig ratifiziert ist.
Was sind die spezifischen Ausführungen zum JuSchG und JMStV bezüglich verbotener Inhalte?
Der JMStV definiert verbotene Angebote als solche, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen darstellen, Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstacheln, Verbrechen des Nationalsozialismus verleugnen oder verharmlosen, den Krieg verherrlichen, zu rechtswidrigen Taten anleiten, Gewalttätigkeiten verherrlichen oder verharmlosen, gegen die Menschenwürde verstoßen oder Pornographie und Gewalttätigkeiten mit Kindern und Tieren darstellen. Für Kinder und Jugendliche sind Pornographie sowie Angebote, die ihre Entwicklung oder Erziehung schwer gefährden, untersagt.
Welche Rolle spielt die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)?
Die BPjM überprüft Medien und kann Indizierungen veranlassen, wenn diese jugendgefährdend sind. Indizierte Medien dürfen Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich gemacht, noch dürfen sie verkauft oder für sie geworben werden. Die BPjM kann seit 2003 auch selbst aktiv werden und muss nicht mehr nur auf Anträge staatlicher Institutionen hin tätig werden. Zusätzlich wurde die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) eingerichtet, die Werte festlegt, an denen sich die BPjM orientiert.
Welche Probleme gibt es bei der Durchsetzung des Jugendschutzes im Internet?
Das größte Problem ist die Internationalität des Internets. Daten können in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Rechtskulturen gespeichert und verbreitet werden. Internationale Regelungen sind schwierig umzusetzen, da unterschiedliche Kulturen verschiedene Moralvorstellungen haben. Indizierungen und Verbote können oft umgangen werden. Medienkompetenz der Kinder und Jugendlichen wird als eine Lösung angesehen.
Was ist Medienkompetenz im Kontext des Jugendschutzes im Internet?
Medienkompetenz ist die Fähigkeit, Medien kritisch zu analysieren und reflektieren sowie sie im Kontext selbstbestimmten und sozialen Handelns zu nutzen. Sie schließt die Fähigkeit ein, sich von desorientierten Medieninhalten abzuwenden und ihnen den Konsumakt zu entziehen.
Welche Rolle spielen öffentliche Bibliotheken beim Jugendschutz im Internet?
Bibliotheken sind Orte, an denen Medienkompetenz vermittelt werden kann. Sie müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie sie Jugendschutz im Internet gewährleisten können, da sie oft Internetzugänge anbieten. Wichtig ist es, die Haftungsfrage zu klären und Ängste abzubauen. Empfehlungen sind die Festlegung der Haftungsfreiheit in der Nutzungsordnung, Zugangsbeschränkungen nach Alter und die zentrale Aufstellung der Rechner, um sozialen Druck auszuüben. Filtersoftware und abgeschottete Netze für Kinder haben sich bisher weniger bewährt.
- Quote paper
- Karsten Schuldt (Author), 2005, Jugendschutz & Internet @ Öffentliche Bibliotheken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109511