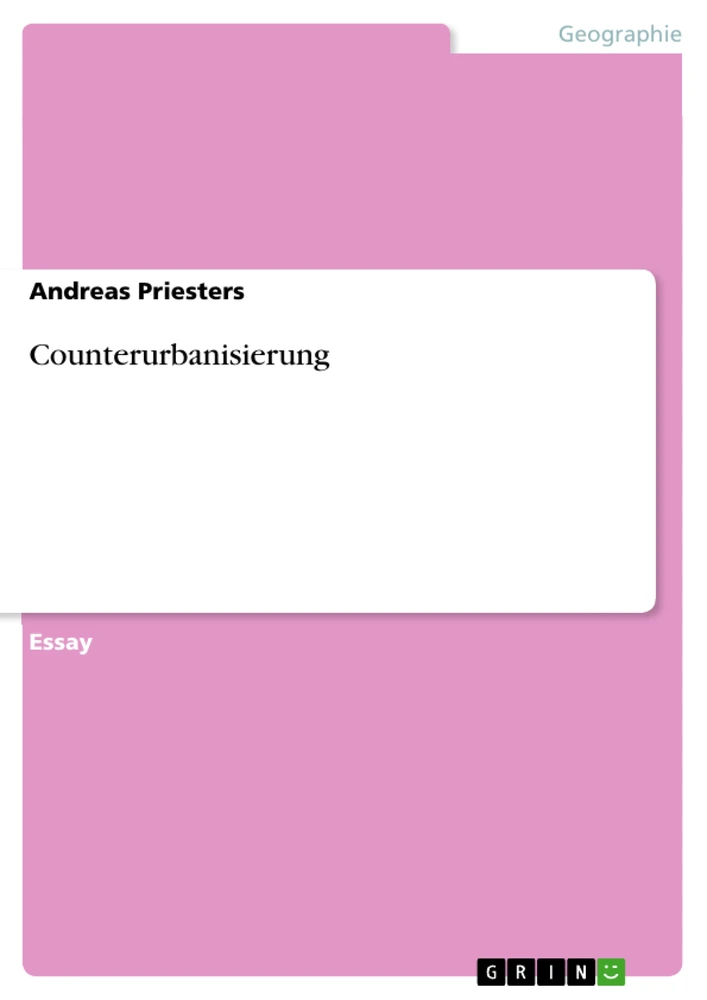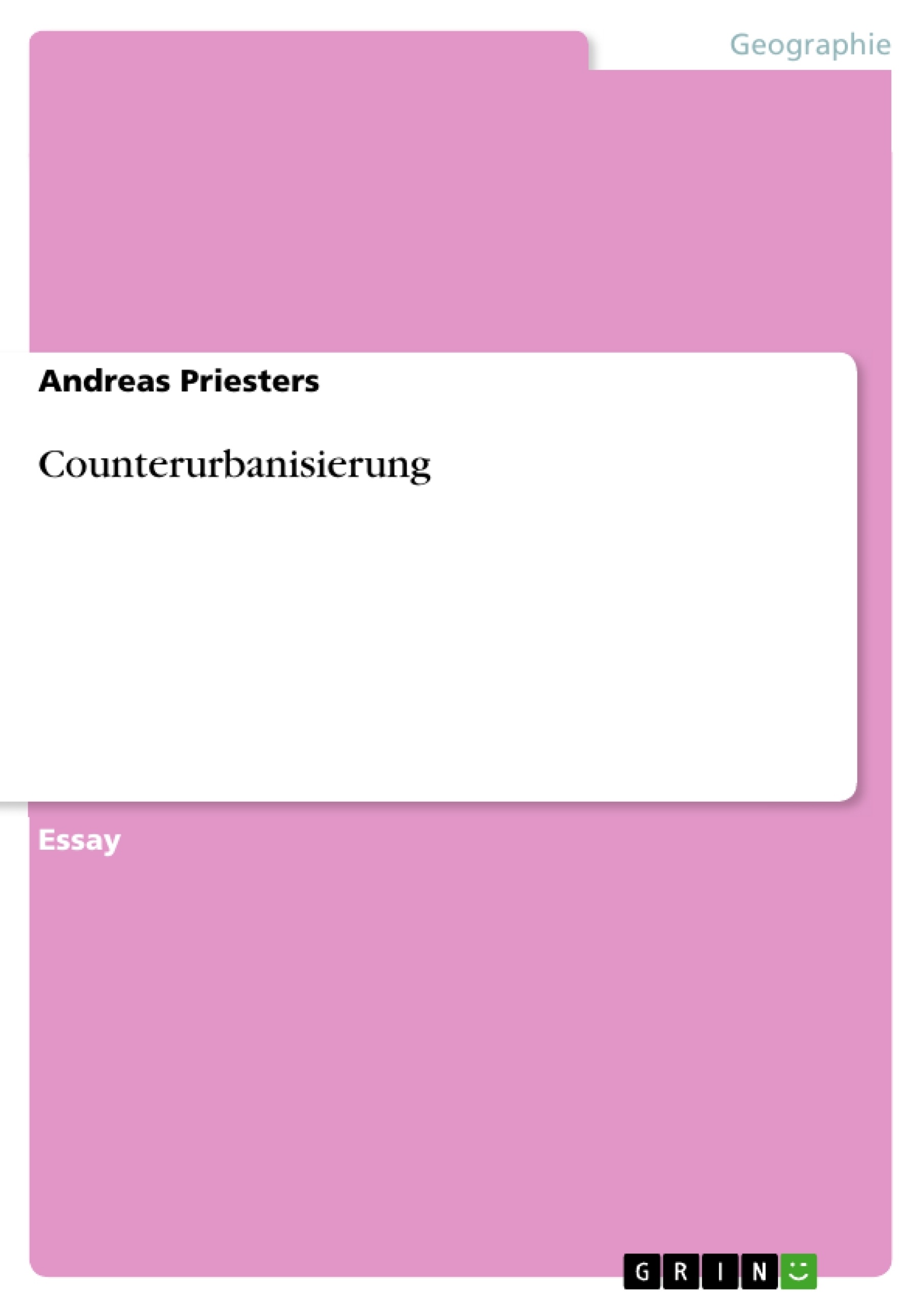Counterurbanization wird als Prozess der Dekonzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen in einem Großraum definiert. Dieser Prozess ist eine Folge von Abwanderungen aus Großstädten und Agglomerationsräumen bei einem gleichzeitigen Wanderungsüberschuss in ländliche und kleinstädtische Gebiete.
Counterurbanisierung ist in Ansätzen in einigen stark urbanisierten Industriestaaten zu beobachten und wird als Reaktion auf die Überlastung von Verdichtungsräumen gedeutet.
Entstehung der Counterurbanization-These
Nach der Phase der Urbanisierung in den heutigen entwickelten Industrieländern bis etwa 1950 und später sowie einem demografischen und wirtschaftlichen Boom in Städten und Agglomerationsräumen, setzte ein allmählicher Trend zur Umkehrung dieser Migration ein.
Bis dahin galt der ländliche Raum als strukturschwach und benachteiligt. Schlechte Erreichbarkeit, Mangel an qualifizierten bzw. ausreichendem Personal oder keine ausreichende Infrastruktur bestimmten die ländlichen Regionen. Ebenso waren die Perspektiven für die Bewohner qualitativ und quantitativ schlechter, z.B. das Angebot an Arbeitsplätzen oder Freizeitmöglichkeiten. Betrachtet man die städtischen Hierarchiestufen, also große, mittlere und kleine Städte, so gewinnen in der Urbanisierungsphase hauptsächlich die großen Agglomerationsräume an Einwohnern dazu. Bedingt durch die Land-Stadt gerichtete Migration verlieren v.a. periphere Räume und später auch kleinere Städte an Bewohnern und Potential, u.a. verlieren diese Orte ihre Funktion als Umlandversorger.
1993 erstellen Geyer und Kontuly das Modell der "differential urbanization", das an die Urbanisierungsphase anknüpft und schließen dieser zwei spätere Phasen an. In der Phase der "polarization reversal" kehrt sich die bisherige Migrationsbewegung in den Ballungsräumen um. Während hier die Bevölkerungszahlen abnehmen wachsen u.a. die Städte mittlerer Größe und verzögert schließlich auch die kleineren Zentren stark an. Als dritte und jüngste Phase wird die Counterurbanization genannt, die stärksten Wanderungsgewinne weisen hier kleine Städte auf, große verstädterte Räume weisen sogar negative Bilanzen auf.
Counterurbanization
Gliederung:
1. Definition
2. Entstehung der Counterurbanization-These
3. Erklärungsansätze
4. Auswirkungen
5. Kritik
6. Fazit
Definition:
Counterurbanization wird als Prozess der Dekonzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen in einem Großraum definiert. Dieser Prozess ist eine Folge von Abwanderungen aus Großstädten und Agglomerationsräumen bei einem gleichzeitigen Wanderungsüberschuss in ländliche und kleinstädtische Gebiete.
Counterurbanisierung ist in Ansätzen in einigen stark urbanisierten Industriestaaten zu beobachten und wird als Reaktion auf die Überlastung von Verdichtungsräumen gedeutet (Leser 1997).
Entstehung der Counterurbanization-These
Nach der Phase der Urbanisierung in den heutigen entwickelten Industrieländern bis etwa 1950 und später sowie einem demografischen und wirtschaftlichen Boom in Städten und Agglomerationsräumen, setzte ein allmählicher Trend zur Umkehrung dieser Migration ein.
Bis dahin galt der ländliche Raum als strukturschwach und benachteiligt. Schlechte Erreichbarkeit, Mangel an qualifizierten bzw. ausreichendem Personal oder keine ausreichende Infrastruktur bestimmten die ländlichen Regionen. Ebenso waren die Perspektiven für die Bewohner qualitativ und quantitativ schlechter, z.B. das Angebot an Arbeitsplätzen oder Freizeitmöglichkeiten. Betrachtet man die städtischen Hierarchiestufen, also große, mittlere und kleine Städte, so gewinnen in der Urbanisierungsphase hauptsächlich die großen Agglomerationsräume an Einwohnern dazu. Bedingt durch die Land-Stadt gerichtete Migration verlieren v.a. periphere Räume und später auch kleinere Städte an Bewohnern und Potential, u.a. verlieren diese Orte ihre Funktion als Umlandversorger.
1993 erstellen Geyer und Kontuly das Modell der „differential urbanization“, das an die Urbanisierungsphase anknüpft und schließen dieser zwei spätere Phasen an. In der Phase der „polarization reversal“ kehrt sich die bisherige Migrationsbewegung in den Ballungsräumen um. Während hier die Bevölkerungszahlen abnehmen wachsen u.a. die Städte mittlerer Größe und verzögert schließlich auch die kleineren Zentren stark an. Als dritte und jüngste Phase wird die Counterurbanization genannt, die stärksten Wanderungsgewinne weisen hier kleine Städte auf, große verstädterte Räume weisen sogar negative Bilanzen auf (Bähr 2004: 81, siehe Abbilung 1)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Beschreibungsmodell interregionaler Konzentration und Dekonzentration im Verlauf des Verstädterungsprozesses (aus: Bähr 2004: 81)
Die These der counterurbanization wurde erstmals von Berry 1976 aufgestellt, nachdem vor allem in den USA in den 70er Jahren die Beobachtung gemacht wurde, dass die Ballungsräume und Großstädte nicht nur Bewohner an die Peripherie der Verdichtungszonen (Suburbanisierung), sondern auch an Mittel- und Kleinstädte außerhalb des Einzugsgebietes verloren (Schmied 2000: 20).
1977 erstellten Vining und Kontuly eine Studie, die in Europa ebenfalls eine großräumige Bevölkerungsdekonzentration beobachtete (Kiehl, Panebianco, 2002: 2).
Bereits Berry postulierte angesichts dieser Entwicklung den „population“- oder „urban turnaround“, also eine komplette Umkehr der bisherigen Land-Stadt-Migration. Zwar haben die Agglomerationsräume durch Sub- und Counterurbanisierung teilweise ein negatives Wachstum, aber eine einheitliche Tendenz lässt sich v.a. aktuell in den Industrieländern nicht nachweisen (Schmied 2000: 20)
In Großbritannien ist die stärkste Phase der Counterurbanization in den 70er Jahren nachzuweisen, nach einer wirtschaftlichen Baisse 1990 und dem Zusammenbruch des teilweise spekulativen Häusermarktes erfolgte eine starke Reduzierung der Migrationshäufigkeit. Heute ist man der Meinung, die Counterurbanization hält weiter an, gleichzeitig haben sich die Verluste der großen Ballungszentren aber abgeschwächt. Viele Autoren sind daher auch der Meinung, dass das Ganze ein zyklischer Prozess ist, der von Wohnungsmarkt und Wirtschaft abhängig ist (Schmied 2000: 22).
Erklärungsansätze und regionale Beispiele
Generell ist das gegenwärtige Forschungsbild zur Counterurbanisierung bzw. zu allgemeinen Migrationstendenzen sehr differenziert. In den USA ist in den 70er und 90er Jahren ein Trend zur Counterurbanisierung festzustellen, während in den 80ern die „metropolitan areas“ erneut einen Wachstumsschub zu verzeichnen hatten (Bähr 2004: 83, siehe Abb.2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2: Die Tabelle zeigt die Unterschiede bei der Be-völkerungszunahme in den metropolitan und non-metropolitan Areas in den USA, stark schwankende Werte der nonmetropolitan Areas: 13,3%-2,6%-10,2% (aus: Bähr 2004: 82)
In der EU zeigen Untersuchungen im ländlich-peripheren Raum, dass es nach wie vor schwach strukturierte Gebiete gibt, aber ebenso ausgesprochene Wachstumsregionen zu finden sind, die teilweise sogar mehr Arbeitsplätze schaffen als der jeweils nationale Durchschnitt. Die jüngeren Phasen des Verstädterungsprozesses bedeuten also keine grundsätzliche Trendumkehr, sondern sie zeichnen sich durch zeitliche Schwankungen und regionale Unterschiede aus (Bähr 2004: 83)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3: Relative Beschäftigtenzahlen nach Regionstypen.
Der Ländliche Raum gewinnt gegenüber den Städten und Agglomerationsräumen an Bedeutung, trotzdem finden sich mehr Abweichungen innerhalb der Gruppe als zwischen den Regionstypen, z.B. starke ländliche Region mit bis zu 22% positivem oder 32% negativem Wachstum (aus: Kiehl, Panebianco 2002: 7)
In der Forschung sind in jüngerer Zeit zwei weitere Begriffe hinzugekommen: Eine counterurbanization cascade findet man, wenn „jede Ebene der Siedlungshierarchie von der nächstgrößeren gewinnt, aber an die nächstkleinere verliert“ (Schmied 2000: 20). Bei der internationalen Counterurbanization wandern Migranten über nationale Grenzen hinweg in ländliche Räume anderer Länder ziehen, z.B. vom südlichen England nach Frankreich (Schmied 2000: 21).
Bei den Erklärungsansätzen der Counterurbanisierung wird häufig zwischen strukturellen Veränderungen und individuellen Präferenzen unterschieden. Die ländlichen Gebiete haben durch Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur (Straßennetz) einen besseren Anschluss an die Pendlereinzugsbereiche. Die Restrukturierung des skundären und tertiären Sektors führte zudem zu einer Verlagerung von Betrieben aus den teuren Ballungszentren heraus. In ländlichen Gebieten gibt es günstige Flächen und nichtorganisierte Arbeitskräfte, zudem wird durch die EU gefördert. Auch bieten z.B. ehemalige Agrarbetriebe Gebäude, die sich kostensparend zu modernen Betrieben umgestalten lassen (Schmieden, Stallungen etc.).
Moderne Kommunikationstechnologien wie Internet ermöglichen eine gewisse räumliche Unabhängigkeit (Teleworking), womit auch das Pendeln überflüssig wird. Teilweise geht man von einem Drittel der Emigranten aus, bei dem ein Haushaltsmitglied von zuhause aus arbeitet. Typische Berufsfelder sind Berater (Management), Immobilienhändler, Mitarbeiter der Medienbranche etc.
Bolton und Chalkey führten in North Devon, östliches Cornwall, eine Befragung durch, bei der die typischen Stereotypen der Landflüchtler, also Rentner, Langstreckenpendler und „Zurück-aufs-Land“ Lebensvorstellungen nicht bestätigt wurden. Eine weitere Befragung in West Cornwall zeigte, dass die Migranten mit 43,3 % im Vergleich zu den Einheimischen und Rückkehrern den größten Anteil der Bewohner darstellen. In kleineren Marktorten findet man aber einen höheren Anteil an über 60jährigen, da hier die institutionelle Infrastruktur gegeben ist, auf die diese angewiesen sein könnten, z.B. ärztliche Versorgung oder Einkaufsmöglcihkeiten vor Ort. Der Großteil der Immigranten ist überdurchschnittlich qualifiziert und verhältnismäßig wohlhabend. Der ländliche Raum, der für harmonische Idylle, erprobte und traditionelle, auch religiöse Werte steht, konkurriert mit der hektischen Großstadt. Zumindest wird dieses Image auch durch die Medien unterstützt. Vor allem in Großbritannien steht die countryside aber auch traditionell in hohem Ansehen, da von jeher der Wohnsitz der Mächtigem auf dem Land war und jeder, der zu Geld kam musste einen Sitz auf dem Land besitzen, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden (Schmied 2000: 24). Daher ist der Umzug in eine reizvolle Landschaft einer der häufigst genannten Begründungen für die Migration (www.kontressowitz.de). Weitere Individuelle Präferenzen sind die nach Ansicht vieler Städter höhere Lebensqualität auf dem Land und die dort gegebenen Freizeitmöglichkeiten, besonders outdoor -Aktivitäten.
Ebenso gilt aber auch eine neuartige Teilung: Wohnen auf dem Land und selektives Teilnehmen am städtischen Leben (z.B. Einkaufen, Kultur etc.), bezeichnet auch als „rural way of life“ (Schmied 2000: 24).
Auswirkungen
Die Folgen der Counterurbanization sind regional unterschiedlich. Die Gruppe der Immigranten erhöhten Alters ist sehr prägend, da man vielerorts Alten- und Altenpflegeheime sowie betreutes Wohnen anbietet, teilweise werden sogar Senioren-Siedlungen für gehobene Wohnansprüche errichtet. Demgegenüber steht eine teilweise Abwanderung der jungen Bevölkerung was zu einer Konzentration von Senioren führt (bis zu 21%, englischer Durchschnitt ist 18%). Ebenso wird häufig der Begriff der ländlichen Gentrifikation gebraucht, da die oft wohlhabenden Migranten sozial niedriger gestellte Haushalte verdrängen. Beispielsweise werden in Naturparks o.ä. keine Neubauten in Dörfern zugelassen, um die historische gewachsene Struktur nicht zu verändern. Da diese cottages oder alten Bauernhäuser, Fischerhäuser etc. bei den Neusiedlern sehr beliebt sind, werden durch die Preissteigerungen die Einheimischen Bewohner allmählich verdrängt. Typischerweise wird die alte Baustruktur von den Migranten aufgewertet und dadurch nochmals im Wert gesteigert. Das Angebot von Sozialwohnungen etc. hat sich dadurch auf dem sowieso knappen ländlichen Markt verschlechtert. Zweitwohnungs- und Ferien-hausbesitzer verstärken diese Effekte noch, da sie nur zeitweilig auf dem Land wohnen, aber trotzdem um Häuser konkurrieren. Problematisch sind weiterhin die Verdrängung von Einheimischen aus lokalen Institution, da die Hinzugezogenen meist ein hohes Engagement aufweisen und somit auch schnell bei Entscheidungsprozessen Mitspracherechte haben. Möchten die Einheimischen beispielsweise ein Gewerbegebiet zur Verbesserung der lokalen wirtschaftlichen Situation ausweisen, fürchten die Immigranten um die Lebensqualität ihrer neuen Umgebung –es kommt zu Auseinandersetzungen. Die Neusiedler besitzen meist einen größeren Aktionsradius als Einheimische, d.h. sie sind weniger auf Angebote der Wohn- und Nachbarorte angewiesen (z.B. Schule, Dorfladen, Arzt), weshalb die Zahl der Einrichtungen seit den 70er Jahren rapide sinkt. Im Gegenzug allerdings beteiligen sich die Hinzugezogenen bei Kampagnen zur Rettung solcher Dorfinstitutionen, oder bieten ihre ehrenamtliche Hilfe an (Schmied 2000: 25f).
Kritik
Die Theorien und Beobachtungen zur Counterurbanization sind nicht eindeutig. Es gibt sehr viele Aspekte, die beachtet werden müssen, aber nicht immer möglich sind, z.B. fehlende oder unregelmäßige Bevölkerungszählungen, unzureichende Ver-gleichsmöglichkeiten oder formale Ungenauigkeiten, z.B. Abgrenzungen von städtischen und ländlichen Gebieten in unterschiedlichen Staaten. Ebenso ist es schwierig, eine genaue Grenze zwischen Suburbanisierung und Desurbanisierung zu ziehen. In Deutschland wird eher der Begriff der Suburbanisierung ausgeweitet, in England nutzt man eher Counterurbanization, obwohl der Nachweis der Eigenständigkeit kleiner Siedlungszentren gegenüber den Ballungsräumen nicht nachweislich erbracht sein muss (Schmied 2000: 21). Außerdem könnte die fortschreitende Ausdehnung der Städte fälschlicherweise als neuer Entwicklungstrend gesehen werden, weil die Ballungsräume nur ungenau begrenzt sind. Zudem erschwerend für die Forschung sind die regional völlig unterschiedliche Prozesse, in Finnland ist die „differential urbanization“ mit den drei Phasen (s.o.) bereits abgeschlossen und beginnt bereits mit einer neuen Verstädterung, während in Großbritannien kurzfristige Schwankungen und Brüche die Abfolge sehr kompliziert erscheinen lassen. In anderen Ländern ist bis heute fast keine Counterurbanization festzustellen, z.B. Italien. In Deutschland wäre die Theorie der Counterurbanization auf die alten Bundesländer anwendbar, in den Neuen findet dagegen eher ein Urbanisierungsprozess statt und die ländlichen Regionen verlieren stark an Einwohnern (Bähr 2004: 83).
Fazit
Counterurbanization ist ein Prozess der Dezentralisierung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen, der allerdings nicht als allgemeine Tendenz angesehen werden kann, da zu viele Faktoren die Migrationsprozesse beeinflussen und die Regionalen Unterschiede zu groß sind. Dabei geht die Counterurbanization über die Grenzen der agglomerationsnahen Peripherie hinaus. Meist Wohlhabende Städter ziehen in möglichst reizvolle ländliche Gebiete, was dort zur Verdrängung und teilweise zu Konflikten mit Einheimischen führt. Zu Beobachten bleibt die zukünftige Entwicklung. Ob die Counterurbanization weiter anhält, zu einem ländlichen Wohnungsmangel v.a. in England führt und in wieweit die ländlichen Siedlungen überformt werden wird sich zeigen.
Literatur:
- Bähr, J. (2004): Bevölkerungsgeographie, 4. Auflage, Stuttgart
- Leser, H. et.al. (1997): DIERCKE - Wörterbuch Allgemeine Geographie, 12. Auflage, München
- Steinicke, E. (2000): Counterurbanization in der kalifornischen Sierra Nevada. Das Hochgebirge als neuer Siedlungsraum. In: DIE ERDE, Heft 131, S. 107-124
- Schmied, D. (2000): Counterurbanisierung und der ländliche Raum in Großbritannien. In: Geographische Rundschau, Heft 3211, S. 20-26
Internet:
- Kiehl, M. und S. Panebianco (2002): Counterurbanization in Westeuropa. Abrufbar unter: http://www.raumplanung.uni-dortmund.de/rwp/DokuRwp00/2003,03,07%20%20%20%20Artikel%20Hermagor.pdf, 28.12.2004
Häufig gestellte Fragen zu Counterurbanization
Was ist Counterurbanization?
Counterurbanization ist ein Prozess der Dekonzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen aus Großstädten und Agglomerationsräumen in ländliche und kleinstädtische Gebiete. Es handelt sich um eine Verlagerung, bei der mehr Menschen aus städtischen Zentren abwandern als in sie einwandern.
Wie ist die Counterurbanization-These entstanden?
Nach der Urbanisierungsphase, in der Städte und Agglomerationsräume stark wuchsen, beobachtete man eine allmähliche Umkehr dieser Migration. Ländliche Räume galten zuvor als strukturschwach. Geyer und Kontuly entwickelten das Modell der "differential urbanization", das die Phasen der Urbanisierung, "polarization reversal" (Umkehr der Polarisation) und Counterurbanization beschreibt. Berry stellte die These der Counterurbanization 1976 auf, nachdem in den USA die Abwanderung aus Ballungsräumen beobachtet wurde. Vining und Kontuly bestätigten diese Entwicklung auch in Europa.
Welche Erklärungsansätze gibt es für Counterurbanization?
Die Erklärungen lassen sich in strukturelle Veränderungen und individuelle Präferenzen unterteilen. Strukturelle Veränderungen umfassen verbesserte Verkehrsinfrastruktur, Verlagerung von Betrieben aus teuren Ballungszentren, günstige Flächen und nichtorganisierte Arbeitskräfte in ländlichen Gebieten sowie EU-Förderung. Moderne Kommunikationstechnologien wie das Internet ermöglichen Telearbeit und räumliche Unabhängigkeit. Individuelle Präferenzen umfassen den Wunsch nach höherer Lebensqualität, Freizeitmöglichkeiten (besonders Outdoor-Aktivitäten) und ein harmonisches, traditionelles Leben auf dem Land.
Welche Auswirkungen hat Counterurbanization?
Die Folgen sind regional unterschiedlich. Es kann zu einer Zunahme älterer Bevölkerungsgruppen und dem Bau von Seniorenheimen kommen. Gleichzeitig kann es zu einer Abwanderung junger Menschen kommen. "Ländliche Gentrifikation" kann auftreten, wenn wohlhabende Zuwanderer sozial schwächere Haushalte verdrängen und die Immobilienpreise steigen. Es kann zu Konflikten zwischen Neuankömmlingen und Einheimischen über die Nutzung und Entwicklung des ländlichen Raums kommen.
Welche Kritik gibt es an der Counterurbanization-Theorie?
Die Beobachtungen sind nicht immer eindeutig und werden durch fehlende oder unregelmäßige Bevölkerungszählungen, unterschiedliche Abgrenzungen von städtischen und ländlichen Gebieten in verschiedenen Ländern und die Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Suburbanisierung und Desurbanisierung erschwert. Regionale Unterschiede und kurzfristige Schwankungen erschweren die Analyse zusätzlich. In einigen Ländern ist Counterurbanization kaum festzustellen, während in anderen bereits eine erneute Verstädterung einsetzt.
Was sind die Schlussfolgerungen zum Thema Counterurbanization?
Counterurbanization ist ein Prozess der Dezentralisierung von Bevölkerung und Arbeitsplätzen, der nicht als allgemeine Tendenz betrachtet werden kann, da zu viele Faktoren die Migrationsprozesse beeinflussen und die regionalen Unterschiede zu groß sind. Wohlhabende Städter ziehen in reizvolle ländliche Gebiete, was dort zur Verdrängung und teilweise zu Konflikten mit Einheimischen führt. Die zukünftige Entwicklung bleibt abzuwarten.
- Quote paper
- Andreas Priesters (Author), 2004, Counterurbanisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109509