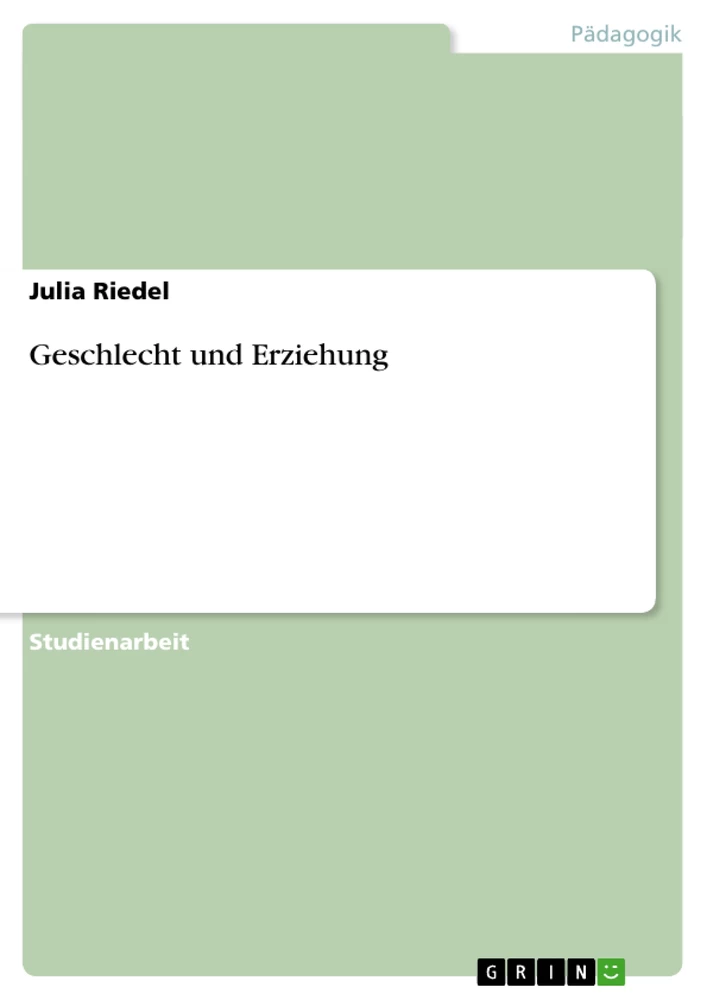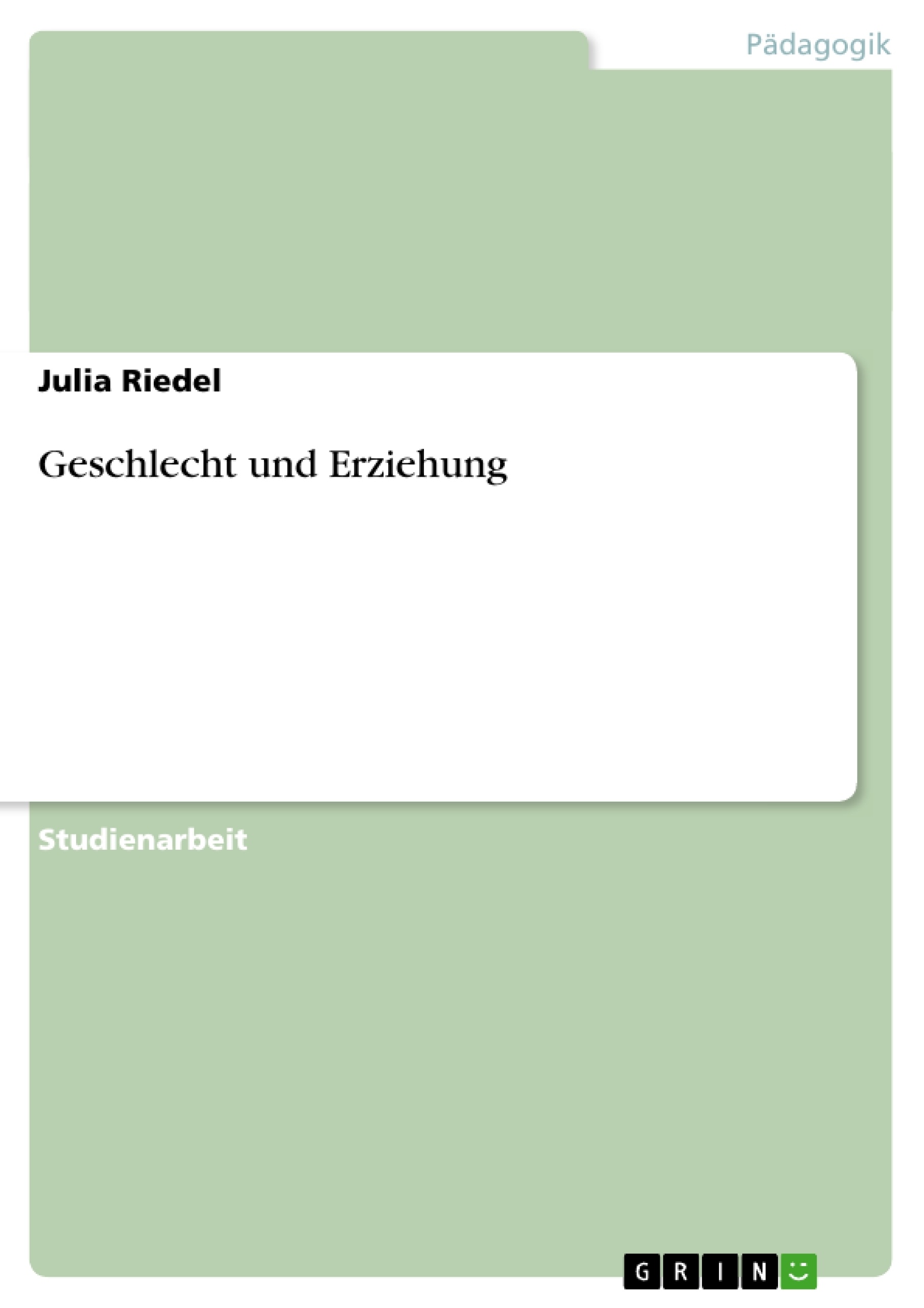Die Bedeutung des Geschlechts für die Erziehung
Bei der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen sind Pädagogen im Laufe der Geschichte immer wieder auf problematische Ansätze gestoßen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Problemen, die von Geschlechtsunterschieden im Laufe der Schullaufbahn verursacht werden, sowie mit verschiedenen Lösungsansätzen. Grundlage für diese Arbeit waren der Aufsatz „Geschlecht und Erziehung“ von Hannelore Faulstich-Wieland sowie die Veröffentlichung „’Trennt uns bitte, bitte, nicht!’“ von Hannelore Faulstich-Wieland und Marianne Horstkemper. Zunächst beschäftige ich mich mit den Veränderungen, die im Laufe der letzten fünfzig Jahre unsere Gesellschaft sowie unser Bildungssystem beschäftigt haben, um mich im Anschluss den modernen Lösungen sowie ihren Bewertungen zu widmen.
In meinen Augen ist neben der Kernfrage, wie sich die Ansichten in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt, im Streit um die Bedeutung von Geschlecht in der Erziehung auch wichtig, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf unsere heutige Schulbildung haben oder zukünftig haben sollten. Dies soll auch in dieser Arbeit näher beleuchtet werden.
Wenn im Zusammenhang mit Erziehung das Wort „Geschlecht“ erwähnt wird, denken die meisten Menschen automatisch an die Emanzipationsbewegungen der 1960er und 70er Jahre. Daher werden Frauen und Mädchen automatisch als die bisher benachteiligten Mitglieder der Bevölkerung angesehen. Dies wird durch verschiedene Studien belegt, die besagen, dass Mädchen weniger von Naturwissenschaften und Technik verstehen als Jungen. Die weithin bekannten Gründe dafür werden im Folgenden aufgezeigt. Doch wie viel davon ist wahr?
Problematik und Lösungsansätze
Zu Beginn der 1960er Jahre begann eine Debatte um die Bildungsbenachteiligung der Mädchen, die bis heute nicht vollständig abgeklungen ist. Die grundliegendsten Veränderungen, die seitdem stattgefunden haben, wurden bereits gefordert, als die Bildungsdebatte noch in den Kinderschuhen steckte. Hauptaspekt dabei war, dass Mädchen in Zukunft nicht länger vom Unterricht in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern ferngehalten werden sollten. Als es noch die Unterscheidung zwischen dem Gymnasium als einer reinen Jungenschule und dem Lyzeum für Mädchen gab, wurde dort die Fächerzuteilung ebenso wie an Volks- und Realschulen nach Geschlecht vorgenommen. Jungen erhielten separaten Unterricht in Chemie, Physik, Mathematik und Technik, während die Mädchen in Fächern wie Handarbeit und Hauswirtschaft für sich waren. Diese Hierarchie gründete auf dem damals aktuellen gesellschaftlichen Modell, das den Mann an die Arbeit, die Frau jedoch als Hausfrau an den Herd schickte.
Im Zuge der Bildungsdebatte begann man in den 1970er Jahren, die frauenbenachteiligenden Strukturen zu analysieren und aufzudecken, mit dem Ziel, die zu beheben. Damit sollte der gesellschaftliche Androzentrismus, die Ausrichtung auf den Mann, überwunden werden. Um dies zu erreichen, versuchte man, eine „gender-free education“[1] durchzusetzen. Da dieser Begriff aus den USA stammt, gab es in Deutschland allerdings keine festen Vorgaben, was damit gemeint war. Fest stand lediglich, dass das Geschlecht in die Erziehungswissenschaften einfließen musste – es war nur nicht bekannt, wie. Die deutschen Lehrer wählten den Weg, der am nächsten lag: Fortan ignorierten sie die geschlechtlichen Unterschiede ihrer Schüler. Gender-free education wurde also wörtlich als geschlechterfreie Erziehung durchgesetzt; dies hatte jedoch keinen Einfluss auf die androzentrischen Strukturen der Gesellschaft.
Als Folge dessen machten die Erziehungswissenschaftler sich klar, welche Ansatzpunkte wichtig waren, um wirklich geschlechterfreien Unterricht verwirklichen und somit über kurz oder lang auch eine geschlechterfreie Gesellschaft durchsetzen zu können. Dafür mussten sie sich zunächst klarmachen, wie man überhaupt einen Menschen erzieht, welche Bedeutung Geschlecht für die Erziehung hat und wie Geschlecht gebildet wird.
Im Zuge der Bildungsreformen in den 1960er Jahren wurde in Deutschland die Koedukation von Mädchen und Jungen eingeführt. Dies beinhaltete einheitliche Lehrpläne, sodass Mädchen fortan nicht mehr von Mathematik und Naturwissenschaften ausgeschlossen waren. In der Theorie war dieses Konzept sehr erfolgversprechend, da es z. B. in der DDR bereits effektiv praktiziert wurde. Für die Praxis in der Bundesrepublik bewahrheitete sich das jedoch nicht, blieben Mädchen und Frauen doch trotz ihrer besseren schulischen Ausbildung weiterhin von den sog. „Männerberufen“ ausgeschlossen. Im Berufsleben und auf der Karriereleiter wurden Männer weiterhin bevorzugt, wofür die Vorgesetzten sogar diverse Gründe nennen konnten, wie die Gefahr, dass Frauen aufgrund einer Schwangerschaft und anschließenden Mutterschaftsurlaubs ihre Jobs – ggf. in Führungspositionen - nicht langfristig ausfüllen können.
Die Tatsache, dass die veränderte Ausbildung allein nicht ausreichte, um Mädchen zur Gleichberechtigung zu verhelfen, rief eine neue Frauenbewegung ins Leben. Nun sollte auf die Mädchen mehr Aufmerksamkeit gerichtet werden, da den Lehrkräften an Schulen bislang nicht klar gewesen war, dass sie 66 % ihrer Aufmerksamkeit im normalen Unterricht auf Jungen richteten. Ebenso wird Geschlecht nicht nur durch die Lehrer, sondern insbesondere im Miteinander der Jugendlichen erzeugt. Auch wenn im Unterricht kein Wert auf die Unterscheidung von männlich und weiblich gelegt wird, so finden gerade während der Pubertät doch natürliche Unterscheidungen statt, etwa das Verlieben eines Jungen in ein Mädchen und umgekehrt[2]. Bekommen die Jungen im Unterricht darüber hinaus noch im Unterricht ein höheres Maß an Aufmerksamkeit als die Mädchen – weil sie zum Beispiel mehr stören – bleibt die alte Geschlechterhierarchie, welche eine „gender-free education“ eigentlich abschaffen möchte, trotz aller Bemühungen erhalten.
Eine weitere Überarbeitung des Konzepts für die Emanzipation stellt Geschlecht folglich nicht mehr als irrelevanten, zu ignorierenden Faktor der Erziehungswissenschaft dar, sondern legt Wert darauf, dass seine Existenz erkannt und genutzt wird. Damit effektiv davon Gebrauch gemacht werden kann, soll dem Geschlecht zukünftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.[3]
Ursprünglich legen unsere primären Geschlechtsorgane nach außen fest, wer Männlein und wer Weiblein ist. Von dieser Auffassung leiteten sich jahrelang festgesetzte Konventionen ab, wie sich ein Mann bzw. eine Frau in der Gesellschaft verhalten sollten. Die Frauenbewegung musste daher zunächst mit der veralteten Vorstellung aufräumen, das Geschlecht sei durch die Sexualität vorherbestimmt. Dass eine solche Vermutung nicht stimmt, zeigen schon die zunehmenden Zahlen Homosexueller, die sich in ihrer von Natur gegebenen Geschlechterrolle nicht wohlfühlen. Wenn man sich fragt, wie ein Homosexueller dazu kommt, sich entgegen seines natürlichen Geschlechts zu verhalten, so folgt logisch, dass ihr Geschlecht von etwas anderem als ihren Sexualorganen bestimmt wird. Weitere Untersuchungen zeigen, dass es innerhalb der Gesellschaft bestimmte Prozesse gibt, die als typisch männlich, andere jedoch als typisch weiblich gelten. So werden Härte und Aggression als männliche Charakterzüge angesehen, während Weichheit, Gefühle und soziale Sorge den Frauen zugeordnet werden.[4] Geschlecht wird folglich ständig neu hergestellt, in jeder Lebenslage, da sich kaum ein Mensch in jeder Situation völlig seinem Geschlechtsstereotyp entsprechend verhält. Wichtig ist, dass auch die Lehrer sich der Tatsache bewusst sind, dass Verhalten zumeist durch die sozialen Strukturen, in denen ein Mensch aufwächst bzw. lebt, geprägt wird. Schließlich können „zwischen Frauen unterschiedlicher Klassen [...] deshalb mehr Differenzen liegen als zwischen Frauen und Männern der gleichen Klasse.“[5]
Viele, auf alten Geschlechtskonventionen begründete Strukturen unserer Gesellschaft werden peu à peu angegriffen. Frauen arbeiten sich aus ihrer geschlechtsbegründeten Unterdrückung, die sie auf „love, marriage, baby carriage“ und das folgende Hausfrauenleben beschränkte, heraus. Dennoch beherrschen Männer nach wie vor die sog. Erwerbsarbeit, während vorwiegend Frauen auf ihren Job verzichten, um den Haushalt zu führen und die Kinder zu betreuen. Diese Struktur trägt nach wie vor zu einer Geschlechterhierarchie, die Frauen hinter Männern zurückstellt, bei.[6]
Nach den 1960er Jahren hat sich der Unterricht zugunsten der Mädchen verändert. Die Bildungsreform glich unterschiedliche Unterrichtsansätze aus, öffnete das Gymnasium für Mädchen, strukturierte die Lehrpläne neu und revolutionierte den Unterricht. Frauen erhalten seitdem eine ebenso spezifische Schulbildung wie Männer und sind nicht mehr an die typisch „weiblichen“ Fächer wie Hauswirtschaft und Handarbeiten gebunden. Im Laufe dieses veränderten Unterrichts entdeckte man, dass viele Mädchen Defizite in den früher überwiegend „männlichen“ Unterrichtsfächern (Physik, Technik, Chemie...) aufwiesen. Der Versuch, diesen Rückstand aufzuarbeiten, orientierte sich jedoch am Niveau der Jungen, sodass der Androzentrismus erneut über einer Gleichheit triumphiert hatte.
Um das zu verhindern, beschloss man einen neuen Ansatz. Fortan sollten die Fähigkeiten von Mädchen als denen der Jungen gleichwertig angesehen werden, wobei man die Tatsache ignorierte, dass Mädchen in anderen Sachen besser waren als Jungen. Für diese Auffassung spricht das Ergebnis einer empirischen Untersuchung, die Männern und Frauen unterschiedliche Denk- und Lernfähigkeiten bescheinigt. Folglich legen Frauen ihren Schwerpunkt auf der Verantwortung für andere und denken eher ganzheitlich, während Männer Moral und Gerechtigkeit sowie rationales Denken für wichtiger erachten.[7] Daraus ergibt sich, dass ein Mangel an technischem Verständnis im Unterricht nicht die Schuld der Mädchen sein kann, sondern Technik, die rein auf Rationalität aufbaut, lediglich nicht so gut in ihre moralische und kognitive Struktur passt. In Folge dessen kam es zu einer Umwertung im Geschlechterverhältnis und einem Abbau der Geschlechterhierarchie, da die früher als Schwächen angesehenen Eigenarten der Frauen künftig als ihre Stärken galten. Für die Pädagogik bedeutet das, dass die Differenz zwischen Jungen und Mädchen akzeptiert und mit ihr gearbeitet werden muss. Dies erfolgt am besten durch Schaffung getrennter Lernumfelder und einer damit einhergehenden Fokussierung der Unterschiede. Da Gleichbehandlung keine Lösung ist, soll es zum Teil sogar zu einer Umkehrung der Aufmerksamkeiten kommen, indem die Lehrer bewusster und verstärkter die Mädchen in den Unterricht einbeziehen.[8] Im Widerspruch dazu steht die Erfahrung, dass Geschlecht zum Großteil nicht durch Schüler-Lehrer-Interaktionen im Unterricht, sondern durch den Kontakt der Jugendlichen untereinander hergestellt wird. Zu diesem Punkt gibt es allerdings noch keine konkreten Untersuchungen.
Bislang sind drei Hauptfelder bekannt, die für die Entwicklung von Geschlecht in der Pädagogik entscheidend sind. Zum Einen ist das, wie bereits erwähnt, das soziale Miteinander der Jugendlichen sowie die Interaktion im Unterricht. Dazu kommt die Art und Weise, mit der die LehrerInnen ihre Unterrichts- und Erziehungsaufgabe erfüllen. Letztlich gehört auch der geschlechtsbezogene Inhalt im Fachunterricht und im normalen Schulleben, schließlich wird in vielen Fächern Bezug auf geschlechtliche Fragen genommen.
Entstehung von Geschlecht im sozialen Miteinander
In einer amerikanischen Studie erforschten Barrie Thorne und Donna Eder 1993, ob und wie Kinder in ihren sozialen Kontakten dazu beitragen, Geschlecht herzustellen. Dabei beobachteten sie vor allem das Zusammensein von Kindern in Gruppen, inwiefern durch formale und informelle Praktiken in der Schule eine Ungleichheit der Geschlechter produziert wurde. Basisannahme war, dass es Routinen und Rituale gibt, die für die Festlegung von Differenzen zwischen Männern und Frauen entscheidend sind.[9]
Auch Lehrer tragen oft dazu bei, dass Jungen und Mädchen sich ihrer geschlechtlichen Unterschiede schon im Kindergarten bewusst werden. So trennen sie ihre Klassen beispielsweise nach Geschlechtern, wenn sie sich in Reihen aufstellen müssen oder eine neue Sitzordnung in der Klasse gemacht wird. Mehr als z. B. in der Nachbarschaft, wo Kinder ohne Rücksicht auf Geschlecht miteinander spielen, weil es keine anderen Spielkameraden gibt, wird durch derartige Aktionen die Separierung von Jungen und Mädchen forciert. Dazu tragen u. a. auch Einteilungen nach Alter bei, da sich in heterogenen Altersgruppen öfter Freundschaften bilden, die neben dem Geschlecht andere Faktoren für wichtig erachten.[10]
Schulen tragen aufgrund der hohen Schülerzahlen ebenfalls dazu bei, dass Jungen und Mädchen sich getrennt aufhalten. Wo wenig Kinder zusammen sind, werden diese sich in einer Gruppe zusammenschließen. Sobald jedoch die Möglichkeit zur Separierung gegeben ist, weil für eine einzelne Gruppe zu viele Kinder da sind, liegt die Trennung nach Geschlechtern nahe.[11] Thorne stellte die Frage, wieso in den selben Verhältnissen auch gemischte Gruppen entstehen, in den Mittelpunkt seiner Forschungen. Er kam zu dem Schluss, dass die Trennlinien zwischen Männlich und Weiblich keine starren, unüberwindlichen Grenzen, sondern vielmehr kleine Zäune sind, die leicht auf- und ebenso leicht wieder abgebaut werden können. Dafür spricht auch, dass viele Kinder nicht in die Stereotypen ihres eigenen Geschlechts passen. Beispiele dafür sind wilde Mädchen und Jungen, die offen ihre Gefühle zeigen. Zu einem Großteil werden diese Kinder von ihren Schulkameraden gehänselt und verspottet, es gibt aber auch Gegenbeispiele, wo solche Kinder ohne Zögern in eine bestehende, andersgeschlechtliche Gruppe aufgenommen werden.[12]
Primar- und Orientierungsstufe
Dafür sprechen auch die Umfragen, die Hannelore Faulstich-Wieland und Marianne Horstkemper in den verschiedenen schulischen Altersgruppen durchgeführt haben. In jeder dieser Altersgruppen gibt es Stimmen für und gegen das andere Geschlecht. In der Grundschule überwiegt noch das Miteinander, in dem die Unterschiede größtenteils auf Lieblingssportarten und schulischer Leistungsfähigkeit basieren. So sagt ein Junge der 4. Klasse:
„Die Mädchen sind immer eine große Hilfe beim Spielen. Und sie haben auch gute Spielvorschläge. Im Unterricht geben sie auch manchmal einen Tip oder sagen einem wie ein Wort geschrieben wird. Das sind die Vorteile der Mädchen. Die Nachteile dagegen sind manchmal, daß sie nicht helfen. Die Jungen bringen manchmal doofe Sachen mit und benutzen blöde Ausdrücke. Die Mädchen dagegen nicht.“[13]
Während der Grundschule sehen die Kinder keine Probleme, untereinander zu helfen und miteinander zu spielen. Innere Qualitäten zählen mehr als äußere oder geschlechtliche Unterschiede. Die Mädchen werden von den Jungen hoch geschätzt, da sie geschickt und ordentlich und somit die Vorbilder der Jungen sind.
Während der Orientierungsstufe, die sich an die Grundschule anschließt und die Jahrgangsstufen 5 und 6 umfasst, stehen sich Jungen und Mädchen eher ambivalent gegenüber. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass die neue Schule und die damit verbundene Flut an neuen Reizen (neue Lehrer, andere Fächer, neue Umgebung, neue Klassenkameraden) die Kinder viel mehr beschäftigen als ihre Kontakte untereinander. Die naheliegendsten Gruppierungen werden, nach Geschlechtern getrennt, geschlossen. Die Jungen sehen auf die Mädchen herab, weil sie in ihnen Schnatterliesen, Petzen, Kichererbsen und ähnliches sehen; die Mädchen grenzen sich von den Jungen ab, die in ihren Augen Raufbolde, Krachmacher und Störenfriede sind. Dass in der Orientierungsstufe ein raues Klima herrscht, beweist das folgende Zitat:
„Es gibt natürlich auch völlige Versager. Ein Mädchen, das Übergewicht hat, ärgern wir besonders gern, weil sie so viel Speck hat und wenn sie läuft, gibt es ein Erdbeben. Ein Mädchen, das wir Lama nennen, weil es schielt, ärgern wir auch gern. Es gibt einen Schüler, den wir ‚the horse’ nennen, weil er so aussieht wie ein Pferd. Auf dem Schulhof ärgern wir die Kinder aus dem Gymnasium.“[14]
Nur wenige Kinder fühlen sich während der Orientierungsstufe hinter dem anderen Geschlecht zurückgestellt. Die Mädchen plädieren ausdrücklich für den gemeinsamen Unterricht, da in der Schule auf diese Weise der Grundstein für spätere Beziehungen gelegt werde.[15] So drastisch formulieren die Jungen ihre Wünsche zwar nicht, aber auch sie stimmen überein, dass das Übel einer neuen Schule, einer neuen Umgebung und höherer Ansprüche im Unterricht gemeinsam immerhin besser zu ertragen sei als allein. Erste erotische Kontakte und kleine Liebeleien bieten eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag, das Miteinander der Geschlechter ist zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung, sofern es gewünscht ist, durchaus eine Bereicherung.
Adoleszenz
Besonders komplex wird die Bedeutung von Geschlecht in der Pädagogik während der Adoleszenz, jener von unserer Gesellschaft kreierten Entwicklungsphase des Kindes zum Erwachsenen. Die Abgrenzung untereinander ist hier ebenso problematisch wie unerlässlich und wichtig für die Entwicklung. Das liegt größtenteils daran, dass die weibliche Pubertät früher einsetzt als die männliche und die Mädchen somit einem hohen Maß an Spott der verständnislosen Jungen ausgesetzt sind. Sie werden fast wie Behinderte behandelt, was ihnen auch soziale Nachteile einbringt. Da sie für kurze Zeit nicht mehr dem Schönheitsbild der Gesellschaft eines kleinen, zierlichen, hübschen Mädchens entsprechen, werden sie gehänselt – ein Los, das den pubertierenden Jungen in den folgenden Jahren erspart bleibt, da sich bei ihnen die Muskeln entwickeln, der erste Bart sprießt und der Stimmbruch einsetzt, was sie dem gesellschaftlichen Ideal-Mann ohne große Umwege näher bringt.[16]
Donna Eders Studie[17] besagt, dass gerade in der Pubertät Stereotypen eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, in der Interaktion zwischen Jungen und Mädchen Geschlecht herzustellen. So zeigen die zukünftigen Männer ein extrem aggressives, raues Verhalten, sind gute Sportler und machen Mädchen und schwächere Jungen fast schon rituell nieder. Fehlt diese aggressive Komponente, wird das gleichgesetzt mit fehlender Männlichkeit, die sich kein Junge gern nachsagen lassen möchte. Männliche Jugendliche dürfen keine Schwäche, also auch keine Gefühle zeigen und müssen ihre Männlichkeit in diversen Wettbewerben beweisen. Dazu gehört eine possessive Einstellung gegenüber Mädchen, die Freundin ist gleichsam dem Eigentum eines Mannes, das er vor eventuellen Rivalen zu verteidigen sucht.[18] Kurz zusammengefasst ergeben diese Stereotypen den typischen Macho, den die meisten Jungen während der Pubertät verkörpern. Dass die Mädchen in den Augen der Jungen sozusagen minderwertig oder zumindest nicht gleichberechtigt sind, zeigt die folgende Aussage eines 14jährigen:
„Außerdem gibt es keine richtige Gemeinschaft. Bei Wettkämpfen hält man schon zusammen, aber sonst ist die Beziehungskiste leer. Die Mädchen sind unter sich und die Jungen auch. Nur wenige machen eine Ausnahme: eine geht mit einem aus der 10. und eine geht mit einem aus der Klasse. Sonst ist nichts los! Auch sind sehr viele der Mädchen so eingebildet und zickig, daß sie sich anderen gegenüber abwertend verhalten.“[19]
Die Mädchen hingegen verhalten sich brav und unterwürfig. Sie sehen sich selbst als Spielzeuge der Jungen und werten somit ihr eigenes Geschlecht ab. In Amerika, wo Donna Eders Studie stattgefunden hat, sind die blonden, süßen, kleinen, zierlichen Cheerleader[20], die ständig lächeln und gut gelaunt sind, das Maß aller Dinge, der Typ Mädchen, der man sein muss, um den Jungen zu gefallen. Das ist allerdings bei weitem nicht allen Mädchen möglich. Wer nicht so perfekt sein kann wie die Gruppe Cheerleader, hat mit Vorurteilen, Hänseleien sowie der ständigen Kritik der Jungen zu kämpfen, was sich oft sehr negativ auf das Selbstbewusstsein auswirkt. Darüber hinaus begibt sich jedes Mädchen auf eine Gratwanderung zwischen unattraktiv und zu schön. Wer unattraktiv ist, wird von den Jungen und auch von manchen Mädchen verspottet; wer zu gut aussieht, zieht sich schnell den Neid der anderen Mädchen zu, die dann ihre eigene Position gefährdet sehen und die „Rivalin“ ausschalten wollen.[21]
Dass die Mädchen trotz ihrer negativen Erfahrungen in einem männerbetonten Umfeld – das die Schule ja noch immer ist – nicht ohne die Jungen sein wollen, beweist wiederum das folgende Statement einer 14jährigen Schülerin:
„In den Pausen ist es manchmal so, daß ich nur mit Mädchen zusammen hänge, aber ich bin öfters mit den Jungen zusammen; wir reden oder necken uns gegenseitig etwas. Größtenteils bin ich aber mit Jungen aus der 10. Klasse zusammen. [...] Ich finde es wichtig, daß es gemischte Schulen gibt, denn so wird man ja eigentlich ‚ans Leben gewöhnt’. Schließlich kann man ja später keine Frau heiraten und von ihr Kinder bekommen.“[22]
Hier zeigt sich, dass die Mädchen sich mit ihrer Situation, von den Jungen geneckt zu werden, abgefunden haben. Ebenso sind die Mädchen sich bereits stärker als die Jungen der Tatsache bewusst, dass Mann und Frau später einmal eine Gemeinschaft bilden werden und es deshalb wichtig ist, mit dem anderen Geschlecht auszukommen. Eine Trennung sehen die Mädchen stärker als hemmend für ihre soziale Entwicklung an als die Jungen, die diese mehr als Beschränkung ihrer sexuellen Natur empfinden.[23]
Während für die Mädchen also der Blick eher in die Zukunft geht und die Bildung einer eigenen Familie beinhaltet, steht für die Jungen die Sexualität im Hier und Jetzt klar im Vordergrund. Dies zeigt sich auch in der Doppelmoral, die während der Pubertät klar zutage tritt. Jungen, die bereits früh ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, gelten als Helden, die sich in unerforschte Territorien vorwagen. Ein Mädchen hingegen wird als „Schlampe“ oder „Hure“ etikettiert, sobald sie die starren sexuellen Grenzen überschreitet. Ein Resultat dessen, das sich besonders in den Vereinigten Staaten zeigt, ist das Verhalten der Mädchen, die sich früh einen festen Freund suchen oder sogar heiraten, um nicht in ein solches Klischee zu geraten. Wenn ein Mädchen einmal in solch eine Schublade gesteckt wurde, fällt es schwer, diese wieder zu verlassen. Wer sich gegen eine negative Etikettierung wehren will, versteht keinen Spaß und wird zusätzlich verspottet. Daher unterdrücken Frauen und Mädchen gerade in der Adoleszenz ihre persönlichen Gefühle und Bedürfnisse, um in der Gesellschaft angesehen zu werden. Dies hat zur Folge, dass die Mädchen als die Objekte der Männer angesehen werden, die im Gegensatz zu den aktiv handelnden Männern keinerlei Initiative in jegliche Richtung ergreifen.[24]
Reflexive Koedukation als Ziel für die Zukunft
Abschließend kann man festhalten, dass es nicht eine Art Frau bzw. eine Art Mann gibt. Stattdessen wird Geschlecht in der Sozialisation hergestellt und hat flexible Grenzen. Dazu gehört auch die Macht über das andere Geschlecht, die jahrzehntelang den Männern zugesprochen wurde. Sich gegen derartige Ansichten zu wehren, muss bereits in der Schule den Kindern beigebracht werden. Damit das funktioniert, gibt es gewisse Regeln, die im Unterricht einzuhalten sind.[25]
Dass eine strikte Trennung nach Geschlechtern keine dauerhafte Lösung ist, zeigen die Zitate der Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen Altersstufen ganz deutlich: trotz gewisser Auseinandersetzungen und Differenzen gehören Jungen und Mädchen doch zusammen und wollen nicht entgegen ihrer Natur voneinander getrennt sein – dann ziehen sie die kleinen, alltäglichen Reibereien in der Schule doch vor.
Barrie Thorne hat im Anschluss an seine Untersuchung des Schulalltags in den USA einige Aspekte entwickelt, welche die Stärkung der Mädchen und somit endlich die seit den 1960er Jahren geforderte Gleichberechtigung bewirken können.
Dazu ist grundlegend wichtig, dass Gruppen im Unterricht weder nach Geschlecht noch nach Herkunft oder ethnischem Hintergrund gebildet werden. Gegen ersteres kämpfen Emanzipationsbefürworter seit vierzig Jahren an, und letzteres würde eine Umstrukturierung der Machtstrukturen bewirken, die in noch höherem Maße gegen die Menschenrechte verstieße.
Weiterhin sollen die Kinder bereits früh lernen, zu kooperieren, ob sie jetzt männlich oder weiblich sind oder sich sonst irgendwie unterscheiden. Je kleiner eine solche Gruppe ist, desto höher liegen ihre Erfolgschancen.
Wichtig ist darüber hinaus, dass niemand von Aktivitäten ausgeschlossen wird, an denen er gern teilnehmen würde. Ob das bei einem Mädchen der Werkunterricht oder bei einem Jungen ein Hauswirtschaftskurs ist, darf keine Rolle spielen – nur so kann man alte, von der Gesellschaft gezogene Barrieren überwinden.
Ferner ist es unerlässlich, dass der Lehrkörper strikt und konsequent gegen Stereotypisierungen vorgeht. Da in der Gesellschaft die Auffassung des starken Mannes und unterwürfigen Mädchens tief verwurzelt ist, sind solche Machtdemonstrationen zu erwarten. Sie dürfen aber nicht gestattet werden, da ein solches Verhalten die Gleichberechtigungsversuche zunichte macht. Um richtig reagieren zu können, müssen Lehrer eingehend in Psychologie geschult werden, damit sie sowohl die Hintergründe aufdecken, wenn ein Junge sich wie ein Macho benimmt, als auch den Mädchen, die durch sexistische Bemerkungen verletzt wurden oder sich nicht trauen, ihre Gefühle offen zu legen, helfen können.[26]
Ein derart gestalteter Unterricht wird nicht sofort die Arbeitsteilung, die zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft üblich ist, abschaffen oder umkrempeln können. Allerdings dürfte es ihm möglich sein, durch die Bestärkung von Geschlechtsbewusstsein künftig zu vermeiden, dass Mädchen sich freiwillig hinter dem anderen Geschlecht zurückstellen. Das wichtigste Ziel von reflexiver Koedukation ist also nicht die Abschaffung der Geschlechter, sondern die Unterstützung, dass jeder sein individuelles Geschlecht lebt und erkennt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind.[27]
[...]
[1] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 232
[2] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 233
[3] ebd., S. 234
[4] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 235
[5] zitiert in: ebd., S. 235
[6] ebd., S. 235
[7] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 236
[8] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 236
[9] ebd., S. 237
[10] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 237
[11] ebd., S. 238
[12] ebd., S. 238
[13] zitiert in: Hannelore Faulstich-Wieland u. Marianne Horstkemper, „’Trennt uns bitte, bitte, nicht!’“, S. 53
[14] zitiert in: ebd., S. 72
[15] ebd., S. 65
[16] Hannelore Faulstich-Wieland, „Geschlecht und Erziehung“, S. 239
[17] Eder, Donna / C. C. Evans / St. Parker: School Talk, Gender and Adolescent Culture
[18] Hannelore Faulstich-Wieland, Geschlecht und Erziehung, S. 239
[19] zitiert in: Hannelore Faulstich-Wieland u. Marianne Horstkemper, „Trennt uns bitte, bitte, nicht!“, S. 87
[20] Cheerleader sind Mädchen, die während der Sportveranstaltungen der männlichen Mannschaften ihrer Schule (Basketball und Football im allgemeinen) die ZuschauerInnen animieren, die Mannschaften anzufeuern (Geschlecht und Erziehung, S. 242)
[21] Hannelore Faulstich-Wieland, Geschlecht und Erziehung, S. 240
[22] zitiert in: Hannelore Faulstich-Wieland u. Marianne Horstkemper, „Trennt uns bitte, bitte, nicht!“, S. 83
[23] ebd., S. 89
[24] Hannelore Faulstich-Wieland, Geschlecht und Erziehung, S. 240
[25] ebd., S. 241
[26] Hannelore Faulstich-Wieland, Geschlecht und Erziehung, S. 241
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Die Bedeutung des Geschlechts für die Erziehung"?
Der Text untersucht die Bedeutung von Geschlechtsunterschieden in der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen. Er beleuchtet die Probleme, die durch Geschlechtsunterschiede im Laufe der Schullaufbahn entstehen können, und diskutiert verschiedene Lösungsansätze. Dabei werden historische Veränderungen im Bildungssystem und in der Gesellschaft berücksichtigt, sowie die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die heutige Schulbildung. Die Arbeit basiert auf den Texten „Geschlecht und Erziehung“ und „’Trennt uns bitte, bitte, nicht!’“ von Hannelore Faulstich-Wieland und Marianne Horstkemper.
Welche Rolle spielten Emanzipationsbewegungen in der Debatte um Geschlecht und Erziehung?
Emanzipationsbewegungen der 1960er und 70er Jahre machten auf die Bildungsbenachteiligung von Mädchen aufmerksam. Studien zeigten, dass Mädchen vermeintlich weniger von Naturwissenschaften und Technik verstanden als Jungen, was zu Diskussionen über die Ursachen und mögliche Gegenmaßnahmen führte.
Was bedeutet "gender-free education" und wie wurde dieser Ansatz in Deutschland umgesetzt?
"Gender-free education" (geschlechterfreie Erziehung) ist ein Konzept aus den USA, das in Deutschland zunächst so interpretiert wurde, dass Geschlechtsunterschiede im Unterricht ignoriert werden sollten. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf die androzentrischen Strukturen der Gesellschaft.
Was ist Koedukation und wie wirkte sie sich auf die Gleichberechtigung von Mädchen aus?
Koedukation bezeichnet den gemeinsamen Unterricht von Mädchen und Jungen. In Deutschland wurde sie in den 1960er Jahren eingeführt, um Mädchen den Zugang zu Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaften zu ermöglichen. In der Praxis reichte die veränderte Ausbildung jedoch nicht aus, um Mädchen die Gleichberechtigung in "Männerberufen" zu sichern.
Welche Rolle spielt das soziale Miteinander der Jugendlichen bei der Entwicklung von Geschlecht?
Geschlecht wird nicht nur durch Lehrer, sondern auch im Miteinander der Jugendlichen erzeugt, insbesondere während der Pubertät. Auch wenn im Unterricht kein Wert auf die Unterscheidung von männlich und weiblich gelegt wird, finden doch natürliche Unterscheidungen statt.
Welche Bedeutung hat die Geschlechterrolle während der Adoleszenz?
In der Adoleszenz ist die Abgrenzung untereinander ebenso problematisch wie unerlässlich für die Entwicklung. Stereotypen spielen eine große Rolle, wenn es darum geht, in der Interaktion zwischen Jungen und Mädchen Geschlecht herzustellen. Die weibliche Pubertät setzt oft früher ein, was zu Spott und sozialen Nachteilen für Mädchen führen kann.
Was ist "reflexive Koedukation" und welches Ziel verfolgt sie?
Reflexive Koedukation zielt darauf ab, Geschlechterbewusstsein zu stärken und zu vermeiden, dass Mädchen sich freiwillig hinter dem anderen Geschlecht zurückstellen. Das wichtigste Ziel ist nicht die Abschaffung der Geschlechter, sondern die Unterstützung, dass jeder sein individuelles Geschlecht lebt und erkennt, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind.
Welche Regeln sollten im Unterricht beachtet werden, um Gleichberechtigung zu fördern?
Es ist wichtig, dass Gruppen im Unterricht weder nach Geschlecht noch nach Herkunft oder ethnischem Hintergrund gebildet werden. Kooperation sollte gefördert werden, und niemand sollte von Aktivitäten ausgeschlossen werden. Der Lehrkörper muss strikt und konsequent gegen Stereotypisierungen vorgehen.
- Quote paper
- Julia Riedel (Author), 2005, Geschlecht und Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109338