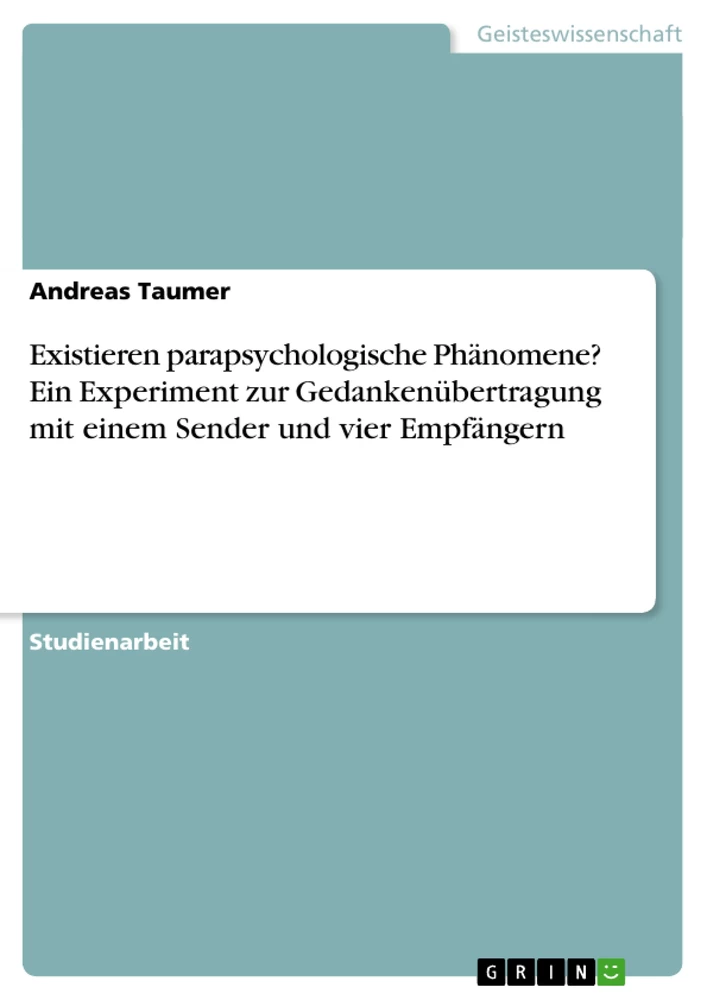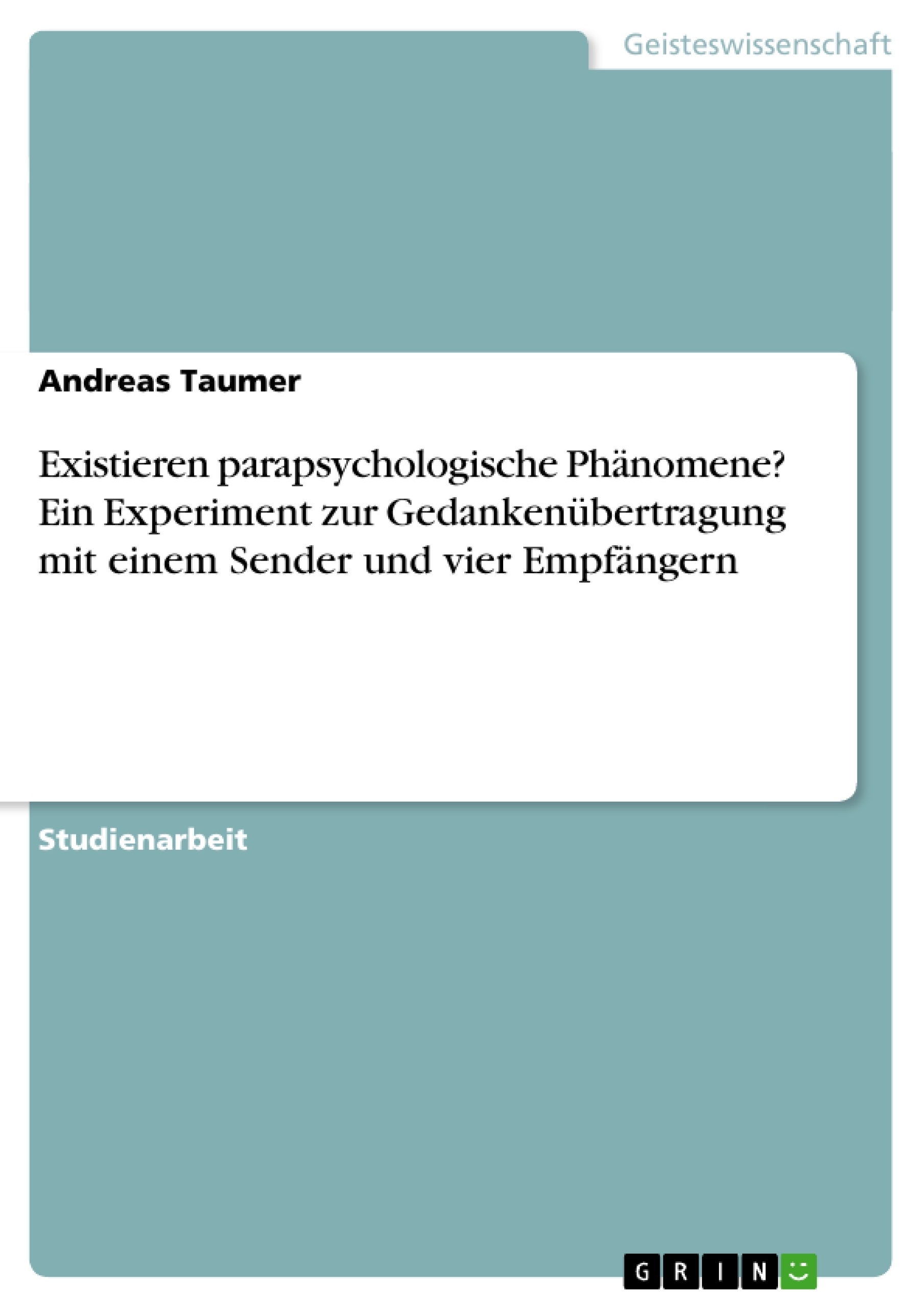Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Gedanken einer anderen Person lesen – eine Vorstellung, die seit jeher die Menschheit fasziniert. Diese wissenschaftliche Untersuchung taucht ein in die geheimnisvolle Welt der Telepathie, genauer gesagt, in die außersinnliche Wahrnehmung (ASW), um zu ergründen, ob Gedankenübertragung unter kontrollierten Laborbedingungen tatsächlich möglich ist. Können visuelle Reize, übertragen von einem Sender, von einem Empfänger in einem anderen Raum empfangen und aus einer Auswahl von Alternativen erkannt werden? Im Zentrum stehen dabei klassische Telepathie-Experimente, angelehnt an die Ganzfeld-Methode, jedoch in einer vereinfachten Version, um die Übertragung emotional besetzter Bilder zu testen. Die Studie untersucht, ob der Glaube an Telepathie die Trefferquote beeinflusst und ob es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Fähigkeit zur Gedankenübertragung gibt. Mittels statistischer Auswertung der gesammelten Daten werden Hypothesen geprüft, die sich mit der Übertragung visueller Reize, dem Einfluss des Glaubens an Telepathie und potenziellen geschlechtsspezifischen Unterschieden auseinandersetzen. Obwohl die Ergebnisse die ursprünglichen Hypothesen zur Telepathie nicht vollständig bestätigen, offenbaren sie interessante Tendenzen und regen zu weiteren Forschungen an. Die Arbeit diskutiert methodische Herausforderungen, wie die Stichprobengröße und die Komplexität des Phänomens selbst, und schlägt alternative Forschungsansätze vor, die stärker auf die subjektiven Erfahrungen der Teilnehmer eingehen könnten. Ein überraschendes Nebenergebnis deutet auf einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern hin, wobei Frauen eine höhere Empfänglichkeit für Telepathie zeigen, was zu einer Diskussion über rationale und irrationale Wahrnehmungsweisen führt. Diese Studie ist ein faszinierender Einblick in die Welt der Parapsychologie, der wissenschaftliche Skepsis mit dem Wunsch nach dem Unerklärlichen verbindet und die Tür zu weiteren Erkundungen des menschlichen Bewusstseins öffnet. Entdecken Sie die Ergebnisse, die Interpretationen und die Schlussfolgerungen, die diese Untersuchung zu einem wichtigen Beitrag zur Debatte über Telepathie und die Grenzen unserer Erkenntnis machen. Tauchen Sie ein in die Welt der empirischen Forschung und lassen Sie sich von den Ergebnissen überraschen. Die Suche nach dem Beweis für Telepathie geht weiter, und diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.
INHALTSVERZEICHNIS
I. EINFÜHRUNG
A. Allgemein
II. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG
A. Versuchsplan (Design)
B. Versuchspersonen
C. Versuchsablauf
III. ERGEBNISSE & AUSWERTUNG
A. Hypothese 1
B. Hypothese 2
C. Pseudo-Hypothese 3
D. Pseudo-Hypothese 4
E. Nebenergebnis:
IV. INTERPRETATION
V. ANHANG
A. Literaturtliste
I. EINFÜHRUNG
A. Allgemein
In dieser Arbeit greifen wir nur einen kleinen Teil des Forschungsgegenstandes Parapsychologie heraus. Flossdorf (1990, Seite 744) unterscheidet zwei zentrale Gegenstandbereiche der Parapsychologie, und zwar die Außersinnliche Wahrnehmung (ASW) und die Psychokinese.
ASW wird von Flossdorf wie folgt definiert:
ASW meint die Erfahrung äußerer Vorgänge ohne die Beteiligung der Sinnesorgane, wobei als äußere Vorgänge sowohl die dem Erlebnisträger äußerliche Objektwelt als auch Fremdpsychisches, innere Vorgänge bei anderen Personen, anzusehen sind. (Seite 744)
Im Bereich der ASW wird zwischen der Paragnosie („Hellsehen“), Telepathie („Gedankenlesen“) und Präkognition („Vorausschauen“) differenziert. Wobei diese Bereiche traditionell folgendermaßen experimentell umgesetzt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wir orientierten uns hier an das klassische Design des Telepathieexperiments, ein Empfänger errät eine gesendete Bildvorlage von vier Alternativen.
Als Arbeitsmodell des Psi-Phänomens nehmen wir an, das eine Gedankenübertragung von dem Sender auf den (die) Empänger in einer Weise erfolgt, die uns mit den heutigen Methoden nicht erfaßbar und erklärbar ist. Wir operationalisieren diesen Vorgang durch Beobachten dae Bildkarten senden und erkennen. Wenn wir annehmen, daß die Sendung keinen Effekt auf die Entscheidung des Empfängers ausübt, müßte nach Bernoulli, die Wahrscheinlichkeit zufällige Treffer zu erzielen, 0.25 betragen[1].
In der Literatur gibt es verschieden Hinweise, wie ein telepathischer Vorgang erleichtert wird, bzw. versucht man die Laborbedingungen zu optimieren.
Studien, in denen telepathische Versuche im Schlaf, bzw. in den Traumphasen durchgeführt wurden (Child 1985, zitiert nach Bem & Honorton, 1994,S.5), zeigten höhere Effekte als in Wachzustand. In jüngeren Experimenten wurde die Autoganzfeld-Methode, eine verfeinerte Form der Ganzfeld-Methode, angewandt, um eine telepathie-freundlichen Zustand bei den Sendern und Empfängern zu erreichen.
Bei der Autoganzfeld-Methode befinden sich Sender und Empfänger in isolierten Räumen, unterziehen sie sich einer 14 minütigen progressiven Entspannungsübung und konzentrieren sich auf ihr inneres Erleben. Während der Sender sich 30 Minuten auf ein Target (Übertragungsmaterial) konzentriert, berichtet der Empfänger laut von seinen Gefühlen und Eindrücken. Danach gibt er entweder ein rating (Schätzung) von alternativen Vorlagen ab, oder muß sich genau für eines entscheiden. Beim target gibt es mehrere Varianten, rein statisches bzw. dynamisches Bildmaterial, oder Filmausschnitte von verschiednen Situationen. Die Auswahl eines targets für den Sender übernimmt ein zufallsgesteuertes Computerporgramm. Somit ist der Einfluß der Versuchsleiter ausgeschaltet (Bem&Honorton. 1994 S.9-10).
Aus zeitlichen und technischen Gründen wandelten wir die Autoganzfeld-Methode in eine einfacher Version um:
1. Sender und 4 Empfänger befinden sich in getrennten Räumen
2. kurze Entspannungsmusik vor dem Senden/Empfängen
3. das target-Material besteht aus emotional besetzten (bedeutsameren) Bildern
4. Sender stellt sich das target mental vor, damit soll es leichter in ein fremdes Bewußtein aufnehmbar sein.
5. Um auszuschließen, daß einzelne Bilder häufiger als andere gewählt werden, kontrollieren wir die Grundhäufigkeiten durch Placebo(also Nicht)-Sendungen.
Aufgrund von Hinweisen in der Literatur (Bem & Honorton. 1994 S.7) konnten wir bekannte methodische Fehler vermeiden. Die Versuchsleiter beim Empfänger wußten während dem Experiment nicht, ob es eine Sendung oder Placebo-Sendung war, bzw. welches Bild gesendet wurde. Auch wurden getrennte sets (Bildkartenvorlagen) für Sender und Empfänger verwendet, um zu verhindern, daß Empfänger aus Spuren am set Rückschlüsse über das gesendete Bild ziehen kann.
II. Empirische Untersuchung
A. Versuchsplan (Design)
a) Fragestellungen
-Kann eine Person A einen dargebotenen optischen Reiz (in Form eines Bildes) mittels Telepathie (Gedankenübertragung) so weiterleiten, daß eine Person B in einem anderen Raum diesen empfangen und aus vier Alternative auswählen kann?
-Besteht ein hoher Zusammenhang zwischen der Trefferquote der Person B und ihren Glauben an das Phänomen der Telepathie?
b) Hypothesen
Daraus leiteten wir folgende Hypothesen ab:
Hypothese 1
Wenn eine Person A einen dargebotenen optischen Reiz (in Form eines Bildes) mittels Telepathie weiterleitet, dann kann eine Person B in einem anderen Raum diesen empfangen und aus vier Alternative überzufällig auswählen.
Die statistische, gerichtete Hypothese für die H0 lautet, daß die Trefferquote gleich der Zufallswahrscheinlichen ist (.H0:hit=0.25), bzw. die Alternativhypothese lautet, daß die Trefferquote größer als die Zufallswahrscheinliche ist (.H1:hit>0.25).
Hypothese 2
Wenn die Persongruppe C an Gedankenübertragung glaubt, dann ist die Trefferquote signifikant höher, als wenn die Persongruppe D an Gedankenübertragung nicht glaubt, bzw wenn die Persongruppe D an Gedankenübertragung nicht glaubt, dann ist die Trefferquote signifikant niedriger, als wenn die Persongruppe C an Gedankenübertragung glaubt.
Die statistische, gerichtete Hypothese für die H0 lautet, daß die Trefferquote der Persongruppe C, die an Gedankenübertragung glaubt, gleich der Persongruppe D ist, die an Gedankenübertragung nicht glaubt(.H0:hitglauben=hitskeptiker), bzw. die Alternativhypothese lautet, daß die Trefferquote der Persongruppe C, die an Gedankenübertragung glaubt, höher der Persongruppe D ist, die an Gedankenübertragung nicht glaubt(.H1:hitglauben>hitskeptiker )
Weiters zwei Pseudo-Hypothesen, da wir sie erst während des Experimentes einführten und formulierten.
(Pseudo)Hypothese 3
Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern bezüglich der Trefferquote.
Die statistische, ungerichtete Hypothese für die H0 lautet, daß die Trefferquote der Frauen gleich der Trefferquote der Männer ist (H0:hitfrauen=hitmänner), bzw. die Alternativhypothes lautet, daß die Trefferquote der Frauen sich von der Trefferquote der Männer signifikant unterscheiden (.H1:hitfrauen>hitskeptiker oder hitfrauen<hitskeptiker)
(Pseudo)Hypothese 4
Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern und ihren Glauben an Gedankenübertragung bezüglich der Trefferquote.
Es wurden folgende Variablen erhoben:
c) unabhängige Variablen (UV)
UV 1:Sendung des Sender:
Keine Sendung (Placebo)
Sendung eines Bildes (von vier)
UV 2:Glaube an Gedankenübertragung
nein (Skeptiker/in)
ja (Überzeugte/r)
UV 3: Geschlecht
Weiblich
Männlich
d) abhängige Variablen (AV)
AV 1:Trefferquote
Diese läßt sich berechnen aus der Anzahl der Treffer, die sich ergeben aus übereinstimmender Bildauswahl mit dem gesendeten Bild, dividiert durch die gültigen Sendungen.
Trefferquote=Treffer/Sendungen*100
B. Versuchspersonen
a) Sender(in)
Wir entschieden uns nach längeren Diskussionen für einen Sender für alle Durchgänge, um die Störvariable "verschiedene Sendefähigkeiten von Sendern" wenigstens konstant zu halten. Anfangs spielten wir mit dem Gedanken ein "Medium" als Sender zu engagieren, wir beließen es dann bei einer "normalen" Studentin, die besonders an Psi-Phänomene glaubt und sich bereit erklärte mitzumachen.
b) Empfänger/Innen
Insgesamt nahmen 10 weibliche und 10 männliche Versuchspersonen an dem Experiment teil. Alle waren StudentInnen an der Universität Salzburg im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Die UV2 Glaube wurde im Versuchsablauf erhoben. Bei der Auswahl der Versuchspersonen wurde darauf geachtet, daß sich ungefähr gleich viele Frauen wie Männer, SkeptikerInnen und Gläubige in der Stichprobe befanden.
C. Versuchsablauf
Das Experiment fand in zwei Zimmern statt, die durch eine Tür miteinander verbunden waren. Weiters stand ein Kassettenrecorder mit einer Aktivbox in je einem Zimmer. Auf diesem Recorder wurde ein Tonband abgespielt, das den genauen Ablauf des Experiments vorgab (siehe Anhang: Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.)
Bei jedem Durchlauf befanden sich vier EmpfängerInnen mit vier VersuchsleiterInnen und eine Senderin mit einer Versuchsleiterin in je einem der beiden Zimmer. Wir achteten darauf, das die EmpfängerInnen keinen Sichtkontakt zueinander hatten.Senderin und EmpfängerInnen erhielten die gleiche Kurzinformation vor dem Experiment über seinen Inhalt und Ablauf. Um sich etwas auf die Person der Senderin einzustellen, ließen wir sie sich kurz vorstellen.
Den Empfängern wird eine Anleitung (siehe Anhang: Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) zum Lesen vorgelegt, danach wurden Ihnen vom VersuchsleiterIn die vier Bilder kurz gezeigt, um bei allen acht Durchgängen zu gewährleisten, daß die gleiche Vorinformation vorhanden ist. Diese vier Bilder wurden aus 20 TAT Bilder ausgewählt, da diese emotional-besetzten Bilder sinnvoll erschienen, telepathische Prozesse zu ermöglichen. Danach wurde der Kassettenrecorder eingeschaltet, ein Probe-Stop und Start-Signal erfolgte und die ersten 2 Minuten Entspannungsmusik folgten.
Sender:
Der Sender bekommt einen Sendeplan (Siehe Anhang Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) mit 10 möglichen Sende/Nicht-Sende Variationen vorgelegt, wählt davon 5 Sendeplanvarianten aus. Der Versuchsleiter mischt 2 x 4 Bilder, verdeckt in Kuverts, und legt sie je nach Sendeplan offen oder geschlossen dem Sender vor. Nach dem Sende/Nicht-Sende-Vorgang trägt der Versuchsleiter die gesendeten und nicht-gesendeten Bilder in den Plan ein.
Empfänger:
Nach dem Start und Stopsignal der Sendezeit wurden den EmpfängerInnen vier Bilder zur Auswahl vorgelegt. Um Positionseffekt durch gleiches Bildervorlegen zu vermeiden, wurde die Reihenfolge der Bilder variiert. Der/die Empfänger/in mußte sich innerhalb von 20 Sekunden spontan für ein Bild aus den vier Alternativen entscheiden (judging procedure).
Nach insgesamt acht Durchläufen wurde die Versuchsperson nach dem Empfangen befragt, und der nächste Durchgang (insgesamt 5) mit neuen Versuchspersonen begann. Über richtige Treffer beim Empfangen wurde den Versuchspersonen nichts gesagt, da wir es selbst noch nicht wußten und wir vermeiden wollten, daß die neuen Vpen etwas von den Placebo-Sendungen erfahren.
III. Ergebnisse& auswertung
Die Rohdaten wurden codiert und in SPSS Windows eingegeben. Das Datenniveau der Merkamale ist nominal, es konnten also nur Häufigkeitsverteilungen und Nicht-Parametrische Tests, sprich z-Tests und Chi-Quadrat-Tests berechnet werden.
Rein deskriptiv ergaben sich folgende Ergebnisse in Häufigkeitsverteilungen und Prozentwerten ausgedrückt:
Glaube an Gedankenübertragung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Glaubst Du etwas empfangen zu haben:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Grundhäufigkeiten
Bei den Placebo-Sendungen ergab sich folgende Verteilung bei der zufälligen Auswahl eines Bildes ohne Einwirkung eines Senders. Wir überprüften dies mit einem Chi-Quadrat-Test, wobei sich keine signifikanten Unterschiede (Chi-Quadrat-Wert von 1 und eine a-Wahrscheinlichkeit von 0.8013) zwischen den Bilder ergaben. Somit konnten wir von der relativen Häufigkeitsverteilung ohne Sendeeffekt ausgehen!
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Treffer (hits) ließen sich aus dem Vergleich von der Variabel Bilde_Senden und Bild_Empfangen berechnen (vorher wurden mit der Variable Senden die Placebo-Sendungen ausgefiltert).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Hypothese 1
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Über die ganze Stichprobe ergab sich sich eine Haufigkeitsverteilung von 17 hits auf 80 Durchläufen (Trefferquote: 21.3%)
Nach einer z-Transformation dieser Daten, ergab der einseitige Einstichproben-z-Test ein nicht signifikantes Ergebnis von z= -0.77. Die Abweichung vom erwarteten 25%-Level erklärt sich somit als eine zufällige Variation ohne systematischen Fehler. Wenn wir die Null-Hypothese verworfen hätten und damit unsere Alternativhypothese akzepierten, würden wir dies mit 78%iger Wahrscheinlichkeit zu Unrecht tun.
B. Hypothese 2
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei einem Chi-Quadrat-Test (df=1, N=80) mit welchem der Unterschied zwischen Gläubige/rn und SkeptikerInnen errechnet wurde, ergab sich der Wert 1,248 und damit kein signifikanter Unterschied, die Ho würde mit 13,192% zu Recht verworfen werden.
C. Pseudo-Hypothese 3
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei der Untersuchung der Unterschiede zwischen Frauen und Männer bei den Trefferquoten, ergab sich beim Chi-Quadrat-Test (df=1, N=80) ein Wert von 3.66013, und somit ein signifikanes Ergebnis mit einer einseitigen a-Wahrscheinlichkeit von 0,027865.
D. Pseudo-Hypothese 4
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es ergab sich kein statistisch relevanter Unterschied zwischen Männer und Frauen, in bezug auf ihren Glauben an Gedankenübertragung. Beim Qui-Quadrat-Test der Gläugiger-Gruppe wurde der Wert 1,7333 mit einer a-Wahrscheinlichkeit von 0.1879 errechnet, und bei der Skeptiker-Gruppe wurde der Wert 1,05 mit einer a-Wahrscheinlichkeit von 0.3055 errechnet, wobei eine Zelle kleiner als 5 war.
E. Nebenergebnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Frauenstichprobe glaubt signifikant höher an Gedankenübertragung als die Männerstichprobe, und dies mit einer 0,4 prozentigen Sicherheit bei einem Qui-Quadrat-Wert von 7,912.
IV. Interpretation
Unsere Hypothesen über die Möglichkeit der Telepathie konnten großteils empirisch nicht bestätigt werden, bis auf einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern konnte keine unserer Hypothesen eine statistische Signifikanz erreichen.
Jetzt möchte ich mehrere vermuteteUrsachen und adhoc Erklärungen dafür anführen:
Ein Argument, das die statistische Methodik betrifft, zielt darauf ab, daß die Stichprobe zu klein gewählt wurde, um ein signifikantes Ergebnis erreichen zu können. Besonders bei den Pseudohypothesen 3 und 4 war die Zellengröße teilweise extrem klein (zB 8 Skeptikerinnen in einer Zelle der Matrix 4).
Hätten wir die Placebo-Sendungen nicht über die ganz Hälfte der Durchläufe verteilt, um wirklich valide Grundhäufigkeiten zu bekommen, sondern vielleicht nur ein 1/3 oder ¼ dazuhergenommen, würde die Sende-Stichprobe gültiger Ergebnisse liefern.
Aufgrund unserer experimentellen Unerfahrenheit haben wir zu wenig Hypothesen aufgestellt, die gerade ohne methodischen Mehraufwand verwirklichbar gewesen wären. Zum Beispiel die beiden Pseudohypothesen hätten wir ruhig, wissenschaftstheoretisch korrekt, vorher formulieren können.
Grundsätzlich meint Flossdorf (1990):
Festzustellen ist nämlich, daß die zwar individuell unterschiedlich ausgeprägten, prinzipiell jedoch allgemein verbereiteten „Psi-Fähigkeiten“ zumeist Spontan-Phänomene darstellen: sie lassen sich nicht programmieren oder steuern; ihr Auftreten scheint wesentlich von unbewußten, sublimalen Proszessen begleitet zu sein. Demnach stehen die von Quantifizierung und Operationalisierung dominierten Rahmenbedingungnen des Tests gewissermaßen strukturell den Bedingungen des Getesteten entgegen, was zugleich inhaltlich bedeutet, daß die Komplexität des Gegenstandes der statistischen Methode geopfert wird: Kartenraten und Würfelwerfen sind wohl sehr verdünnte Modifikationen der in praktischen Lebenssituationen auftretenden ASW- und PK-Phänomene. (S.745)
Um dieser Kritik Flossdorfs ein wenig gerecht zu werden, hätten wir zB als Sender und Empfänger Personen heranziehen sollen, die in besonderer Beziehung zueinander stehen (Mutter-Kind, Verliebte, Paare, gute Freunde ...) und Personen, die schon Vorerfahrungen in diesem Bereich haben, bzw. in Entspannungs- und Meditationsverfahren geübt sind (vgl. Bem & Honorton 1994).
Weiters kann man bei der traget-Auswahl noch realer, wenig abstrahierte Objekte verwenden (wie in der Einführung erwähnt: Video-Clips; oder Cyber-Space Welt mit Datenhandschuh, also eine vorgegebene künstliche Situation im Geiste des Senders kann besser kontrolliert werden und stellt eine realere Bedingung dar)
Die signifikante Pseudohypothese 3 bestätigt eine alltags-psychologische These: „Frauen sind empfänglicher für Irrationales“. Das klassische Bild von den geschlechtlichen Gegensatzpaaren scheint hier bestätigt: feminin-maskulin, offen-geschlossen (für Ungewohntes), irrational-rational (bei der Verabeitung von Wahrnehmungen), weich(feinfühlig)-hart (gegenüber Fremdbeinflussung) Auch spricht der hohe Zusammenhang zwischen der Gläubigkeit an Gedankenübertragung und dem weiblichen Geschlecht dafür (siehe Nebenergebnis). Ich möchte dies hier positiv betonen, daß es zum Glück doch noch menschliche Lebewesen gibt, die es nicht verlernt haben, Unverständliches zu akzeptieren und diesen unbewußten Anteil ihres Bewußtseins nicht schonungslos verdrängen!
V. Anhang
A. Literaturtliste
Bem, D.J. & Honorton, C. (1994). Does Psi exist? Replicable evidence for an anomalous process of information transfer. Psychological Review, 115 (1), 4-18.
Hayman, R. (1994). Anomaly or Artifact? Comments on Bem and Honorton. Psychological Review, 115 (1), 19-24.
Bem, D.J. (1994). Response to Hyman. Psychological Review, 115 (1), 25-27.
Grubitsch, S. & Rexilius, G. (1990). Psychologische Grundbegriffe. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
Grubitsch, S. & Rexilius, G. (1986). Psychologie. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
Raeithel, A. (1990). Psychologie. In S. Grubitsch & G. Rexilius (1986). Psychologie, (262-282). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
Flossdorf, B. (1990). Parapsychologie. In S. Grubitsch & G. Rexilius (1990). Psychologische Grundbegriffe, (743-748). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
Kähler, W.-M. (1994). SPSS für Windows, Datenanalyse unter Windows.
Bortz, J. (1985). Lehrbuch der Statistik. Für Sozialwissenschafter. Heidelberg Berlin: Springer-Verlag
ANLEITUNG:
Lies Dir bitte diesen Text in Ruhe durch und beantworte dann die Frage im Anschluß!
1. In diesem Experiment versuchen wir herauszufinden, ob Gedankenübertragung möglich ist.
2. Du bist eine/r von vier EmpfängerInnen; im Nachbarraum sitzt eine sendende Person.
Diese Person versucht Dir eine halbe Minute lang ein Bild zu übermitteln, das Du dann im Anschluß an die Sendezeit aus vier Alternativen innerhalb von 10 Sekunden auswählen sollst.
Die Auswahl soll spontan erfolgen und ist zwingend!
Die vier Bilder bekommst Du jeweils nach der Sendezeit von uns vorgelegt
Dieser Vorgang des Empfangens und Auswählens findet acht Mal statt.
3. Genauer Ablauf:
Wenn Du den Text durchgelesen und keine Fragen mehr hast, dann lassen wir ein Tonband laufen.
Auf auf diesem Tonband hörst Du:
1) Erläuterung von STOP und START-Signalen
2) Musik zur Entspannung (2 Minuten)
3) Startsignal zum 1. Empfangen
4) 20 Sekunden Sende- und Empfangszeit
5) 1.Stopsignal für Empfangsende
6) 20 Sekunden für Bildauswahl
7) 2.Stopsignal für Bildauswahlende
8) Musik (1 Minute)
9) 7 malige Wiederhohlung ab Pkt. 3)
4. Beantworte bitte folgende Frage:
Glaubst Du an Gedankenübertragung [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Ja
[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] Nein
PS: Beachte bitte bei Deiner Auswahl, daß Du jedes Bild beliebig oft auswählen kannst!
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit behandelt einen Teilbereich der Parapsychologie, speziell die Außersinnliche Wahrnehmung (ASW) und Telepathie.
Was ist Außersinnliche Wahrnehmung (ASW)?
ASW bezeichnet die Wahrnehmung äußerer Vorgänge ohne die Beteiligung der Sinnesorgane. Dies umfasst sowohl die äußere Objektwelt als auch innere Vorgänge anderer Personen.
Welche Arten von ASW werden unterschieden?
Im Bereich der ASW wird zwischen Paragnosie ("Hellsehen"), Telepathie ("Gedankenlesen") und Präkognition ("Vorausschauen") unterschieden.
Wie wurde das Telepathieexperiment in dieser Arbeit umgesetzt?
Das Experiment orientierte sich an einem klassischen Telepathieexperiment, bei dem ein Empfänger eine gesendete Bildvorlage aus vier Alternativen erraten soll.
Welches Arbeitsmodell des Psi-Phänomens wird angenommen?
Es wird angenommen, dass eine Gedankenübertragung vom Sender zum Empfänger stattfindet, die mit heutigen Methoden nicht erfassbar oder erklärbar ist. Dieser Vorgang wird durch das Beobachten des Sendens und Erkennens von Bildkarten operationalisiert.
Welche Methoden zur Erleichterung telepathischer Vorgänge werden in der Literatur erwähnt?
Studien, in denen telepathische Versuche im Schlaf oder in den Traumphasen durchgeführt wurden, zeigten höhere Effekte als im Wachzustand. Zudem wird die Autoganzfeld-Methode eingesetzt, um einen telepathie-freundlichen Zustand bei Sendern und Empfängern zu erreichen.
Was ist die Autoganzfeld-Methode?
Bei der Autoganzfeld-Methode befinden sich Sender und Empfänger in isolierten Räumen, unterziehen sich einer Entspannungsübung und konzentrieren sich auf ihr inneres Erleben. Der Sender konzentriert sich auf ein Target, während der Empfänger von seinen Gefühlen und Eindrücken berichtet.
Wie wurde die Autoganzfeld-Methode in dieser Arbeit vereinfacht?
Die vereinfachte Version umfasste: Sender und Empfänger in getrennten Räumen, kurze Entspannungsmusik, emotional besetzte Bilder als Target-Material, mentale Vorstellung des Targets durch den Sender und Kontrolle der Grundhäufigkeiten durch Placebo-Sendungen.
Welche methodischen Fehler wurden vermieden?
Die Versuchsleiter beim Empfänger wussten nicht, ob es eine Sendung oder Placebo-Sendung war oder welches Bild gesendet wurde. Zudem wurden getrennte Sets für Sender und Empfänger verwendet.
Welche Fragestellungen wurden in der empirischen Untersuchung untersucht?
Es wurde untersucht, ob eine Person einen optischen Reiz telepathisch weiterleiten kann, so dass eine andere Person ihn aus vier Alternativen auswählen kann, und ob ein Zusammenhang zwischen der Trefferquote und dem Glauben an Telepathie besteht.
Welche Hypothesen wurden aufgestellt?
Hypothese 1: Telepathische Übertragung führt zu überzufälliger Auswahl des richtigen Bildes.
Hypothese 2: Personen, die an Telepathie glauben, erzielen höhere Trefferquoten.
(Pseudo)Hypothese 3: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern bezüglich der Trefferquote.
(Pseudo)Hypothese 4: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern und ihren Glauben an Gedankenübertragung bezüglich der Trefferquote.
Welche Variablen wurden erhoben?
Unabhängige Variablen (UV): Sendung des Senders (ja/nein), Glaube an Telepathie (ja/nein), Geschlecht (männlich/weiblich).
Abhängige Variable (AV): Trefferquote.
Wer waren die Versuchspersonen?
Es gab einen Sender und 20 Empfänger (10 weibliche und 10 männliche Studenten).
Wie war der Versuchsablauf?
Sender und Empfänger befanden sich in getrennten Räumen. Ein Tonband gab den Ablauf vor, mit Entspannungsmusik, Sendezeit und Auswahlzeit. Der Sender wählte Bilder aus, die Empfänger wählten aus vier Alternativen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Hypothese 1 wurde nicht bestätigt. Es gab keine überzufällige Trefferquote.
Hypothese 2 wurde nicht bestätigt. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen Gläubigen und Skeptikern.
(Pseudo)Hypothese 3 wurde bestätigt. Es gab einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern bezüglich der Trefferquote.
(Pseudo)Hypothese 4 wurde nicht bestätigt. Es gab keinen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern und ihren Glauben an Gedankenübertragung bezüglich der Trefferquote.
Frauen glauben signifikant häufiger an Gedankenübertragung als Männer.
Wie wurden die Ergebnisse interpretiert?
Die Hypothesen über Telepathie konnten größtenteils nicht bestätigt werden. Mögliche Gründe sind eine zu kleine Stichprobe, methodische Mängel und die Komplexität des Phänomens, das sich schwer in standardisierte Tests einfügen lässt.
Welche Vorschläge zur Verbesserung zukünftiger Experimente wurden gemacht?
Einbeziehung von Personen mit besonderer Beziehung zueinander, die bereits Vorerfahrungen haben. Verwendung realerer, wenig abstrahierter Target-Objekte. Mehr Hypothesen im Vorfeld formulieren.
- Quote paper
- Andreas Taumer (Author), 1994, Existieren parapsychologische Phänomene? Ein Experiment zur Gedankenübertragung mit einem Sender und vier Empfängern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109319