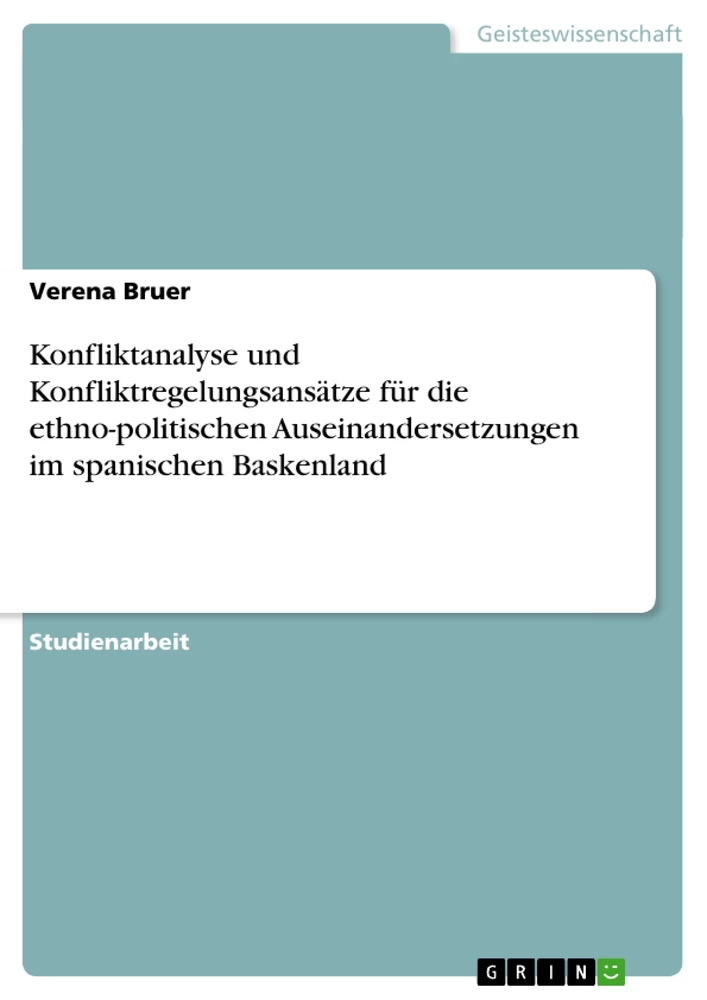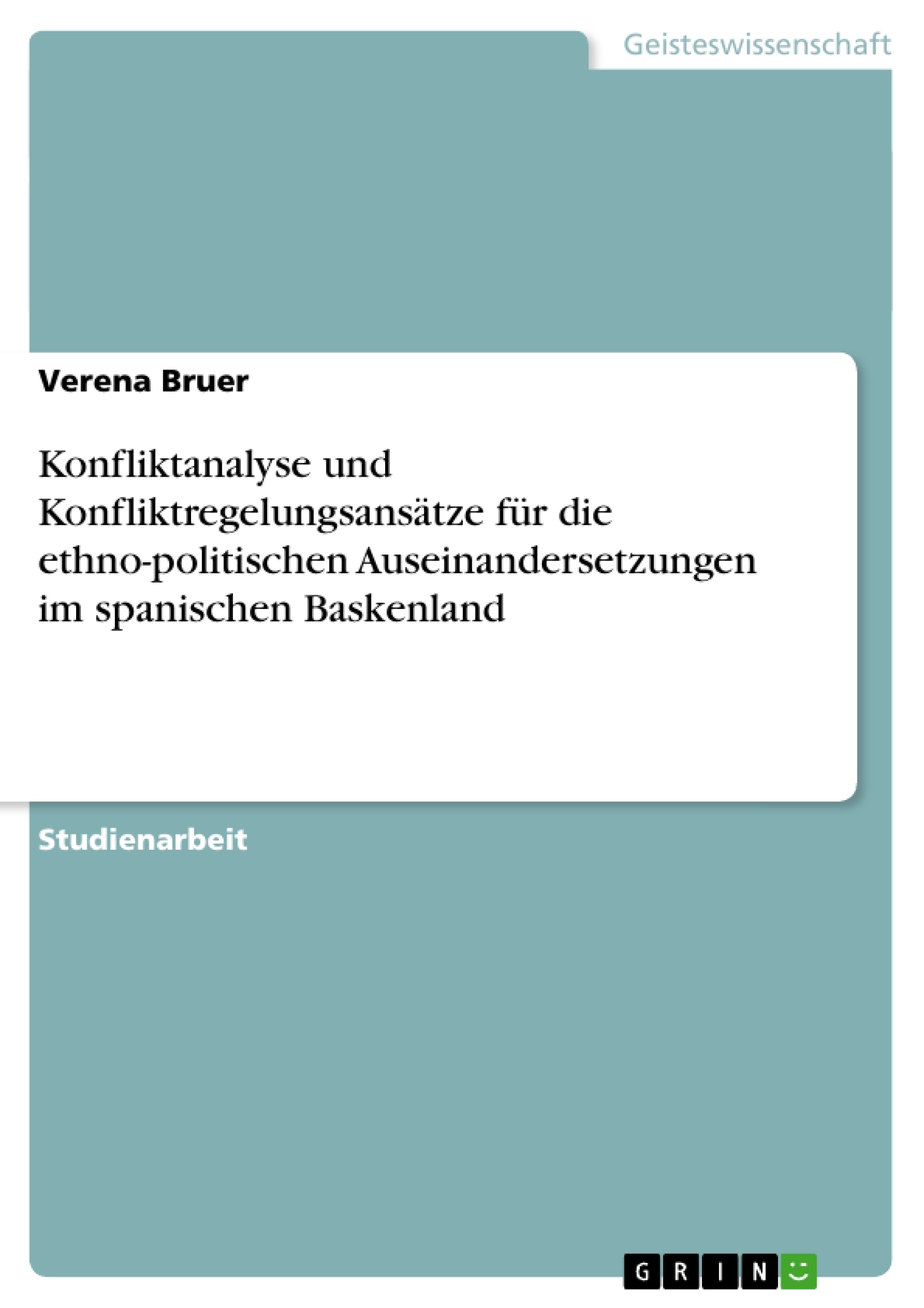Stellen Sie sich eine Region vor, tief verwurzelt in ihrer Kultur und Identität, doch seit Jahrzehnten gezeichnet von einem unerbittlichen Konflikt. Dieses Buch enthüllt die komplexen Schichten des spanisch-baskischen Konflikts, ein Kampf um Autonomie, Identität und das Recht auf Selbstbestimmung, der die Region Euskadi seit dem 19. Jahrhundert prägt. Von den Karlistenkriegen und der Unterdrückung unter Franco bis zum Aufstieg der ETA und den Friedensbemühungen der jüngeren Zeit, werden die historischen Ursachen, die treibenden Kräfte und die tragischen Konsequenzen dieser Auseinandersetzung analysiert. Tauchen Sie ein in eine detaillierte Untersuchung der Schlüsselakteure – von nationalistischen Parteien und Terrororganisationen bis hin zur spanischen Regierung und der baskischen Bevölkerung – und ihrer jeweiligen Interessen und Motive. Ergründen Sie die Konfliktanalyse, die die tiefgreifenden ethno-politischen Dimensionen dieses Konflikts beleuchtet, einschliesslich der Rolle von Identität, politischer Mobilisierung und der Traumata der Vergangenheit. Entdecken Sie innovative Konfliktregelungsansätze, von der Ressourcentheorie und dem Basic-Needs-Ausgleich bis hin zur Verlagerung der Konfliktachse und der Isolation von Terroristen. Untersuchen Sie die Chancen und Herausforderungen von Friedensverhandlungen und die Bedeutung von Drittpartei-Interventionen, einschliesslich Facilitation, nicht-direktiver Mediation und direktiver Mediation. Dieses Buch bietet eine umfassende und aufschlussreiche Analyse des baskischen Konflikts, die sowohl für Akademiker als auch für alle, die sich für Konfliktlösung, politische Gewalt und die Dynamik ethno-nationalistischer Bewegungen interessieren, von grossem Wert ist. Es werden Lösungsansätze und Zukunftsperspektiven aufgezeigt, die eine friedliche und nachhaltige Lösung dieses langwierigen Konflikts ermöglichen könnten, wobei die Notwendigkeit von Kompromissbereitschaft, gegenseitigem Vertrauen und der Anerkennung der kulturellen Identität des Baskenlandes betont wird. Eine fesselnde Lektüre für alle, die die komplexen Zusammenhänge von Konflikten und die Suche nach Frieden verstehen wollen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Zeitleiste
1. Historische Entwicklung
2. Akteure, Beteiligte und Betroffene
3. Konfliktanalyse
4. Konfliktregelungsansätze
4.1 Ressourcentheorie
a) Ressourcenzufuhr
b) „basic-needs“- Ausgleich
c) Übergabe von Regierungsverantwortung
d) Ibarretxe-Plan
e) Autonomie-Theorie
f) Verlagerung der Konfliktachse
g) Bedrängnis der Terroristen / Isolation
4.2 Verlagerung der Konfliktachse
4.3 Isolation der Terroristen
4.4 Friedensverhandlungen
4.5 Drittpartei – Intervention
a) Facilitation
b) Nicht-direktive Mediation
c) Direktive Mediation
4.6 Schlussfolgerungen
5. Ausblick
Einleitung
Die seit 1979 autonome Region Euskadi in Spanien besteht aus den Provinzen Guipúzcoa (baskisch: Gipuzkoa), Vizcaya (baskisch: Bizkaia) und Alava (baskisch: Araba).
Euskadi versteht sich selbst als ethnische und kulturelle Gemeinschaft, weshalb in nationalistischen Kreisen das Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit (zusammen mit den drei baskischen Territorien in Frankreich und der Provinz Navarra) gefordert wird. Dieses wird von Seiten der spanischen Regierung abgelehnt.
Mit 7.261 Quadratkilometern ist das spanische Baskenland etwa halb so groß wie Schleswig-Holstein und hat rund 2,1 Millionen Einwohner. Der Konflikt im Baskenland hat historische Verwurzelungen, die sich bis über 150 Jahre in die Vergangenheit ziehen. Seit der Gründung der radikal-nationalistischen Terrororganisation ETA 1959 haben die gewalttätigen Auseinandersetzungen über 800 Menschenleben gefordert.
Im Folgenden werden zunächst die historischen Hintergründe des baskischen Konflikts chronologisch dargelegt und den Konfliktverlauf maßgeblich beeinflussende Faktoren herausgearbeitet. Anschließend folgt eine darauf aufbauende Konfliktanalyse, die sich mit den Beteiligten und Betroffenen der Auseinandersetzungen, ihren Interessen, Zielen, Motiven und Methoden auseinandersetzt und den vorliegenden Konflikt in bestehende theoretische Modellformationen einordnet. Im Anschluss daran werden einige Ansätze zur Konfliktregelung vorgestellt und auf den vorliegenden Konflikt angewendet.
In der Schlussbetrachtung wird letztendlich ein kurzer Ausblick auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft erfolgen und diesbezüglich auf anwendbare Elemente der vorherigen Ausführungen verwiesen.
Bedeutende Einflussfaktoren im historischen Verlauf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Historische Entwicklung / Ursachen des spanisch-baskischen Konflikts
Die Ursprünge des baskischen Konfliktes lassen sich im Wesentlichen im beginnenden 19. Jahrhundert beobachten. Durch die militärischen Niederlagen in den beiden Karlistenkriegen und der damit einhergehenden Beseitigung der Fueros, der institutionellen Privilegien der Basken, durch die Spanier, entsteht ein Gefühl der Unsicherheit und Bedrohung. Dieses mani-festiert sich mit dem Beginn der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts, wodurch end-gültig das Ende der traditionellen Gesellschaftsstruktur eingeläutet wird: Rasante Modernisie-rung und die darauf folgende starke Zuwanderung verstärken das Gefühl der Überfremdung und verursachen eine baskische Identitätskrise. Juan Aranzi beschreibt dies folgendermaßen:
„Weder den Kelten noch den Phönikern, noch den Griechen, Römern, Goten, Arabern und Spaniern gelang es, das goldene baskische Zeitalter zu beenden. Sie kannten weder Sklaverei noch Feudalismus, sondern waren alle Ritter. Ihre Eintracht und die von ihnen errichtete Demokratie hielten so lange an, bis sie in den Karlistischen Kriegen von den Spaniern besiegt wurden. Damit kam das Böse nach Euzkadi in Gestalt des ausbeuterischen, verderblichen, spanischen Kapitalismus. (…)“ ( Aranzadi, Juan 1981)[1]
Diese Stimmung bildet einen fruchtbaren Nährboden für den von Sabino Arana Ende des 19. Jahrhunderts eingeführten baskischen Nationalismus, der insbesondere vom Kleinbürgertum auf der Suche nach ursprünglicher baskischer Tradition und Identität begeistert aufgegriffen wird. Das neu begründete baskische Nationalbewusstsein, von Arana mit vollständigem Ge-dankengut und Symbolik ausgestattet (Flagge etc.), definiert sich über die baskische Rasse und Sprache und grenzt sich so von den als Bedrohung empfundenen Einwanderern und den verhassten spanischen „Besetzern“ ab. Durch die von Arana 1895 gegründete PNV, die die Forderung nach einem unabhängigen Staat laut macht, wird die Bewegung institutionalisiert und verstärkt. Durch das Angebot eines umfassenden Autonomiestatuts von Seiten der repub-likanischen Regierung zu Beginn des spanischen Bürgerkriegs 1936 und die darauf folgende Konstituierung der autonomen baskischen Regierung unter PNV-Führung erfolgt zunächst eine Annäherung der Konfliktparteien, die Basken wenden sich daraufhin im Krieg dem re-publikanischen Lager zu. Aufgrund der weiteren historischen Entwicklung wird dieser mög-lichen Chance, eine längerfristige Eskalation der Differenzen zu vermeiden, jedoch jäh ein Ende gesetzt. Der Sieg der faschistischen Franco-Truppen inklusive Zerstörung der „heiligen Stadt“ Guernica und der Besetzung des Baskenlandes vertreibt die baskische Regierung ins Exil. Die hyperzentralistische Unterdrückungspolitik des Diktators, noch verstärkt durch die erfolgte Unterstützung des Gegenlagers im Bürgerkrieg, ist gekennzeichnet durch eine stark antibaskische Haltung, die sich unter anderem im Verbot der so identitätsstiftenden baski-schen Sprache Euskerra, massenhaften Verhaftungen und Repressalien ausdrückt. Die so ge-schürten neuen Aggressionen und ethnischen Existenzängste führen in Kombination mit dem Fehlen einer präsenten politischen Interessenvertretung zu steigender Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ablehnung der Legitimität des Franco-Regimes, Nicht-Beteiligung am politi-schen Geschehen und der Rückzug in die Zivilgesellschaft zeigen Versuche der Identitätsbe-wahrung. Die Exilregierung versucht währenddessen eine Destabilisierung des Franco-Regimes durch internationalen Druck und vollzieht diese Entwicklung nicht mit. Die ETA entsteht 1959 als Ausdruck der landesinternen Forderungen nach Aktionismus, entwickelt sich in den folgenden Jahren zum erfolgreichsten Träger des gewaltsamen baskischen Wider-stands gegen Franco und bildet gleichzeitig ein Forum der politischen Debatte und revolutio-nären Reflexion. Mit dem Prozess von Burgos 1970 erreicht dieser Erfolg einen Höhepunkt. Der Druck auf Franco und die darauf folgende Umwandlung der Todesurteile für 6 Etarras bilden eine Zäsur, das Ansehen des Regimes ist geschwächt und ETA genießt große Sympathien in der Bevölkerung.
Bereits in den 60er Jahren entwickelt sich eine ideologische Auffächerung der baskischen Nationalbewegung, es entsteht eine Bruchlinie zwischen radikal-nationalistischen Gruppen (Akzeptanz von Gewalt als politisches Mittel) und gemäßigten baskischen Parteien (keine Ge-walt-Gutheißung). 1974 vollzieht sich diese Spaltung auch innerhalb der ETA. Es lässt sich beobachten, dass schon in den frühen Jahren der baskischen Widerstandsbewegung keines-falls Einigkeit bezüglich der Ziele und Methoden im Kampf für die Autonomie herrscht. Ein deutliches Beispiel ist auch die kompromisslose Weiterführung des politischen Kampfes nach Transición und Großamnestie, was ein erneut historisch günstiger Zeitpunkt für einen Inter-essenausgleich und die mögliche Beilegung des Konflikts gewesen wäre, sowie das 1979 mit baskischer Mehrheit angenommene Autonomiestatut von Gernika, das ebenfalls die ETA spaltet und Zweifel an der tatsächlichen Vertretung der „baskischen Interessen“ aufkommen lässt. Auch der bald erfolgende Übergang von der selektiven zur offensiven Gewalt stellt dies in Frage. Infolgedessen verläuft die Entwicklung der kommenden Jahre gewalttätig und kom-munikationslos. Der Einsatz der mordenden und folternden GAL-Truppen, sowie zahlreiche Anschläge der ETA mit vielen, auch unbeteiligten Toten löst die „Basta ya!“ – Stimmung („Jetzt reicht’s!“) in der Bevölkerung aus, die sich nun immer deutlicher von den gewalttäti-gen Methoden distanziert. Die durch die GAL und die entzogene Sympathie der Basken ge-schwächte ETA zeigt sich Ende der 80er kompromissbereit, die Friedensverhandlungen zwi-schen der ETA-Führung und Repräsentanten der spanischen Regierung in Algerien scheitern jedoch an entscheidenden Differenzen, hauptsächlich bezüglich der Themen Souveränität und Amnestiegewährung. Morde und – proportional dazu- der zivile Widerstand nehmen darauf-hin weiter zu. 1998 ist der dritte historisch günstige Zeitpunkt (nach 1936 und der Transición), zu dem sich einem gemeinsamen Kompromiss diesmal so weit wie noch nie angenähert wurde. Mit dem durch die nordirischen Friedensgespräche inspirierten Pakt von Lizarra einigen sich alle nationalistischen Parteien, auch die ETA-nahe Herri Batasuna, auf einen Gewaltverzicht, woraufhin die Eta einen „vollständigen und unbe-fristeten Waffenstillstand“ verkündet. Die spanische Regierung ist erstmals bereit, sich auf direkte Verhandlungen mit der ETA einzulassen. Die gegenseitige Kompromissbereitschaft und Flexibilität reicht jedoch nicht aus für die Entwicklung einer konstruktiven Lösung, in den Verhandlungen kann keine operable Strategie entwickelt werden. Der bewaffnete Kampf wird daraufhin im vollen Umfang wieder aufgenommen. Die spanische Regierung reagiert 2000 mit einem Staatspakt gegen die ETA unter Ausschluss der nationalistischen Parteien, was als klare Absage an eine Autonomie verstanden werden kann – die Konfliktparteien entfernen sich erneut voneinander. Diese dissoziative Entwicklung zieht sich durch bis in die Gegenwart: Vermehrte Drohungen und Anschläge, verstärkte Fahndungen und Verhaftungen sowie das Verbot der Batasuna -Partei sind einige Indikatoren der letzten Jahre.
àWichtigste Faktoren der Entstehung und Eskalation des gewalttätigen Konflikts im Baskenland:
- Militärische Niederlagen in den Karlistenkriegen und sozio-ökonomische Veränderungen des 19. Jahrhunderts (àIdentitätskrise)
- Franquistische Unterdrückung (à politische Wehrlosigkeit,
Versuch, sich von externer politischer und sozialer Abhängigkeit zu befreien)
- Unfähigkeit der historischen Parteien PSOE und PNV, eine operable Strategie zu entwickeln und damit ihre politische und organisatorische Hegemonie in der sozialen bzw. nationalen Bewegung zu behalten – Historisch bedingtes gegenseitiges Misstrauen (à geringe Kompromissbereitschaft)
2. Akteure – Beteiligte – Betroffene
illustration not visible in this excerpt2
illustration not visible in this excerpt3
3. Konfliktanalyse
Bei näherer Betrachtung des baskischen Konfliktes zeigen sich die typischen Merkmale eines ethno-politischen Konflikts, der, wie die meisten, tief historisch verwurzelt ist. Dieser kennt verschiedene Erscheinungsformen. Im vorliegenden Fall geht es um eine Minderheit, die in einem bestehenden Staat ihre kulturelle Identität bewahrt hat und sich deshalb durch bestimmte Merkmale abgrenzt. Geographisch zeichnet sich hier die traditionelle Konfliktachse Zentrum ↔ Peripherie. Es existiert eine Reihe von identitätsstiftenden Merkmalen, die die ethnische Gruppe als zusammengehörig definieren und Distinktionsmechanismen gegenüber anderen, in diesem Fall der spanischen Bevölkerung bilden. Diese sind hier, wie bereits oben aufgeführt, die gemeinsame Vergangenheit, die eigene baskische Sprache, bestimmte Lebensformen, Mythen, Ideologien und Selbstverständlichkeiten. Nicht diese gemeinsamen Merkmale an sich, sondern erst ihre gemeinsame Wahrnehmung kann jedoch eine ein- oder ausgrenzende Wirkung entfalten. Diese geht meist einher mit der Erfahrung einer negativen oder positiven Diskriminierung – es entsteht die Idee des „Anders-Seins“ – und einer daran anknüpfenden gezielten politischen Mobilisierung zugunsten der Interessen der jeweiligen Gruppen. Die Schlüsselrolle ethnischer Merkmale im Konfliktprozess begründet also in der Regel erst ihre Politisierung. Diese Entwicklung und das daraus mögliche Konfliktpotential zeigen sich im Baskenland deutlich an der Entstehung des baskischen Nationalismus im späten 19. Jahrhundert. Mit der Industrialisierung entstehen als Resultat konfliktiver gesellschaftlicher Entwicklungen und sozialer Transformationsprozesse Unsicherheiten, die baskische Identität wird in Frage gestellt. Dieses Phänomen lässt sich auch als eine der typischen Begleiterscheinung der Moderne ansehen. Entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf solcher „innergesellschaftlichen“ Spannungen (im Grunde genommen stellt sich dabei ja genau die Frage nach der „Innergesellschaftlich-keit“) haben zwei Faktoren: Ausschlaggebend ist zunächst die Intensität repressiver Maß-nahmen und dementsprechend das Ausmaß der kollektiv empfundenen Benachteiligung. Diese kann eine traumatisierende Wirkung nach sich ziehen, die sich durch gezielte Mythologisierungsprozesse auch generationenübergreifend erhält. Man wird zu einer „ethnischen Schicksalsgemeinschaft“. Weiterhin wirkt in Kombination mit dieser erlebten Herabsetzung das Ausmaß der Gruppenkohäsion und Gruppenidentität maßgeblich auf den Konflikthergang ein. Auch hier spielt Mythologisierung eine tragende Rolle: Erinnerungen an „heroische“ Zeiten stärken das kollektive Selbstwertgefühl, der Zusam-menhalt auch in schwierigen Phasen wird verstärkt. In der Literatur werden diese auf Mythologisierungsprozessen beruhenden Entwicklungen als „chosen traumas“ und „chosen glories“ bezeichnet.
Die Person des Sabino Arana stellt einen charismatischen Führertyp dar, der diese beiden „Methoden“ in vollem Maße zur politischen Mobilisierung der latent nationalistischen, unzufriedenen baskischen Bevölkerung einsetzt. Seine „Färbung“ der baskischen Geschichte und größenwahnsinnige Aufwertung der baskischen Rasse mit gleichzeitiger Abwertung der „bedrohenden Aussätzigen“ schafft eine ideale Projektionsfläche für die Überwindung der kollektiven Kränkungen seiner Anhänger. Dieser Führertyp stößt nach psychoanalytischer Forschung in Krisensituationen auf besondere Resonanz bei der angeschlagenen Bevölkerung, was sich im vorliegenden Konflikt bestätigt sieht.
Bei Gedanken zur Konfliktregelung in Gegenwart und Zukunft sollte dieser Faktor nicht unberücksichtigt bleiben: Die Frage, inwieweit handlungsfähige Repräsentanten für eine bestimmte Gruppe existieren und die Intensität ihrer Verbindung zur Basis bildet einen wichtigen Ansatzpunkt für bestimmte Elemente der Konfliktbearbeitung, wie z.B. den Versuch des Herauslösens einzelner Mitglieder aus einer terroristischen Vereinigung oder die Chancen für Kompromissangebote an die Bevölkerung.
Die Empfindung einer kollektiven Identität wird also während und nach der Zeit des Sabino Arana intensiviert und politisiert. In der Zeit des Franco-Regimes wird diese samt dem gerade ausgereiften „Nationalstolz“ nicht nur – wie es zu Zeiten der Industrialisierung und Immigration empfunden wurde – gefährdet, sondern vollständig negiert. Die baskische Muttersprache, eigene Institutionen, alles was Ausdruck der Kultur war, die die Menschen dort lebten, wird verboten – die Ethnie wird in ihrer Existenz bedroht. Der daraus entstehende Kampf gegen die vollständige Assimilation eskaliert im entsprechenden Maße. Diese existentielle Bedrohung macht den baskischen Konflikt zu einem Identitätskonflikt, der sich nach Francos Ende verselbstständigt. Im Gegensatz zu reinen Interessenkonflikten, die sich prinzipiell durch ein Mehr oder Weniger an gegenseitigen Zugeständnissen bearbeiten lassen und nicht selten durch einen Interessensausgleich aus der Welt geschafft werden können, geht es in Identitätskonflikten um „Alles oder Nichts“. Grundsätzliche Werte und Gefühle von Sicherheit und Wohlbefinden stehen zur Disposition und werden mit kompromissloser Härte verfochten. In der Realität lassen sich diese beiden Konflikttypen oft schwer trennen und werden zudem von weiteren Faktoren beeinflusst. Man kann im baskischen Fall, besonders heute, wo durch weitgehende Autonomiezugeständnisse und eine demokratische spanische Regierung im Prinzip keine existenziellen Identitätsbedrohungen mehr präsent sind, von einer Mischform ausgehen. Insbesondere (wie die obige Interessendarstellung zeigt) die institutionalisierte baskische Interessenvertretung, wie auch die Mehrheit der baskischen Bevölkerung hat sich im Laufe der Zeit von der „Alles oder Nichts“ – Ideologie entfernt und strebt nach einer friedlichen Lösung bei möglichst weitgehender Berücksichtigung der eigenen Interessen. Die Intensität der konfliktiven Entwicklung während der Franco-Zeit hate eine eigene Eskalationsdynamik entwickelt, die sich durch Neigung zur Projektion des Negativen, zur Vereinfachung der Struktur der Kontroversen und zur Personifizierung des Streits noch weiter verstärkt. Beispielhaft für letzteres sind Erzählungen von ETA-Mitgliedern, die von plötzlich ungeahnt konzentrierten Hassgefühlen gegen einzelne Opfer berichten. Die oben beschriebene Mythologisierung wirkt wiederum maßgeblich auf diese Eigendynamik ein: Die eigene Identität wird im Rahmen der vorhandenen Überlieferungen, Vorstellungen und Erfahrungen konstruiert, es wird sich so eine eigene Realität geschaffen. In deren Kontext werden nun bestimmte gesellschaftliche Ereignisse interpretiert und eine Kontinuität zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erstellt, die sich in das konstruierte Bild einfügt (so zeigt auch zum Beispiel das einsetzende erhöhte Interesse am historischen Kontext der Bürgerkriege und der Arana-Zeit von Seiten der Generationen, die sie nicht miterlebt haben). Die soziale Realität wird nach Franco weiter als Unterdrückung der baskischen Kultur und Gesellschaft durch die Macht der zentralspanischen Regierung interpretiert, das Misstrauen wird durch den Übergang zur Demokratie kaum abgeschwächt. Durch die Neigung zur Vereinfachung der Konfliktstruktur erfolgt keine intensive Differenzierung – die Eskalationsdynamik hat sich bereits verselbstständigt.
Die Unnachgiebigkeit der Ausfechtung ethno-politischer Konflikte erklärt sich schlussendlich mehr aus der Dynamik ihres Verlaufs als aus rationalen oder inhaltlichen Gründen. Hinzu kommt außerdem meist eine Vielzahl von Konfliktgegenständen, so zum Beispiel auch der - für langjährige „hartnäckige“ Konflikte charakteristische – Konflikt um die Konfliktlösung. Es geht auch im vorliegenden Konflikt nicht mehr allein um den gemeinsamen Kampf gegen die spanische Zentralregierung, längst hat sich auch eine innerbaskische Auseinandersetzung herausgebildet. Es besteht Uneinigkeit über das Maß der Gewaltanwendung, das nationalistische Lager ist gespalten, die ETA verübt auch Anschläge auf „abtrünnige“ Mitglieder und auf die baskische Polizei (Ertzaintza). Diese Faktoren verstärken zusätzlich die Komplexität und müssen bei der Konfliktbearbeitung im Blick behalten werden.
4. Konfliktregelungsansätze
4.1 Ressourcentheorie
a) Ressourcenzufuhr
Ansätze, die sich auf die Zufuhr von Ressourcen zur Prävention, Deeskalation und Transformation von Konflikten konzentrieren, legen die Annahme zu Grunde, die Anwendung von Gewalt stelle eine Notressource für sonst unter Ressourcenarmut leidende Gruppen dar. Die daraus folgernde Konsequenz ist, diese Ressourcenarmut auszugleichen, wodurch das Erfordernis des Zugriffs auf die Notressource nicht mehr bestände.
Die Definition der Ressourcen erfolgt dabei nicht (nur) im gängigen Sinne, sondern ist abhängig von der Konfliktkonstellation. Es kann sich um materielle Zugeständnisse handeln, aber auch weitergehende Elemente umfassen. Im hier behandelten Konflikttyp wären dies zum Beispiel bestimmte legale und administrative Kompetenzen, die Absicherung der sprachlichen und kulturellen Eigenständigkeit und weitere Konzessionen, die die Bewahrung der kollektiven Identität absichern.
Erfahrungsgemäß stößt diese Strategie bei radikalen Terrorgruppen mit ethnisch-nationalistischem Hintergrund auf weniger Erfolg, da die „Alles oder Nichts“ – Ideologie wenig Interesse an Zugeständnissen im kleineren Rahmen zeigt. Die Erreichung des Endziels wird meist nicht aus den Augen verloren, was als Konsequenz eher noch eine Erhöhung der Forderungen erwarten lässt. Dies zeigt sich im vorliegenden Konflikt zum Beispiel bestätigt in der ablehnenden Haltung der ETA gegenüber dem umfassenden Autonomiestatut von 1979, das damals in der Bevölkerung durchaus auf große Zustimmung stieß. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit stellt die Ablehnung des Ibarretxe – Plans dar, auf den im Folgenden noch näher eingegangen wird.
Bei der Bevölkerung der „vertretenen“ Minderheit, sowie den gemäßigten politischen Parteien und gegebenenfalls auch den Muttergruppen der terroristischen Verbände scheint die Ressourcetheorie deutlich aussichtsreicher. Diese Konfliktparteien hegen durchaus Interesse an einer auf – mehr oder weniger - gegenseitigen Zugeständnissen beruhenden Konfliktlösung. Da zwischen den verschiedenen Beteiligten und Betroffenen im gleichen Lager (hier: baskische Bevölkerung, gemäßigte Parteien, radikale Parteien, ETA) stets ein instabiles Stimmungsgleichgewicht herrscht und die Intensität der Gewaltakzeptanz und Solidarisierung je nach Konfliktverlauf stark schwankt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, den für die Terrororganisation lebenswichtigen Rückhalt in Politik und Bevölkerung durch Ressourcenzufuhr zu schwächen und die kollektive Stimmung in Richtung Kooperation zu lenken.
b) Basic-Needs-Ausgleich
Die Basic-Needs-Theorie stellt eine Variante der Ressourcentheorie dar und stützt sich auf die gleichen Vorannahmen. Es wird angenommen, dass die Ursache tief verwurzelter sozialer Konflikte in der Missachtung bestimmter menschlicher Grundbedürfnisse liegt, die sich nicht verhandeln lassen. Zu diesen „basic needs“ zählen Sicherheit, Identität und Partizipation. Unverzichtbar für eine konstruktive Konfliktregelung ist demnach also die beidseitige Gewissheit, in diesen Grundbedürfnissen nicht angegriffen oder eingeschränkt zu sein.
Der spanisch-baskische Konflikt, sowie auch der Konflikt in Nordirland zeigen Beispiele von Spannungsverhältnissen, die sich aus einem solchen Bedrohungsgefühl heraus radikalisiert haben. Die in den beiden Konflikten agierenden Terrororganisationen ETA und IRA sind der militanteste Ausdruck sich in ihrer kollektiven Identität bedroht fühlenden Subkulturen. In beiden Fällen waren diese in ihrer jüngeren Geschichte in einem bestimmten Augenblick einer harten Unterdrückung ausgesetzt, die ihre „basic needs“ missachtete und negierte.
Auch, und gerade bei langjährigen Konflikten sind diese Grundbedürfnisse unverhandelbar und wirken dadurch gegebenenfalls destruktiv in Kompromissverhandlungen. Die umstrittenen Konfliktthemen sind daher dafür so zu transformieren, dass die „basic needs“ herausgearbeitet werden, im Anschluss daran müssen beidseitig akzeptable Möglichkeiten zu deren Befriedigung entwickelt werden. Oft lässt sich dabei feststellen, dass die Konfliktgegenstände und deren Gewichtung von den Konfliktparteien sehr unterschiedlich beschrieben werden. Es besteht dadurch die Möglichkeit, dass bestimmte Konzessionen, die ein „basic need“ – Defizit tangieren und im Idealfall ausgleichen, für die andere Konfliktpartei keine größeren Einbußen bedeuten, der Nutzen – Effekt also wesentlich größer ist als die eigene Einschränkung durch diese Zugeständnisse.
Ein wichtiger erster Schritt ist demzufolge zunächst die intensive und gemeinsame Beschäftigung mit der Frage „Worum geht es eigentlich für uns bei diesem Konflikt?“ – die Thematisierung der tiefer liegenden Motive des Konfliktverhaltens.
c) Konsolidierung der Übernahme von Regierungsverantwortung
Ressourcenzufuhr in Form von Regierungsverantwortung beinhaltet etwa die Übertragung sämtlicher in der Verfassung und anderen Vereinbarungen eingeräumten Kompetenzen in vollem Umfang. Dazu zählt die Ausrüstung mit Institutionen wie einer eigenen Sicherheits- und Kriminalpolizei, mit Basken besetzten Gerichten, Staatsanwälten und Strafvollzugsbehörden, die Bereitstellung erforderlicher Personalstellen und Sachmittel etc., zur vollen effektiven Wahrnehmung der baskischen Administrationsaufgaben.
Dieser Konflikttransformationsstrategie liegt die Annahme zugrunde, dass sich der baskische Terrorismus wegen der Ablehnung gegenüber Spanien am besten von Basken selbst und durch von ihnen kontrollierte Institutionen bekämpfen lässt. Untersuchungen haben ergeben, dass die Erfolgsaussichten für Rebellenorganisationen, die sich gegen eine fremde, als Besetzungsmacht empfundene Regierung wenden, deutlich höher sind, als für die, die sich gegen die eigene Regierung wenden. Viele der konfliktiven Motive (s.o.) fallen aus, infolgedessen besteht eine deutlich geringere emotionale Teilhabe und Unterstützung.
Der im September 2000 beschlossene Staatspakt gegen die ETA, der unter Ausschluss der nationalistischen Parteien stattfand, war unter diesen Gesichtspunkten ein strategisch ungünstiges Vorgehen und wird mitverantwortlich gemacht für weitere Gewaltaktionen der ETA. Mitbegründend für diesen Ausschluss war damals auch die Hoffnung, die nationalistische Minderheitenregierung abzulösen. Solche, von der baskischen Regierung als klare Absage an die Autonomie empfundenen Handlungen wirken kontraproduktiv und führen zu einer Annäherung der moderaten und radikal-nationalistischen Flügel innerhalb der baskischen Interessenvertretung.
Voraussetzungen für ein Funktionieren eines solchen Vertrauensvorschusses in Form von Kompetenzzuschreibungen sind jedoch, dass die mit Verantwortung betrauten politischen Organe sowohl diese Gestaltungsmöglichkeiten voll ausschöpfen, als auch Distanz zum radikal-terroristischen Sektor halten.
Letzteres Risiko lässt sich nicht völlig ausräumen, es besteht aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in erster Linie im Interesse der jeweiligen Regierung liegt, diesen Hoheitsanspruch nicht zu gefährden. Dem zuträglich wäre z.B. auch die Schaffung eines dem spanischen Innenministerium unterstellten baskischen Geheimdienstes zur Auskundschaftung und Verhinderung terroristischer Machenschaften.
Im baskischen Fall ist dieses Konzept in Teilbereichen bereits verwirklicht worden, der baskische Regierungschef Ibarretxe distanziert sich 2001 ausdrücklich von den Radikalen und schließt jede Zusammenarbeit aus, solange der ETA – Terrorismus nicht verurteilt wird.
Über ein Zusammenstehen der demokratischen baskischen Parteien im Kampf gegen den Terror besteht im Grundsatz Konsens. Durch „Demokratieverdrossenheit“ und aktuelle Entwicklungen im Konfliktverlauf verursachte Stimmungsschwankungen lassen sich nach der Ressourcentheorie durch gezielte Strategien vermeiden. Hierbei ist zu beachten, dass Legitimität ein schlecht teilbares „Gut“ ist: Ein Prestigegewinn des radikalen Sektors zieht einen schleichenden Verlust an Legitimität der Regionalregierung nach sich; ein – durch gezielte Stärkung beeinflussbarer – Zugewinn an Prestige der legalen politischen Vertretung schwächt die gegenseitige Solidarisierung und den Rückhalt der radikalen Nationalisten.
d) Ibarretxe – Plan
Ein Konzept einer solchen Konsolidierung weiterer Regierungsverantwortung stellt der von dem baskischen Regierungschef Juan José Ibarretxe 2003 entworfene Ibarretxe-Plan zur Zukunft des Baskenlandes dar:
Dieser fordert das Modell einer an Spanien frei assoziierten Nation innerhalb eines plurinationalen Staates auf der Grundlage einer geteilten Souveränität. Dazu gehören u.a. die politisch-rechtliche Anerkennung einer baskischen Nationalität; eine eigene baskische Justizgewalt; die ausschließliche Zuständigkeit für die Bereiche der Kultur, Sprache und Erziehung; das Recht zur Unterzeichnung internationaler Verträge und die eigene Repräsen-tation und Partizipation des Baskenlandes in den EU-Institutionen, sowie auch eine Reform des baskischen Autonomiestatuts und die Erzielung der demokratischen Legitimität über ein Referendum der baskischen Gesellschaft.
Dafür sollte in einen Aushandlungsprozess mit dem spanischen Staat getreten werden, um unter Berücksichtigung der demokratischen Mehrheit der baskischen Gesellschaft einen politischen Pakt zu erreichen und zu ratifizieren.
Die Reaktionen darauf fielen zunächst negativ aus (u.a. erfolgte eine Ablehnung von der EU-Kommission), es besteht ferner keine Einigkeit über ein ggf. im Plan impliziertes Erfordernis einer Verfassungsreform (hierzu im Folgenden genauer).
e) Autonomie – Theorie
Weder auf Grundlage der Verfassung noch auf der Basis des internationalen Rechts existiert in der spanischen Rechtsordnung ein Recht auf Selbstbestimmung. Dennoch würde für die Schaffung einer vollständigen baskischen Autonomie als Methode der Konfliktbeilegung sprechen, dass ein demokratischer Staat doch einen Teil seiner Bevölkerung, der sich eindeutig von ihm loslösen möchte und dies auch deutlich artikuliert, nicht dazu zwingen kann, innerhalb dieses Staatsverbandes zu bleiben.
Bezieht man diese Möglichkeit in die Liste der Regelungsstrategien mit ein, würde an erster Stelle die Voraussetzung der langfristigen Schaffung einer gewaltfreien Situation stehen. Auf dieser Basis könnte daraufhin ein Volksreferendum der baskischen Bevölkerung durchgeführt werden, das deren Interessenlage angemessen erforscht. Hierfür könnten die vom Kanadischen Obersten Gerichtshof 1998 (als Antwort auf eine Bitte der kanadischen Regierung um Stellungnahme) formulierten Kriterien für die Unabhängigkeit der französischsprachigen Provinz Quebec zur Orientierung dienen. Eine unilaterale Sezession Quebecs aus dem kanadischen Staatenverband wurde damals eigentlich als verfassungswidrig deklariert, dennoch nannte der Oberste Gerichtshof einige Kriterien, unter deren Bedingung dieser Sezession doch politische Legitimität verliehen werden könnte. Diese legen fest, dass ein Volksreferendum eine klare Frage zu enthalten habe und mit einer ausreichenden Mehrheit zugunsten der Sezession abgeschlossen werden müsste. Daraufhin könne in einen diesbezüglichen Verhandlungsprozess eingetreten werden.
Grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass, sofern durch dissoziative Konfliktregelung Blutvergießen verhindert werden kann, die Kriterienentwicklung zur Ermöglichung einer gewaltfreien Trennung und die Schaffung innenpolitischer Stabilität unter den neuen Grenzen im allgemeinen Interesse liegen sollte. Fraglich ist dabei aber, welche Konfliktregelung für die Betroffenen mit der größten Akzeptanz und den geringsten Kosten verbunden ist und ob eine Auflösung der bestehenden Grenzen in letzter Konsequenz die einzige Lösung darstellt.
Zu berücksichtigen ist die bereits bestehende, umfassende Bestandsgarantie der spanischen Verfassung bezüglich der regionalen Verwaltungsebene. Ähnlich dem deutschen System (Gebietsbestand, Kompetenzen…) ist sie dort verankert und kann nicht, wie zum Beispiel die nur auf einfachgesetzlicher Grundlage beruhende Gebietskörperschaft in Irland, jederzeit von dem gesamtstaatlichen Gesetzgeber abgeschafft werden. Die Dezentralisierung ist auch nicht nur administrativ bedingt, sondern beinhaltet die politische Regionalisierung inklusive der legislativen und exekutiven Befugnisse für die Regionen.
Das Autonomiestatut von 1979 kam mit umfassenden und fest institutionalisierten Garantien der baskischen Autonomiebewegung bereits sehr entgegen, der dort verankerte Kompetenzumfang ist weitgehender, als die im Karfreitagsabkommen von Nordirland 1998/99 getroffenen Vereinbarungen, die dort letztendlich zur Gewalteindämmung führten und die Konfliktbeilegung maßgeblich förderten. Der nun noch verbliebene Spielraum für Verhandlungen und Zugeständnisse im vorhandenen Rahmen ist sehr eng: Es gibt kaum mehr Möglichkeiten der Annäherung außerhalb des völligen Autonomiezugeständnisses. Der baskische Konflikt hat eine andere Dimension erreicht.
Die Maximalforderungen nach einer Sezession von Spanien sind aus der Sicht der spanischen Regierung nicht erfüllbar. Zunächst stände dies im Widerspruch zum in der Verfassung verankerten Prinzip der territorialen Einheit[4], ein weiterer Grund wäre die Schaffung eines Prototyps, was größere Probleme z.B. im Umgang mit Katalonien nach sich ziehen könnte.
Der erfolgreichen Durchführung eines Volksreferendums nach dem Vorbild der kanadischen Provinz Quebec stehen weiterhin einige Hindernisse im Weg. Gemäß der spanischen Verfassung müsste zunächst die Initiative für ein solches Referendum vom spanischen Staat ausgehen. Diese Wahrscheinlichkeit ist bereits gering. Weiterhin ist abzusehen, dass sich aus diesem Volksreferendum keine Mehrheit für eine baskische Autonomie ergeben wird (nur ca. 25 % der Bewohner des Baskenlandes befürworten diese).
Schlussendlich stellt sich überhaupt die Frage nach dem Konfliktbeilegungspotential einer solchen Autonomieregelung. Im Hinblick auf das bi-ethnische Zusammenleben, die bereits jetzt herrschenden starken internen Spannungen, sowie das kulturelle Selbstverständnis der Ethnien wäre dies jedenfalls kritisch zu reflektieren.
4.2 Verlagerung der Konfliktachse
Das nahe Ziel der Konfliktachsen-Verlagerung als Regelungsansatz ist in einem ersten Schritt gar nicht die absolute Befriedung. Es wird sich zunächst auf die Unterbrechung sich kontinuierlich wiederholender, eingeschliffener Verhaltensmuster konzentriert. In diesem Fall wäre das das außer Kraft Setzen der verselbstständigten Gewaltspirale.
Die konflikt-abschwächende Wirkung von Verlagerungsstrategien ist bewiesen. Dazu müssen festgefahrene Konfliktstrukturen aufgebrochen werden und Maßnahmen getroffen werden, die zu einer Neubewertung der Konfliktpartner führen, um auf dieser Basis schließlich in Verhandlungen eintreten zu können, die nicht durch hartnäckig verwurzelte Einstellungen und Einschätzungen von vorneherein zum Scheitern verurteilt sind. Erforderlich ist eine Veränderung des soziopolitischen Umfeldes.
Eine Möglichkeit dieser Achsenverschiebung ist das Auftreten eines gemeinsamen Feindes (von außen). Ein Beispiel hierfür stellt im baskischen Konflikt der als Resultat auf die Autonomiezugeständnisse der Republikaner erfolgte gemeinsame Kampf mit den Basken gegen die franquistischen Truppen im spanischen Bürgerkrieg dar. Die Arana-Bewegung hatte bereits ausreichend Konfliktpotential gesät und die Basken standen schon damals im Zwist mit der spanischen Regierung, was als erste Konsequenz den Wunsch nach einem Putsch verständlich machen würde. Im Baskenland wurde sich aber nicht erst, als im Krieg das volle Ausmaß der brutalen franquistischen Machenschaften deutlich wurde, auf die Seite der republikanischen spanischen Regierung gestellt, sondern bereits von Anfang an. Die Mischung aus staatlichen Zugeständnissen und der plötzlichen Erscheinung eines zusätzlichen Konfliktpartners ließ den historisch verankerten Hass auf Spanien und die ursprünglichen Konfliktfronten in den Hintergrund treten.
Ein weiteres Beispiel sind die Anschläge in Madrid vom 11.03. 2004, deren Verschulden die ETA massiv dementierte (sogar zwei Dementis erfolgten, was erfahrungsgemäß ungewöhnlich ist). Die ETA und die gesamte radikal-nationalistische baskische Front zeigten sich zutiefst erschüttert und distanzierten sich ausdrücklich von einer derartigen Vorgehensweise. Auf die Idee, in der kommenden Zeit Anschläge zu verüben, kommt niemand im ETA-Lager. Die berechtigte Frage an die ETA nach dem Grenzverlauf tolerierbarer Gewaltanschläge, gestellt vom gemäßigten PNV – Präsidenten Josu Jon Imaz, gibt zu denken.
Hieran anknüpfend gibt es eine weitere Art der Verschiebung der bestehenden Konfliktachse. Im Gegensatz zum Auftreten eines gemeinsamen Feindes von außen, wird dort die Konfliktachse innerhalb des Konflikts verschoben. Dies kann zum Beispiel erfolgen durch von der Bevölkerung nicht tolerierte Terroranschläge, die die Stimmung verändern und die Abneigung gegenüber der Gewaltorganisation bekräftigen, wodurch (aufgrund der oben erläuterten Unteilbarkeit der Legitimität) das ursprüngliche „Gegenlager“ nicht mehr im vollen Ausmaß als bedrohlich empfunden wird.
Um eine solche Entwicklung zu begünstigen, gibt es von Regierungsseite die Strategie der Bekämpfung und Isolation der Terroristen bei gleichzeitiger Kooperation mit dem moderat-nationalistischen Lager. Hiermit wird sich im Folgenden auseinandergesetzt.
4.3 Bedrängnis der Terroristen / Isolation
Zur Bedrängung der Terrororganisation empfehlen Ansätze, die diese Strategie in den Katalog konstruktiver Konfliktbeilegungsmaßnahmen integrieren, verschiedene konkrete Vorgehensweisen. Dazu zählt zum einen die vermehrte Kontrolle der extraterritorialen Zonen jenseits der Staatsgrenzen, die zu Flucht und Rückzug gesuchter Terroristen beitragen könnten. Die Kooperation mit dem Nachbarland hat sich diesbezüglich, auch im Falle Spanien – Frankreich, gut bewährt.
Weiterhin kann versucht werden, potentielle Beitrittskandidaten abzuschrecken und die bestehenden Anhänger der Gewaltorganisation durch Strukturreformen von ihrer Trägerbasis zwecks deren „Austrocknung“ herauszulösen, um deren Führung zum leichteren Einlenken zu bewegen (erhöhte Kompromissbereitschaft in Schwächezeiten zeigt sich am Bespiel der geschwächten ETA Ende der 80er). Dies funktioniert noch am besten in der Entstehungs- und Aufschwungphase, später wird es schwierig, die Terroristen aus dem Untergrund zu locken, um eine institutionelle Lösung anzustreben.
Möglichkeiten für solche strukturellen Veränderungen sind staatliche Integrationsange-bote für Aussteiger (dies hat sich am besten in geschwächten Zeiten der Terrororganisa-tionen bewährt - gerade in Spanien!) und auch energische staatliche Sanktionsmaßnahmen für Mitglieder. Integrationsmaßnahmen zur Ablösung Einzelner sind umso erfolgreicher, je weniger Loyalitätsdruck noch von Seiten der Organisation wahrgenommen wird. Beispielhaft hierfür ist die seit Ende der 80er praktizierte getrennte Inhaftierung, wodurch eine deutlich höhere Bereitschaft zur Annahme von Strafnachlass durch Lossagung und Integrationshilfen verzeichnet werden kann. Als letzte Möglichkeit der „aktiven“ Terrorbekämpfung wenn Isolationsstrategien keinen Erfolg zeigten, lässt sich die Empfehlung finden, Terroristen einfach wie gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Dies hat jedoch zum Einen im nordirischen Konflikt keine konstruktive Wirkung gezeigt und ist kostenaufwändig, weiterhin ist in derart komplexen Konflikten, die sich über eine langen Zeitraum hinweg erstrecken und aus einer Vielzahl von rationalen und wertbezo-genen Konfliktgegenständen bestehen, ein differenzierteres und ursachenbezogenes Vorgehen erforderlich.
Eine weitere Verfahrensweise wäre die Institutionalisierung bestimmter Sonderregelungen für Terroristen. Mit Blick auf die Verfassung gesehen kritisch, muss darauf geachtet werden, dass sich nicht auf eine Stufe mit den Radikalen gestellt wird. Methoden nach Manier der GAL in den 80er Jahren machen den Rechtsstaat unglaubwürdig und bringen mehr Schaden mit sich, als Nutzen - eine gewalttätige Polizei des Zentralstaats verstärkt den Eindruck des militarisierten Unterdrückerstaates und verhilft der Rebellenorganisation zu neuen Sympathien. Beispielhaft hierfür ist auch der hart von israelischen Sicherheits-kräften niedergeschlagene palästinensische Aufstand 1987 (Intifada), der eine Reihe von stark frequentierten palästinensischen Widerstandsorganisationen nach sich zog.
Soll die demokratisch rechtsstaatliche Ordnung nicht zugunsten der Verfolgung und Unterdrückung terroristischer Gruppen geopfert werden, muss sich von dem Gedanken einer endgültigen „Ausmerzung“ des Terrorismus verabschiedet werden. Gerade weil Demokratien politische Protestbewegungen zulassen und die Grundrechte schützen, können sie auch nicht verhindern, dass gelegentlich auftauchende und ihr Unwesen treibende kleine Gruppen diese Bedingungen für kriminelle Zwecke missbrauchen.
Zudem bleibt auch noch bei noch so starker Kontrolle und Einschränkung der Rückgriff auf die Ressource Gewalt, was die Wahrscheinlichkeit der Einlenkung als Konsequenz auf Einbußen verringert. Die Doppelstrategie der Spanier, die sich zwischen Konzessionen und Terrorbekämpfung bewegt, hat sich bei Betrachtung des Konfliktverlaufs nicht bewährt. Die Beharrung der ETA auf den Maximalforderungen und Ablehnung geringerer Zugeständnisse wirkte in Verbindung mit der Überzeugung der Spanier, die ETA durch ausreichende Schwächung im Endeffekt doch militärisch besiegen zu können, kontraproduktiv und hemmend auf die Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Konfliktbeilegung. Bei Friedensverhandlungen hat sich vielfach die Einbeziehung aller politischen Akteure, auch der radikalen, zur Konfliktentschärfung bewährt (u.a. in Nordirland, wo in den 90ern erstmals die Sinn Féin an den Gesprächen beteiligt wurde), der Ausschluss einzelner birgt bereits wieder neues Konfliktpotential und schwächt die Legitimität und weiträumige Akzeptanz der getroffenen Vereinbarungen.
Weiterhin ist zu beachten, dass Schwächephasen terroristische Gruppen nicht zwangsläufig ungefährlicher machen. Oft entsteht daraus gerade erst der Drang, die ungebrochene Handlungsfähigkeit zu beweisen, es kommt dann verstärkt zu Gelegenheitsterrorismus. Aus Gründen der Ressourcennot sind keine selektiven, gut geplanten Anschläge auf geschützte Staatsrepräsentanten möglich, daher wird zu willkürlichen Handlungen gegriffen.
Initiatives Vorgehen der zentralstaatlichen Regierung zur Gewalteindämmung und Terrorbekämpfung ist unbestreitbar wichtig (so gibt es zum Beispiel Kritik an Aznar, der ETA während des Waffenstillstandes zu viel Initiative überlassen habe). Inkonsistenzen im politischen Handeln schwächen die staatliche Glaubwürdigkeit und geben den Terroristen damit mehr Möglichkeiten, auf das politische Kräftespiel durch gezielte Aktionen Einfluss zu nehmen. Dennoch sollten die Grenzen der Terrorbekämpfung nicht aus den Augen gelassen werden und ihre Folgen innerhalb eines umfassenden Konfliktbeilegungsprozesses genaustens geprüft werden, um Kontraproduktivität und Rückschritte zu vermeiden.
4.4 Friedensverhandlungen
Konfliktbearbeitung auf diese Weise kann sich nur auf politisch verhandelbare Themen beziehen. Es existiert daher nach wie vor das Problem der tiefen psychosozialen Verwurzelung, die die Berücksichtigung angemessener Mechanismen erfordert. Fraglich ist zunächst, wer an solchen Verhandlungen beteiligt werden sollte. Wie bereits erwähnt, hat sich im Nordirland-Konflikt der Friedensprozess erst konstruktiv in Gang gesetzt, als IRA und Sinn Féin nicht mehr ausgeschlossen wurden, vorher sind sämtliche tragfähigen Dialoge gescheitert. Dennoch gibt es auch einige Gründe, die gegen einen Eintritt in Verhandlungen mit radikalen politischen Akteuren sprechen.
Hierzu zählt, dass diese dadurch politisch aufgewertet werden und in ihrer selbst ange-maßten Funktion als Vertreter einer gesamten Ethnie noch verstärkt werden. Dieser Zuge-winn an Prestige könnte im schlimmsten Fall der einzige Grund für die Teilnahme an solchen Verhandlungen sein, was diese nutzlos und gegebenenfalls sogar noch kontrapro-duktiv macht, da als Folge eines Prestigegewinns der Terrororganisation keine Gefügig-keit und Kompromissbereitschaft zu erwarten ist – im Gegenteil. Zudem gibt es immer das Problem des Präzedenzfalles. Sobald terroristische Methoden zu Zugeständnissen und offenen Ohren führen, könnte dies – gerade in Spanien – fatale Folgen nach sich ziehen. Weiterhin fragt sich, wie weit es Sinn hat, mit von der „Alles oder Nichts“ – Mentalität getragenen Terrorverbänden kompromissorientierte Gespräche zu führen. Diese Ideologie und die dazugehörigen Verhaltensorientierungen bilden die zentrale Basis ihres Selbstver-ständnisses, es zeigt sich auch in der baskisch-spanischen Geschichte des Öfteren die ETA als letztendlich blockierender Faktor bei weitgehenden Konzessionsangeboten, da sie nicht zu einer Abrückung von den Maximalforderungen bereit war.
Trotz all dieser Bedingungen lässt sich bei Friedensgesprächen unter Einbeziehung der radikalen Akteure eine höhere Erfolgsquote beobachten, als bei ausschließenden Verhand-lungen. Am Beispiel des Nordirland-Abkommens von 1998 lässt sich dies besonders deutlich zeigen.
Der dortige Ansatz der Konfliktregulierung basierte auf der politisch ausgehandelten und legitimierten Verrechtlichung des Konflikts unter Ausschaltung der Gewaltebene. Da-durch wandelte er sich von einem informellen Konflikt mit Gewalteinsatz als Artikula-tionsmethode zu einem institutionalisierten Konflikt, der die zum Einsatz kommenden Konfliktmittel auf der Basis gesellschaftlicher Akzeptanz normiert und durch formelle Regeln kanalisiert.
Wie bereits erwähnt, kam dieser Prozess erst in Gang, als die radikalen Akteure, IRA und Sinn Féin, nicht mehr vom Verhandlungsprozess ausgeschlossen wurden. Hierzu wurde zunächst, durch oben genannte Schwierigkeiten der Gespräche mit Terroristen motiviert, nicht direkt in Verhandlungen mit der IRA eingetreten, sondern über pragmatische Realisten innerhalb der Sinn Féin der Weg ins Gespräch gefunden. Später, innerhalb einer umfassenden Strategie der Konflikteindämmung, wurden auch Dialoge mit der IRA eingeschlossen. Die Verhandlungen in Nordirland boten nicht nur für den dortigen Konflikt eine entscheidende Wende zur Beendigung des langwierigen Kampfes, sondern beeinflussten die weitere Entwicklung im Baskenland auch maßgeblich. Die ETA sah, dass die IRA ihre Ziele nun über politische Wege zu erreichen versuchte und damit auch Erfolg hatte. Verstärkend kam hinzu, dass die Bedingung der Spanier für Verhandlungen, nämlich erst einen Waffenstillstand zu erklären, von allen nationalistischen Parteien außer der HB unterstützt wurden und die Solidarität mit der ETA innerhalb der baskischen Bevölkerung in den 90er Jahren weiter zurückgegangen war. Ein von Regierungschef Ardanza 1998 entworfener Plan zu einem stark an Nordirland angelehnten Friedensdialog mit ebenfalls Waffenstillstand als Voraussetzung wurde von ETA und HB befürwortet und von der spanischen Regierung mit der Begründung einer Forderung nach endgülti-gem, bedingungslosem Waffenstillstand abgelehnt. Diese verhielt sich im Gegensatz zur britischen und irischen Regierung eher unflexibel und setzte weiterhin auf sicherheitspoli-tisches Handeln und Versuche, das nationalistische Lager zu spalten. Als Resultat trat hin-gegen eher das Gegenteil ein: Es erfolgte einer Annäherung der Nationalisten, das von der HB initiierte „Irland Forum“ beteiligte sämtliche politischen Akteure des Baskenlandes an einem breiten Dialog über die Zukunft des Baskenlandes im irischen Licht und hatte als Folge den gemeinsamen Lizarra-Pakt der Nationalisten sowie den damit einhergehenden Waffenstillstand der ETA.
Dennoch scheiterten die daraufhin einsetzenden Verhandlungen mit der spanischen Regierung wiederum. Es stellt sich die Frage nach den Gründen für ein Funktionieren dieses Dialoges in Nordirland und das gleichzeitige Scheitern in Euskadi. Abgesehen von einigen grundlegenden Unterschieden in den Konfliktkonstellationen fällt hier zunächst ins Gewicht, dass die IRA (nicht zuletzt auch aus Gründen der schlechten Aussichten, was den bewaffneten Kampf betrifft) von einigen ihrer Maximalforderungen zurücktrat, was bei der weniger pragmatischen ETA nicht der Fall war und ist. Auch die Spanier inter-essiert jedoch in erster Linie der Waffenstillstand – es besteht kein wirkliches Interesse an den gegenseitigen Motiven und keine ausreichende Kommunikationsbereitschaft. Hinzu kommt die für Sinn Féin wichtige internationale Unterstützung von Seiten der Republik Irland und der irisch-stämmige Bevölkerung der USA, die auch als einflussreiche Media-toren fungierten. Dieses internationale Interesse besteht für Euskadi nicht. Als Konse-quenz lässt sich zunächst festhalten, dass die Bereitschaft der beteiligten Konfliktakteure, Verhandlungen ohne unverhandelbare Vorbedingungen zu führen, eine wichtige Voraus-setzung für konstruktive Gespräche ist. Die Hochsensibilisierung, das gegenseitige Miss-trauen und die daraus resultierende Zurückhaltung führen zu keinen annehmbaren Ergeb-nissen. Beispielhaft hierfür sind die baskischen Friedensgespräche in Algier, die sogar unter Vermittlung eines algerischen Regierungsvertreters stattfanden. Trotz Annäherun-gen der Positionen (z.B. was Amnestie für ETA-Mitglieder betraf) waren in den entschei-denden Punkten beide Parteien unverändert misstrauisch und unkooperativ. Eine Möglich-keit wäre, durch gegenseitige Sicherheitsgarantien, die von einer neutralen Instanz (in Nordirland gab es die Mitchell-Kommission) überwacht werden, eine Vertrauensbasis für Verhandlungen zu schaffen. Dringend erforderlich ist die Bereitschaft der Nationalisten, von ihren Maximalforderungen abzurücken und den bewaffneten Kampf auf lange Sicht aufzugeben (lässt sich z.B. absichern durch vertragliche Verankerung und Abgabe der Waffen). Umgekehrt müsste die spanische Regierung von ihrer Strategie der Isolation abrücken und die Legitimierung der ETA in Kauf nehmen, um das Konfliktpotential nach irischem Vorbild zu kanalisieren. In Kombination damit sollten Konzepte der soziokultu-rellen Konfliktregulierung -wie z.B. verstärkte internethnische Zusammenarbeit in All-tagsbereichen – zur Abschwächung des latenten Gewaltpotentials entwickelt werden.
Zum Dilemma des Verhandelns mit Terrorgruppen lässt sich evtl. ebenfalls an den iri-schen Erfolg anknüpfen. Da sich auch innerhalb ETA und HB radikalere und moderatere Lager gebildet haben, wäre ein erster Versuch der Eintritt in Gespräche mit der HB in ihrer verhandlungsbereiten Ausführung und nach weiterer Beobachtung der Entwicklung gegebenenfalls auch mit der ETA.
4.5 Dritt-Partei-Intervention
Im Folgenden soll die Konfliktregelung mit Hilfe von Mediation durch Dritte näher betrachtet werden. Dazu zählen alle Methoden, die nicht auf der Autoriät von Gesetzen beruhen oder sich der Anwendung physischer Gewalt bedienen und um die Deeskalation, Beilegung oder Lösung ethno-politischer Konflikte bemüht sind.
Norbert Ropers (S.224 ff.) unterscheidet Formen der Mediation idealtypisch in direktive Mediation, nicht-direktive Mediation und Facilitation:
a) Facilitation (auch in Form von Problem-solving-Workshops):
Dieser Mediationstyp konzentriert sich auf die Subjektebene des Konflikts: Es geht grundsätzlich darum, den an den Auseinandersetzungen beteiligten Personen zu direkten Begegnungen zu verhelfen und mit ihnen an den jeweiligen Wahrnehmungen und Wahrnehmungsverzerrungen des Konflikts zu arbeiten. Möglichst wenig Verantwortung sollte dabei von den Mediatoren übernommen werden, Hauptziel ist, den Lernprozess anzuregen, zur Entwicklung von Empathie beizutragen und ein umfassendes Konflikt-verständnis herbeizuführen, das diesen nicht mehr als trennendes Element sondern eher als geteiltes Problem ansieht.
Der Mediator muss dazu in der Lage sein, die Voraussetzungen für die Weiterleitung von Informationen und direkte Begegnungen zu schaffen. Dies ist insbesondere bei zuge-spitzten ethno-politischen Konflikten schwierig und braucht seine Zeit - diese Strategie zeigt kurzfristig meist noch keine konstruktive Wirkung. Sinnvoll kann es auch sein, zunächst getrennte Treffen zu organisieren, um die Begegnungsbereitschaft zu erhöhen und das Vertrauen in den Mediator erst auf beiden Seiten aufzubauen und zu verfestigen.
b) Nicht-direktive Mediation
Hierbei wird sowohl die Subjekt- als auch die Objektsphäre des Konflikts erfasst. Die vermittelnde Drittpartei sorgt für die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen, Verfahren und Methoden für eine konstruktive Auseinandersetzung der Parteien. Dafür ist eine zunächst einhergegangene Facilitation wegen der Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen eine sehr begünstigende Voraussetzung. Im Vorfeld müssen die umstrittenen Themen eingegrenzt werden und bestimmte, einzuhaltende Spielregeln festgelegt werden. Auch hier wirkt die Drittpartei ohne eigene Stellungnahme ein, lediglich die Positionen der Parteien sollen reflektiert und deren Grundbedürfnisse herausgearbeitet werden.
c) Direktive Mediation
Dieser Mediationstyp konzentriert sich hauptsächlich auf die Objektsphäre des Konflikts. Der Mediator ist hier selbst an einer substantiellen Regelung des Konflikts interessiert. Im Unterschied zu den anderen beiden Mediationsarten macht er dementsprechend auch Vorschläge, stellt Anreize in Aussicht, verdeutlicht die Kosten von Nicht-Regelungen, bringt positive Erfahrungsbeispiele etc. und übt ggf. auch Druck aus („power mediation“). Es wird hier von der Drittpartei sowohl im Vermittlungsprozess als auch bei späteren praktischen Hilfen zur Durchsetzung mehr Verantwortung übernommen. Geeignet sind dafür folglich am besten einflussreiche politische Akteure, Staatenverbände etc.. Je zugespitzter der jeweilige Konflikt ist, als desto sinnvoller erweisen sich erfahrungsgemäß direktive Mediationsmethoden.
Im Baskenland erfolgten Mediationsversuche bereits in Ansätzen, konnten aber nicht kontinuierlich weitergeführt werden und führten so zu keinen nennenswerten Erfolgen. Ein Beispiel hierfür ist die 1995 gestartete Vermittlungsmission des argentinischen Nobelpreisträgers Adolfo Perez Esquivel, die zunächst hoffnungsvolle Ansätze barg, dann aber schließlich nicht weitergeführt werden konnte. Der in dieser Zeit erfolgende Regierungswechsel durch den Wahlsieg der PP führte zu einem strategischen Wandel, es wurde sich wieder vermehrt sicherheitspolitischen Maßnahmen zugewandt. Ein weiterer Versuch erfolgte 1992 von Seiten der baskischen Friedensgruppe Elkarri („Dialog“), die sich für die Abhaltung einer alle Konfliktakteure einschließenden Friedenskonferenz im Baskenland einsetzte. Die Schwierigkeit solcher Pläne bleibt jedoch meist die Umsetzung in konkrete, effiziente politische Konzepte. Trotzdem ist die Existenz solcher Formationen alleine schon einer Entspannung zuträglich und nimmt Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung.
Voraussetzung für eine erfolgversprechende Mediation ist zunächst an erster Stelle der Grundkonsens der Konfliktparteien zur friedlichen Transformation des Konflikts. Weiterhin förderlich sind Gespräche auf neutralem Boden ohne „Heimvorteil“ eines Beteiligten, wie sie im baskischen Fall z.B. in Mitte der 80er Jahre in Brüssel, Paris und Genf, sowie später in Algerien stattfanden. Weiterhin ist auch die Wahl des richtigen Zeitpunkts für eine solche deeskalierend gedachte Einmischung schwierig und kann ausschlaggebend für deren Erfolg sein. Ein sinnvoller Punkt im Konfliktverlauf könnte der Moment sein, in dem sich die Parteien bereits aneinander annähern, Gespräche vereinbaren etc., wie es beispielsweise 1998 nach dem Lizarra-Pakt der Fall war. Die Voraussetzungen für Kompromissbereitschaft sind damit schon gegeben, oft scheitern solche Dialoge dann lediglich an der Unverhandelbarkeit einzelner Positionsbereiche, von denen nicht abgerückt wird. Hier kann eine neutrale Mediation dem konstruktiven Ausgang der Verhandlungen zuträglich sein.
Dazu stellt sich als nächstes die Frage nach einem von allen Parteien akzeptierten, neutra-len Mediator. Dieser kann – hier gibt es unterschiedliche Anschauungen – entweder ein externer Akteur sein, oder auch ein interner, aber unabhängiger Vermittler. Im vorliegen-den Fall wäre die PNV theoretisch als realpolitischer Mediator vorstellbar, in letzter Zeit scheint sie für eine solche Rolle jedoch aufgrund ihrer zunehmenden Annährung an das extremistische Lager eher ungeeignet.
Insbesondere für die direktive Mediation bietet sich ein starker politischer Akteur an, der im Rücken des Mediators steht und ihm Autorität verleiht. In Frage käme dafür evtl. ein EU-Vermittler, was wiederum weitere Schwierigkeiten bergen würde. Zunächst ist (zumindest) eine der Konfliktparteien – nämlich Spanien und im erweiterten Sinne noch Frankreich als Solidaritätspartner- Mitglied dieser Gemeinschaft, was erneute Asymetrie hervorruft bezüglich der Einflussmöglichkeiten. Grundsätzlich besteht innerhalb der EU durchaus Interesse an einer friedlichen Beilegung des Konflikts, gerade aus den Gründen der Betroffenheit gleich zweier Mitgliedsstaaten. Im Unterschied zu Nordirland ist das Baskenland jedoch wirtschaftlich prosperierend, wodurch kein Bedarf nach EU-Unterstützungen in ökonomischer Form besteht. Daher ist die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß, wie sie von EU-Seite im nordirischen Konflikt erfolgte. Hinzu kommt, dass mit Großbritannien und Irland gleich beide in den Konflikt verstrickten gegnerischen Parteien nationalstaatliche Akteure mit starkem Interesse an einer Konfliktbearbeitung auf europäischer Ebene sind. Im baskischen Fall existieren keine Interessensvertreter innerhalb der EU, die die Aufmerksamkeit auf die dortige Situation lenken. Von Seiten Spaniens (und auch Frankreichs) wird zudem befürchtet, dass eine baskische Unabhängigkeit durch die „europäische Hintertür“ (z.B. durch das Konzept des Europas der Regionen) erfolgen könne. Folglich besteht von dieser Seite auch kein großes Interesse an einem Engagement der EU.
4.6 Schlussfolgerungen
Die hier vorgestellten Regelungsansätze bilden lediglich einen Ausschnitt aus einem weitaus umfangreicherem Forschungssortiment zur Konfliktbearbeitung. Es wurden hier einige Strategien ausgewählt, die im Allgemeinen auf ethno-politische Konfliktkonstellationen, sowie im Besonderen auf den baskischen Konflikt adäquat anwendbar schienen. In der Praxis lassen sich solche Konzepte schlecht trennen und erweisen sich oft erst in konfliktspezifisch sinnvoller Kombination miteinander als produktiv. Dazu gehört zunächst eine intensive Ursachen- und Verlaufsanalyse des zu bearbeitenden Konfliktes und im Folgenden die Auseinandersetzung mit einer Fülle von methodischen und praktischen Problemen bei der realpolitischen Durchführbarkeit guter Ansätze.
Wichtig ist, insbesondere beim vorliegenden Konflikttyp, die Einsicht, dass rationale Überlegungsarbeit manchmal nicht viel ausrichten kann. Radikale Gruppen reagieren meist nicht nach der üblichen Verhaltenslogik, es ist daher vonnöten, deren eigenes Rationalitätsverständnis nachzuvollziehen. Hierfür gibt es kein Patentrezept, dieses Verständnis hängt stark von dem komplexen Geflecht des jeweiligen Konflikts ab und erfordert eine mehrschichtige, konfliktspezifische Vorgehensweise. So muss zum Beispiel auch die Doppelgesichtigkeit ethno-politischer Auseinandersetzungen zwischen historischen und psycho-sozialen Tiefen einerseits und praktisch-politischen Regelungen andererseits bei der Konfliktbearbeitung berücksichtigt werden und eine dafür adäquate Doppelstrategie entwickelt werden. Als sinnvoll erweisen sich auch Kombinationen, die Bearbeitungskonzepte auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig ansetzen, also die Parallele zwischen Handlungen und Aktionen auf gesellschaftlicher, „zwischenstaatlicher“ und globaler Ebene ziehen.
5. Schluss
Handfeste Verbesserungsprognosen für die kommende Zeit lassen sich unter Betrachtung des Konfliktverlaufs in naher und fernerer Vergangenheit keineswegs stellen. Das ideologische Misstrauen gegenüber dem Gegner, das das politische Klima vergiftet und Annäherungen im Keim erstickt, existiert nach wie vor unvermindert. Hinzu kommen eine gewisse, nicht zuletzt daraus resultierende, Politikverdrossenheit und ein Vertrauenslack in die Demokratie von Seiten der unzufriedenen baskischen Bevölkerung.
Trotz aller Einschränkungen gibt es jedoch auch einige positive Veränderungen der letzten Zeit, die auf Annäherung hoffen lassen.
Durch erhebliche Fahndungserfolge der letzten Jahre, gerade erst wieder verstärkt durch die Aushebung eines umfangreichen ETA – Waffenlagers und die Verhaftung des hochrangigen Terroristenpaares „Antza“ und „Anboto“ in Frankreich, ist die ETA aktuell massiv geschwächt. Die Zusammenarbeit zwischen der spanischen und französischen Polizei hat sich verbessert, es gibt weniger Rückzugsmöglichkeiten für die Terroristen und die finanziellen Ressourcen sind ebenfalls knapp. Verstärkend kommt hinzu, dass die Terrororganisation nach wie vor an sozialem Rückhalt in der Bevölkerung einbußt. Der spanische Terrorexperte José Luis Barbería schätzt diese Entwicklungen nicht als phasenweise ein, sondern prognostiziert der ETA diesmal einen „fortschreitenden strukturellen Zerfallsprozess“.[5]
Auf Seiten der baskischen Regierungspartei ist ferner ein Ende der Annäherung an das extremistische Lager abzusehen. Der ehemalige PNV-Führer Xabier Arzalluz, einer der überzeugtesten Befürworter der Radikalisierung der Partei, hat sich im Januar 2004 aus der Politik zurückgezogen. Sein Nachfolger Josu Jon Imaz gilt als gemässigter Vertreter der baskischen Interessen und möchte einen offenen Bruch mit Spanien vermeiden. Auch Parteichef Ibarretxe proklamiert als Voraussetzung für ein Referendum zur baskischen Autonomie ein Niederlegen der Waffen und appelliert diesbezüglich an die ETA.
Was die spanische Position betrifft, erhöhen sich mit der Abwahl von José Maria Aznar die Chancen auf einen politischen Dialog. Eine Reform des Autonomiestatuts wurde bereits in Aussicht gestellt, als absolute Voraussetzung für derartige Verhandlungen wird ein vollständiger Gewaltverzicht genannt.
Im Hinblick auf die akute Schwächung der ETA, die moderate PNV-Führung und die Verhandlungsbereitschaft der Zapatero – Regierung sind im Grundsatz gute Voraussetzungen für den gezielten Einsatz von Konfliktbearbeitungsstrategien gegeben.
Erfahrungsgemäß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Waffenstillstandserklärung der ETA in Schwächezeiten sehr hoch. Es müssten Gegebenheiten geschaffen werden, die ihr einen solchen ohne Gesichtsverlust ermöglichen würden und im Folgenden vorsichtige (nicht zu offensive) Maßnahmen getroffen werden, die eine Wieder-Erstarkung während dessen verhindern. Ein Eintritt in Verhandlungen zwischen der PNV-Führung und der spanischen Regierung könnte daraufhin erfolgen, der sinnvollerweise unter Aufsicht eines vermittelnden, neutralen Mediators stattfinden sollte. Es könnte, sofern dieser konstruktiv verläuft und der Waffenstillstand ohne Einschränkungen eingehalten wird, eine spätere Beteiligung der ETA in Aussicht gestellt werden.
Dieses Szenario wäre lediglich eine der Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung im spanisch-baskischen Konflikt und veranschaulicht die Nutzung historisch günstiger Momente zur Schaffung einer Kommunikationsbasis, auf der ein umfassender, konstruktiver Konfliktregelungsprozess erfolgen kann.
Literatur
Bernecker, Walther L. Spanien heute – Politik, Wirtschaft, Kultur; Frankfurt a. M.
Dirscherl, Klaus 2004
Boden, Martina Nationalitäten, Minderheiten und ethnische Konflikte in Europa- Ursprünge, Entwicklungen, Krisenherde; München 1993
Galtung, Johan Neue Wege zum Frieden – Konflikte aus 45 Jahren: Diagnose,
Prognose, Therapie; London 2000
Hrbek, Rudolf/ betrifft: Das Europa der Regionen – Fakten, Probleme,
Weyand, Sabine Perspektiven; München 1994
Kasper, Michael Baskische Geschichte in Grundzügen; Darmstadt 1992
Komlosy, Andrea/ Krisenherd Europa – Nationalismus, Regionalismus, Krieg;
Elsässer Jürgen(…) Göttingen 1994
Linz, Juan J. Conflicto en Euskadi; Madrid 1986
Linz, Juan J. Totalitäre und autoritäre Regime; Berlin 2000
Meyer, Berthold Formen der Konfliktregelung – Eine Einführung mit Quellen; Opladen 1997
Römhildt, Kerstin Nationalismus und ethnische Identität im ‚spanischen’ Baskenland; Münster 1994
Ropers, Norbert Friedliche Konfliktbearbeitung in der Staaten- und Gesellschaftswelt, Bonn 1995
Valandro, Franz Das Baskenland und Nordirland – Eine vergleichende Konfliktanalyse; Innsbruck 2001
Waldmann, Peter Ethnischer Radikalismus – Ursachen und Folgen gewaltsamer
Minderheitenkonflikte am Beispiel des Baskenlandes, Nordirlands und Quebecs; Opladen 1989
Waldmann, Peter Militanter Nationalismus im Baskenland; Frankfurt a. M. 1990
Waldmann, Peter Terrorismus – Provokation der Macht; München 1998
Waldmann, Peter Terrorismus und Bürgerkrieg – Der Staat in Bedrängnis; München 2003
www.spiegel.de www.europa.tiscali.at
www.faz.net www.nzz.ch
[...]
[1] (aus: Waldmann, „militanter…“)
[2] Interview mit Kandido Azpiazu, ETA-Terrorist; Spiegel-Online vom 06.08.2001
[3] Demonstrantenrufe bei der Räumung eines Batasuna -Parteibüros in San Sebastian; Spiegel-Online vom 28.08.2002
[4] Art. 2: „Die Verfassung basiert auf der unauflöslichen Einheit der spanischen Nation, der gemeinsamen und unteilbaren Heimat aller Spanier, und anerkennt und garantiert das Recht auf Autonomie der Nationalitäten und der Regionen, die diese einschließen, sowie die Solidarität unter allen.“
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert den spanisch-baskischen Konflikt, seine historischen Ursachen, beteiligten Akteure, Konfliktregelungsansätze und bietet einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen.
Welche historischen Ereignisse haben den baskischen Konflikt beeinflusst?
Wichtige Ereignisse sind die Karlistenkriege, die Beseitigung der Fueros (baskische Privilegien), die Industrialisierung, die Franco-Diktatur und die Gründung der ETA.
Wer sind die Hauptakteure im baskischen Konflikt?
Zu den Hauptakteuren zählen die baskische Bevölkerung, baskische Nationalisten (radikale und gemäßigte), die ETA (baskische Terrororganisation), die spanische Regierung und spanische Sicherheitskräfte.
Welche Konfliktregelungsansätze werden in dem Dokument diskutiert?
Das Dokument erörtert die Ressourcentheorie (inkl. Ressourcenzufuhr, Basic-Needs-Ausgleich und Konsolidierung der Regierungsverantwortung), Verlagerung der Konfliktachse, Isolation von Terroristen, Friedensverhandlungen und Drittpartei-Intervention (Facilitation, nicht-direktive Mediation und direktive Mediation).
Was ist der Ibarretxe-Plan?
Der Ibarretxe-Plan ist ein 2003 entworfener Vorschlag des baskischen Regierungschefs Juan José Ibarretxe für die zukünftige politische Stellung des Baskenlandes, der eine frei assoziierte Nation innerhalb eines plurinationalen Staates vorsieht.
Was sind die wichtigsten Ursachen für die Entstehung und Eskalation des Konflikts?
Die wichtigsten Faktoren sind militärische Niederlagen in den Karlistenkriegen, sozioökonomische Veränderungen im 19. Jahrhundert (die zu einer Identitätskrise führten), die Unterdrückung während der Franco-Diktatur und die Unfähigkeit der historischen Parteien PSOE und PNV, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln.
Welche Rolle spielt die Identität im baskischen Konflikt?
Die Wahrung der baskischen ethnischen und kulturellen Identität ist ein zentrales Element des Konflikts. Der baskische Nationalismus, insbesondere im späten 19. Jahrhundert, prägte das Konfliktpotential.
Welche Bedeutung haben Friedensverhandlungen im Konfliktlösungsprozess?
Friedensverhandlungen werden als eine Möglichkeit zur Konfliktbearbeitung betrachtet, aber es wird betont, dass die Bereitschaft aller beteiligten Akteure, ohne unverhandelbare Vorbedingungen zu verhandeln, entscheidend ist.
Welche Rolle spielen Drittpartei-Interventionen bei der Konfliktlösung?
Drittpartei-Interventionen, insbesondere in Form von Mediation, können zur Deeskalation, Beilegung oder Lösung des Konflikts beitragen, wobei verschiedene Formen der Mediation (direktiv, nicht-direktiv, Facilitation) unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
Welche Schlussfolgerungen zieht das Dokument bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Konflikts?
Das Dokument stellt fest, dass eine Verbesserungsprognose schwierig ist, hebt aber positive Entwicklungen wie die Schwächung der ETA, die gemäßigtere Haltung der PNV und die Verhandlungsbereitschaft der spanischen Regierung hervor, die günstige Voraussetzungen für Konfliktbearbeitungsstrategien bieten.
Welche Bedeutung hat der Vergleich mit dem Nordirland-Konflikt?
Der Nordirland-Konflikt dient als Vergleichspunkt, insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung radikaler Akteure in den Friedensprozess und die Bedeutung internationaler Unterstützung.
Welche Rolle spielt die Verfassung in der baskischen Frage?
Die spanische Verfassung, insbesondere das Prinzip der territorialen Einheit und die fehlende Rechtsgrundlage für Selbstbestimmung, spielt eine wichtige Rolle im Konflikt, ebenso wie die umfangreichen Bestandsgarantien der regionalen Verwaltungsebene.
- Quote paper
- Verena Bruer (Author), 2004, Konfliktanalyse und Konfliktregelungsansätze für die ethno-politischen Auseinandersetzungen im spanischen Baskenland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109306