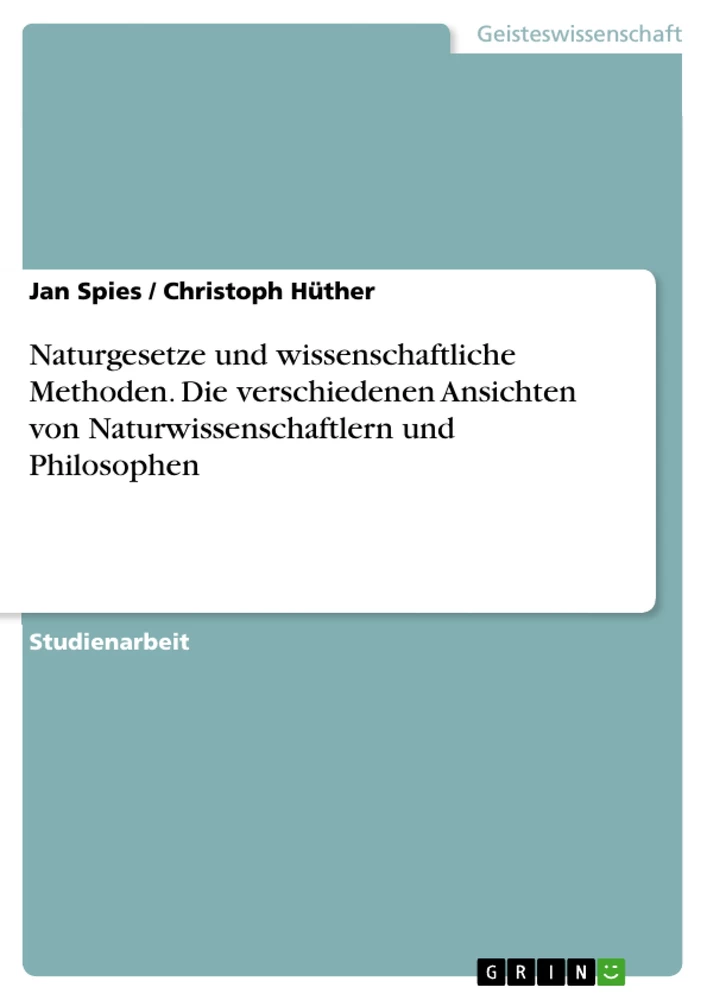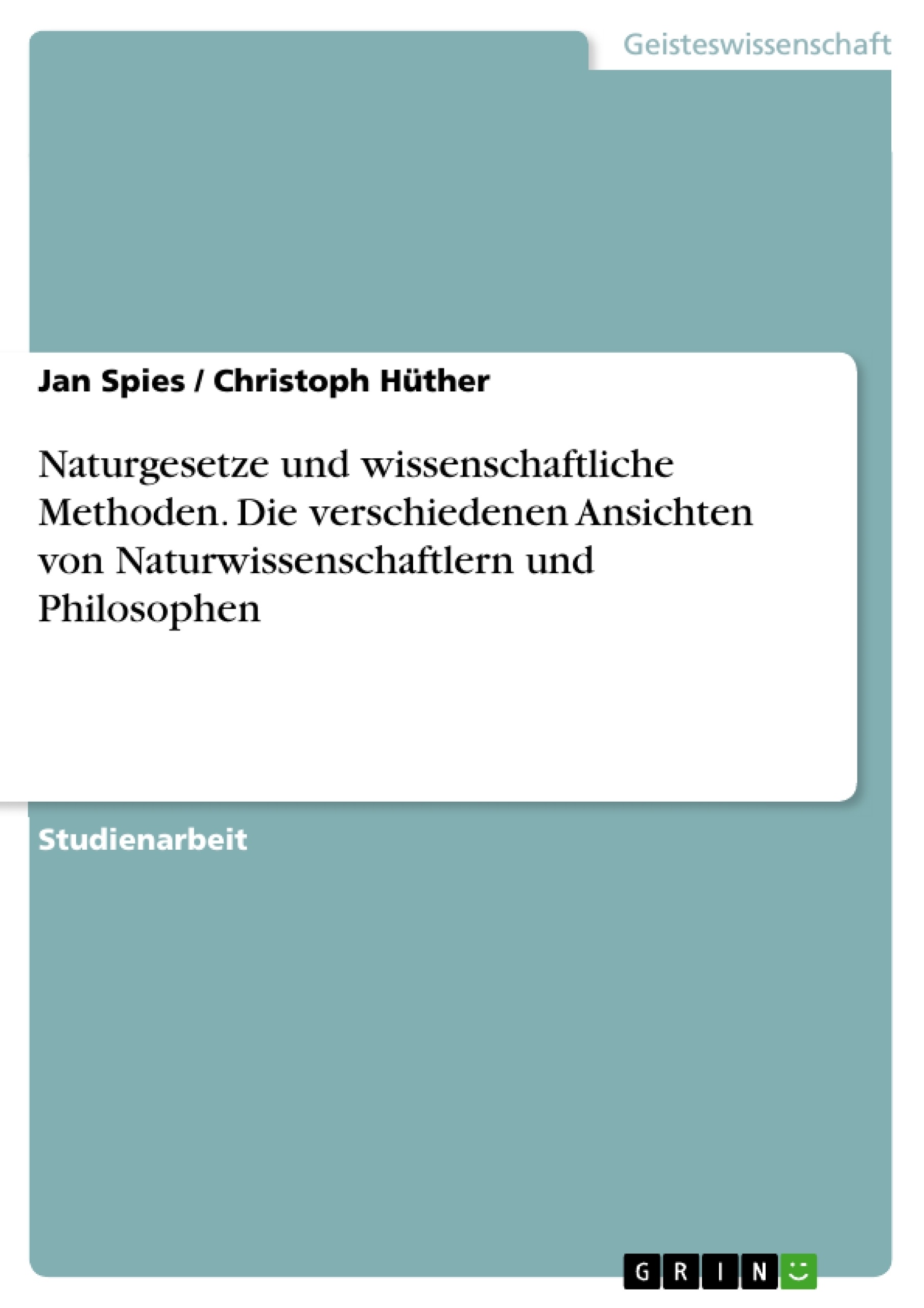Stellen Sie sich vor, die Welt, wie wir sie kennen, beruht auf einem Fundament, dessen Beschaffenheit selbst die klügsten Köpfe seit Jahrtausenden in ihren Bann zieht. Was sind Naturgesetze wirklich? Sind sie unverrückbare Wahrheiten, die das Universum lenken, oder lediglich nützliche Modelle, die wir zur Beschreibung der Realität erschaffen haben? Dieses Buch ist eine fesselnde Reise durch die Geschichte des Denkens über Naturgesetze, von den Mythen der Antike bis zu den neuesten Erkenntnissen der modernen Wissenschaft. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Philosophen und Wissenschaftlern, die sich leidenschaftlich über die Existenz, die Eigenschaften und die Ursprünge dieser fundamentalen Prinzipien streiten. Tauchen Sie ein in die Debatten zwischen Realisten und Positivisten, Pragmatikern und Konventionalisten, und entdecken Sie, wie jede dieser Denkrichtungen unsere Sicht auf die Welt prägt. Untersuchen Sie die wissenschaftlichen Methoden, mit denen wir versuchen, Naturgesetze zu erkennen, vom Induktivismus bis zum Falsifikationismus, und hinterfragen Sie die Rolle von Regelmäßigkeiten, Kausalität und Notwendigkeit. Erfahren Sie, warum die Definition von Naturgesetzen so schwierig ist und welche Konsequenzen dies für unser Verständnis von Wissenschaft und Realität hat. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Theorien und Konzepte, sondern regt auch zum kritischen Denken an und fordert Sie heraus, Ihre eigenen Annahmen über die Natur der Welt zu hinterfragen. Ob Sie Student, Wissenschaftler oder einfach nur neugierig sind, diese Lektüre wird Ihr Verständnis der Naturgesetze und ihrer Bedeutung für unser Leben grundlegend verändern. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Naturgesetze und lassen Sie sich von der Vielfalt der Perspektiven und der Tiefe der philosophischen Fragen inspirieren. Ergründen Sie die Hierarchien der Naturgesetze, von den fundamentalen Prinzipien bis zu den komplexen Phänomenen, die sie erklären. Begleiten Sie uns auf einer spannenden Suche nach dem Verständnis der Welt, die uns umgibt, und der Gesetze, die sie regieren. Ein unverzichtbares Werk für alle, die sich für die Grundlagen der Wissenschaft, Philosophie und die großen Fragen des Universums interessieren. Wagen Sie es, die Grenzen Ihres Wissens zu erweitern und in die Tiefen der Naturgesetze einzutauchen.
Inhaltsübersicht
1. Einleitung
2. Geschichte der Naturgesetze…
3. Was ist ein Naturgesetz
3.1. Naturgesetze vs. Juristische- und religiöse Gesetze.
3.2. Merkmale von Naturgesetzen
3.2.1. Unstrittige Merkmale
3.2.2. Strittige Merkmale
4. Hierarchien von Naturgesetzen
5. Naturgesetze durch wissenschaftliche Methoden.
5.1. Der Induktivismus
5.2. Der Falsifikationismus…
5.3. Kuhns Paradigmen
6. Gesetze als Regelmäßigkeiten
7. Die Kontrahenten
7.1. Realisten oder Platoniker
7.2. Positivisten und Nominalisten
7.3. Prakmatiker
7.4. Konventionalisten…
7.5. Instrumentalisten und Konstruktivisten
8. Fazit
9. Literaturübersicht.
Abbildungsübersicht
Abb. 1: Hierarchien von Naturgesetzen
1. Einleitung
Uns ist bis heute kein auch noch so kompliziertes Problem begegnet, wie das der Naturgesetze. Unser persönlicher Standpunkt über Naturgesetze hat sich während der Erarbeitung dieser Seminararbeit drastisch geändert. Beim Beginn unserer Recherche sahen wir Naturgesetzte als etwas an, das als Basis für alles steht und was als unveränderlich gilt.
Während unserer Zusammenarbeit haben wir erkannt, dass dieses Thema weitaus komplexer, komplizierter und umstrittener ist, als wir jemals angenommen hatten.
Wir verstanden die Naturwissenschaft als etwas, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Suche nach Naturgesetzen ist deshalb die wichtigste Aufgabe der Naturwissenschaft. Sie versucht Muster, Gesetz- und Regelmäßigkeiten, die das Naturgeschehen mit all den verschiedenen Einzelphänomenen zeigt aufzudecken und zu verstehen.
Das dies überhaupt möglich ist und nicht überall wirres Chaos herrscht, erscheint uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht bemerken, wie erstaunlich es eigentlich ist. Und das, obwohl die Ordnung der Dinge als Begriff seit Jahrtausenden für die Welt als ganzes steht: „Kosmos“.
Was sind überhaupt Naturgesetze, wie werden sie erkannt, interpretiert und bewertet. Es gibt viele Methoden um Erkenntnis zu erlangen, aber auch genau so viele Streitigkeiten - oder mehr - welche die beste Variante ist.
Die Meinungen und Ansichten der Naturwissenschaftler gehen weit auseinander. Die Philosophie spielt hier auch eine wesentliche Rolle.
Wir werden ihnen einen Einblick über die Vielfältigkeit der verschiedenen Ansichten von Naturwissenschaftlern und Philosophen geben.
Freilich gibt es kaum ein umstritteneres Thema: Wissenschaftler und Philosophen sind uneins, inwiefern Naturgesetze überhaupt existieren, welche Eigenschaften sie auszeichnen und was an Ihnen entdeckt oder erfunden ist.
2. Die Geschichte der Naturgesetze
Naturvorgänge unterliegen intelligenten, geplanten, moralischen Ordnungen welche von Schicksalsgöttern kontrolliert und sogar bisweilen als eine Bestrafung eingesetzt wurden, so das Weltbild der Mythen.
Heute sagt man, dass der Mensch Handlungsmaxime oder Herrschaftsvorstellungen auf die Natur interpretiert.
Auf der anderen Seite hat man später moralische und politisch-soziale Verhältnisse einer Prüfung unterzogen, ob es Abweichungen zum Naturrecht gibt.
In der Antike findet man erste Ansätze zu Naturgesetzen aber man sprach man noch nicht davon! Zu dieser Zeit wurde von Notwendigkeit, „Themis“ (Brauch, Gesetz, Recht), „Dike“ (Sitte, Gerechtigkeit, Strafe) und „Heimarmene“ (Vorsehung) sowie dem „Logos“ (einer der Welt damals innewohnenden Vernunft, Ordnung) gesprochen.
Das Hebelgesetz, das optische Gesetz der Reflexion und das hydrodynamische Gesetz des Auftriebs waren damals die einzigen drei physikalischen Sätze, die explizit bekannt waren. Kein Wissenschaftler nannte sie Naturgesetze, nicht einmal mal Archimedes der zu dieser Zeit ein sehr bekannter Wissenschaftler war. Man sprach stattdessen von Prinzipien, Axiomen oder Theorien, die ihren Ursprung in der Mathematik hatten. Selbst zu der Zeit von Galileo Galileis wurde noch das gleiche angenommen, denn auch er sprach nicht von Naturgesetzen aber heutzutage werden seine Erkenntnisse als solche angesehen, insbesondere sein Fallgesetz.
Erstmals in der jüdischen-christlichen-Tradition und in der Stoa tauchte der Begriff „Naturgesetz“ auf, jedoch mit einer anderen Bedeutung, wie wir ihn heute interpretieren. Dort nahm man an, dass ein Naturgesetz dem Willen Gottes unterliegt und dem Gott gehorcht, der es geschaffen hat.
Der Kirchvater Augustus betrachtete Naturgesetze als Gewohnheiten göttlichen Handelns, betonte aber, dass sie zugunsten besonderer Zwecke jeden Augenblick verlassen werden können, zum Beispiel um ein Wundern zu schaffen, an jene man zu dieser Zeit nicht zweifelte.
Namhafte Philosophen dieser Zeit wie beispielsweise Giordano Bruno, der Naturgesetze als „Anlage der Dinge“ oder Gottfried Wilhelm Leibniz als der „umwandelbare Wille Gottes“ interpretierten, unterstreichen die Bedeutung der Naturgesetze zu dieser Zeit.
Während im Mittelalter Naturgesetze noch als unzulässige Einschränkung Gottes Almacht galten, waren sie im 17. Jahrhundert ein Beweis für die Schönheit und Harmonie seiner Schöpfung.
René Descartes war der erste, der von Naturgesetzten im modernen Sinn sprach.
„Wie Galilei übernahm Descartes die Grundvorstellung seiner physikalischen Regelmäßigkeit von den Handwerkern seiner Zeit. Und aus der Bibel nahm er die Vorstellung der göttlichen Gesetzgebung. Die Verbindung beider schuf den Begriff des modernen Naturgesetzes“[1], schrieb der Historiker Zilsel in seinem Buch „Der soziale Ursprung der neuzeitlichen Wissenschaft“ (1976). Es kam zur Vereinigung dreier Traditionen.
Der aristotelisch-christlichen zufolge hat der Weltschöpfer eine gesetzmäßige Ordnung erlassen, die zwingend oder unumstößlich gilt (Wunder - Ausnahmen bestätigen die Regel).
Und diese Ansicht von Naturgesetzen hat sich bis heute nicht geändert. Die moderne Wissenschaft kann immer nur einen Teil eines Naturgesetzes beschreiben und erklären, hingegen ein anderer Teil als gegeben angesehen wird „Gott gemacht“. Zum Beispiel die gleich bleibende Beschleunigung, mit der Gegenstände zur Erde fallen. Woher kommt diese Kraft, wer hat sie geschaffen? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: Sie ist von Gott geschaffen.[2]
3 Was ist ein Naturgesetz?
Mal angenommen man würde eine Passantenbefragung vornehmen, in dem man die Probanden fragen würde was ein Naturgesetz denn ist, dann würde man sicherlich eine bunte Palette von Antworten bekommen. Dies sorgt oft für Missverständnisse. Für die meisten ist es selbstverständlich, dass es Gesetze gibt, die das Verhalten der Welt leiten und das es die Aufgabe der Wissenschaftler ist, diese zu entdecken. Wir wollen nun der Frage auf den Grund gehen, ob Gesetze tatsächlich etwas Selbstverständliches sind und wie wir Gesetze definieren!
Die Vorstellung eines Naturgesetzes wird häufig mit der Kausalität gesehen. Mit den Begriffen Ursache und Wirkung. Der Vergleich zwischen Naturgesetzen und Kausalgesetzen ist jedoch heutzutage nicht mehr aufrechtzuerhalten, da hauptsächlich neuere Gesetze sich nicht mehr auf Kausalität beziehen (z.B. bei den Gesetzen der Koexistenz das Gasgesetz).
Daraufhin kam die Frage auf, ob es neben den Kausalgesetzen auch finale Gesetze gibt. Man unterscheidet die Naturgesetze, denen die Körper unterworfen sind und die Gesetze der Wirkursachen oder der Bewegungen sind, von den Gesetzen der Zweckursachen, gemäß denen die Seelen handeln.
„Paul Weingartner, Philosophie-Professor an der Universität Salzburg betont, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem Naturgesetz,
- wie es in den Gedanken des Entdeckers oder Erfinders ist,
- wie es in den Dingen, Strukturen und Ereignissen ist, die durch es geordnet oder beschrieben werden,
- als eine nomologische Aussage (Satz über ein Gesetz), ausgedrückt in wissenschaftlicher Fachsprache,
- als das wahre Gesetz, dem sich die nomologischen Aussagen der Wissenschaften anzunähern versuchen,
- als eine ideale, begriffliche, objektive Wesenheit, unabhängig von unseren Aussagen darüber – wie oft es auch für mathematische und logische Gesetze angenommen wird.“[3]
Umso mehr man versucht eine Definition für Naturgesetze zu finden, muss man schließlich feststellen, dass sich zu jeder aufgestellten These eine, oder mehrere Gegenthesen entgegenstellen.
Es ist bis heute nicht geklärt, worauf sich die als notwendig erscheinende Gültigkeit der Naturgesetze beruht. Eine eindeutige Definition des Begriffes Naturgesetze kann nicht gegeben werden.
Ferner können wir sagen, dass mit Hilfe von Naturgesetzen die Welt äußerst erfolgreich beschrieben, erklärt, prognostiziert und verändert werden kann. Zugleich sind sie so real wie Steine, nur im Gegensatz zu Steinen können wir die Naturgesetze nicht beeinflussen.[4]
3.1. Naturgesetze vs. Juristische- und religiöse Gesetze
Wenn man von Gesetzen spricht, dann kommen einem meist Gesetze in den Sinn, die von Gerichtshöfen gemacht wurden um das Zusammenleben der Bürger zu ordnen, oder religiöse Gesetze an die sich die Gläubigen halten sollen. Doch worin liegt der Unterschied zwischen Naturgesetzen und juristischen-, bzw. religiösen Gesetzen?
Der grundlegendste Unterschied liegt darin, dass wenn man die jur.-, bzw. rel. Gesetze genau betrachtet, sie entweder mit „du darfst“, oder „mit du darfst nicht“ beginnen! Diese können jedoch übertreten werden, ohne dadurch außer Kraft gesetzt zu werden.
Ein Naturgesetz hingegen kann nicht übertreten werden!
3.2. Merkmale von Naturgesetzen
Wenn sich die Wissenschaftler und Philosophen bei der Definition von Naturgesetzen in die Haare bekommen, warum sollte es dann bei den Merkmalen anders sein?
Dies ist auch nicht groß verwunderlich, denn hängt das eine ja vom anderen ab. Einigkeit besteht darin, dass diese Merkmale alle notwendig sind. Der Streit geht darum, ob sie auch hinreichend sind.
Auf jeden Fall kann man die Merkmale in unstrittig und strittig unterteilen.
3.2.1 Unstrittige Merkmale
- Naturgesetze müssen überprüfbar sein.
- Naturgesetze müssen empirisch gut bestätigt sein.
- Als Allaussagen gelten sie generell und universell.
- Als Bedingungssätze machen sie Wenn-Dann-Aussagen.
- Als relationale Beziehungen formulieren sie Zusammenhänge zwischen zwei oder mehr Größen.
- Naturgesetze müssen als wahr akzeptierbar sein.[5]
3.2.2. Strittige Merkmale
- Naturgesetze sind faktische Wahrheiten (Konstanz der Lichtgeschwindigkeit) im Gegensatz zu logischen (Zu jeder Zahl gibt es eine doppelt so große Zahl).
- Naturgesetze beanspruchen eine allgemeine Gültigkeit. Sie gelten unabhängig von Raum und Zeit.
- Sie enthalten keine Eigennamen wie „Stein“, sondern nur allgemeine Begriffe wie „Masse“ und „Geschwindigkeit“.
- Sie sind universelle oder statistische Aussagen wie „Kupfer leitet Strom“ im Gegensatz zu „Sterne existieren“.[6]
4. Hierarchien von Naturgesetzen
Damit man bei den unzähligen Gesetzen den Überblick behält, ist es wichtig sie in einer Hierarchie zu ordnen. Vorraussetzung für unkompliziertes Arbeiten ist eine saubere Darstellung der Hierarchie. Dies erleichtert den Umgang und Anwendung von Gesetzen im wissenschaftlichen Alltag.
Beim Aufstellen einer Hierarchie, fängt man gewöhnlich beim Ursprung an.
In unserem Fall haben wir mit dieser Aufgabe ein Problem. Es existieren unzählige Gesetze aber eine Basis worauf sich diese beziehen fehlt. Man geht davon aus, dass es eine „Theory of Everything“ gibt, von dem alles ausgeht und auf die sich die restlichen Gesetze beziehen. Die „Theory of Everything“ würde jeglichen Prüfungen widerstehen und könnte das Universum vom Anfang (Urknall) bis zum Ende beschreiben.[7]
Im nachfolgenden stellen wir eine Hierarchie am Beispiel der Mechanik auf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Hierarchien von Naturgesetzen
Quelle: Eigene Darstellung
5. Naturgesetze durch wissenschaftliche Methoden
Bisher sind wir der Frage nachgegangen was ein Naturgesetz ist und jetzt werden wir erörtern, was für wissenschaftliche Methoden es zum bestimmen von Naturgesetzen gibt.
Wir werden die Methoden allerdings nicht im Detail erläutern, da dies den Rahmen unserer wissenschaftlichen Arbeit sprengen würde. Ebenso sehen wir davon ab, diese Methoden miteinander zu vergleichen und werden nur die in unserem Augenmerk wichtigsten erwähnen. Wir erachten es jedoch für wichtig, dass die Methoden mit einfließen, um den Zusammenhang zu verstehen. Um genauere Einblicke zu bekommen verweisen wir auf das Buch von Alan F. Chalmers: „Wege der Wissenschaft“!
5.1. Der Induktivismus
In dieser Methode versucht man wissenschaftliche Gesetze aus Tatsachen abzuleiten. Diese werden z.B. aus Beobachtungen gewonnen. Durch weitere Beobachtungen, die dem Gesetz entsprechen, soll das Gesetz gefestigt werden.
5.2. Der Falsifikationismus
Man versucht eine wissenschaftliche Aussage, bzw. ein Gesetz durch z.B. Beobachtung, oder Experiment zu widerlegen, in dem es streng geprüft wird. Hält ein Gesetz der Falsifikation stand, dann wird es gefestigt. Ein Gesetz, dass der Falsifikation jedoch nicht stand hält, wird durch die neue Theorie ersetzt.
5.3. Kuhns Paradigmen
Kuhns Basis für seine Methode besteht im Versuch ein Paradigma aufzustellen. Dieses besteht aus einem harten Kern, der „unantastbar“ ist und einer Hülle die den Kern ergänzen soll und deren Thesen auch austauschbar sind.
Wenn die Hülle anfängt, den Anpassungen nicht mehr standzuhalten, dann spricht man von einer Krise. Wird diese Krise nicht abgewendet, dann kommt es zu einer Revolution und es entsteht ein neues Paradigma. Wichtige Paradigmenwechsel in der Wissenschaftsgeschichte waren z.B. die Übergänge von der aristotelischen zur klassischen und von dieser zur relativistischen Mechanik.
6. Gesetze als Regelmäßigkeiten
Der heute noch einflussreiche Philosoph David Hume vertrat vehement die Meinung, dass es nichts gibt, was die Materie dazu bringt Gesetzen zu folgen. Für Hume gibt es keinen Verursacher für gesetzmäßiges Verhalten. Das gesamte Verursachungsprinzip der Natur ist für ihn zweifelhaft.
Hume führt folgendes Beispiel an:
Wenn zwei Billardkugeln aufeinander prallen, so können wir ihre Bewegungen unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Aufprall erkennen und evtl. Regelmäßigkeiten unmittelbar vor und unmittelbar nach dem Aufprall erkennen. Was wir aber nicht erkennen können, ist die Verursachung dieser Regelmäßigkeit.
Mit diesem Beispiel versucht Hume auszudrücken, dass alles was hier stattfindet ein regelmäßiges Zusammentreffen von Ereignissen ist und beschreibt dies als Verursachung.
Regelmäßigkeit als Prinzip bedeutet für Hume, das beispielsweise Ereignisse des Typs A unmittelbar mit Ereignissen des Typs B zusammenhängen oder diesen vorausgehen.
Galileis Fallgesetz würde dann wie folgt lauten: „Immer wenn ein schwerer Gegenstand in der Nähe der Erdoberfläche losgelassen wird, fällt es mit gleich bleibender Beschleunigung zur Erde“[8].
Somit bringt er noch mal auf den Punkt, dass es nichts gibt was Materie dazu bringt sich nach Gesetzen zu verhalten, sondern dass diese Gesetze tatsächlich nichts anderes sind als auftretende Regelmäßigkeiten von Ereignissen.
Namhafte Philosophen warfen dem Prinzip der Regelmäßigkeit vor, dass es nicht zwischen zufälligen und Gesetzesartigen Regelmäßigkeiten unterscheidet.
Sir Karl Raimund Popper, ein sehr bekannter Philosoph und Wissenschaftler bis in die heutige Zeit versuchte dies an folgendem Beispiel zu verdeutlichen: „Kein Moa lebt länger als 50 Jahre“[9]
Ein Moa, ist eine bereits ausgestorbene Spezies, bei der die Möglichkeit besteht, dass keiner über 50 Jahre alt wurde. Bei einigen aber, die bessere Umgebungsbedingungen hatten, mag dies durchaus der Fall gewesen sein, so dass wir diese Aussage nicht als Naturgesetz gelten lassen können, aber es gibt niemand der beobachtet hat, das ein Moa über 50 Jahre wurde. Dadurch qualifiziert sich diese Aussage durch ihre ausnahmslose Regelmäßigkeit als Gesetz.
Alle Schüler einer Schule werden nach ertönen der Klingel am Ende eines Schultages ihr Schreibzeug niederlegen. Diese Aussage kann wohl aber nicht als Naturgesetz gelten, auch wenn ausnahmslose Regelmäßigkeiten auftreten. Solche Beispiele sind ein Beweis dafür, dass Gesetze mehr sind als reine Regelmäßigkeiten wie Hume es behauptet.
Ein weiters Problem gibt es mit der Aussage, dass Ereignisse des Typs A unmittelbar mit Ereignissen des Typs B zusammenhängen oder diesen vorausgehen.
Beispielsweise kann man sagen, der übermäßige Alkoholgenuss führt zu Leberzirrhose, dies ist so, weil zu viel Alkohol diese verursacht und nicht umgekehrt. Um der Leberzirrhose vorzubeugen, könnte man weniger Alkohol trinken aber sollte die Medizin ein Medikament gegen Leberzirrhose entwickeln, so wird dies nicht den übermäßigen Alkoholkonsum bekämpfen.
Das Auftreten von Regelmäßigkeiten von Ereignissen ist kein Beweis dafür, dass Regelmäßigkeiten Gesetze darstellen, da Gesetze mehr sind als nur Regelmäßigkeiten.
Bei weiterer Überlegung muss aus der Sicht der Wissenschaft auch in Frage gestellt werden, ob gewisse Regelmäßigkeiten überhaupt als Beweise gelten, denn wie oft muss der gleiche Sachverhalt auftreten um daraus eine Regelmäßigkeit ableiten zu können. Daraus lässt sich wiederum ableiten, das Gesetze die auf Regelmäßigkeiten beruhen in Frage gestellt werden müssen.
Führt man Galileis Fallgesetz 5 Millionen Mal mit verschiedenen schweren Gegenständen durch, so wird man eine eindeutige Regelmäßigkeit feststellen. Alle Gegenstände die man in Nähe der Eroberfläche fallen lässt, fallen mit gleich bleibender Beschleunigung zur Erde.
Nun führt man den Test mit einem großen, relativ schweren Baumblatt durch und muss erstaunlicherweise feststellen, dass dieser Gegenstand nicht mit gleich bleibender Beschleunigung zur Erde fällt.
Daraus kann man schließen, dass es sehr schwer wäre, geeignete Kandidaten für Gesetze zu finden, wenn Gesetze als Regelmäßigkeiten verstanden würden und somit würden auch viele bereits vorhandene Generalisierungen einfach scheitern.
Der vorliegende Sachverhalt stellt ein Problem dar, dennoch gibt es aus Wissenschaftlicher Sicht eine plausible und leichte Erklärung. Bei der Durchführung von Experimenten werden oftmals Störvariablen ausgeschaltet, da der Modelaufbau auf künstliche Art und Weise angelegt ist. Beispielsweise wird ein fallendes Blatt vom Luftzug und Luftwiderstand beeinflusst. Würde man dieses Experiment im Luftleeren Raum durchführen, so würde man zur gleichen Erkenntnis kommen, wie mit dem dicksten Stein, nämlich dass das Blatt mit gleich bleibender Beschleunigung in Richtung Erde fällt.
Aus diesem Grund werden physikalische Experimente auf künstlichen Bedingungen untersucht um somit Störvariablen auszuschalten. Demnach ist es oftmals langwierig und aufwendig zu Wissenschaftlicher Erkenntnis zu gelangen.
Aus genanntem könnten Verfechter der Regelmäßigkeitsthese ihre Gesetze folgendermaßen beschreiben: „ Ereignisse des Typs A gehen regelmäßig Ereignissen des Typs B voraus oder werden von ihnen begleitet, vorausgesetzt, es gibt keine Störfaktoren“[10].
Auch Galileis Fallgesetz kann man demnach folgendermaßen umqualifizieren: Wenn man schwere Gegenstände in die Nähe der Erdoberfläche hält und fallen lässt, so werden diese Gegenstände mit gleich bleibender Beschleunigung Richtung Erde fallen, wenn diese Gegenstände nicht anderen Gesetzen - wie zum Beispiel dem Gesetz des Luftwiderstandes unterliegen.
Es ergibt sich ein Zwiespalt. Nun können wir sagen, dass es Gesetze gibt, die nur unter bestimmten Konditionen als richtig Betrachtet werden können. Galileis Fallgesetz bei Baumblättern hätte nur in luftleeren Raum Gültigkeit. Somit müssten auch alle anderen Experimente im Rahmen des Fallgesetzes unter den gleichen Bedingungen durchgeführt werden. Jetzt hätte man das Problem, dieses Fallgesetz außerhalb dieses Experimentes - also in der Natur -anzuwenden. Des Weiteren würden andere Gesetze wie Luftwiderstand oder Aerodynamik außer Acht gelassen werden. Dies ist aber nicht das Ziel der Wissenschaft.
Um Wissenschaftliche Erkenntnis zu erlangen, müssen sich Experimente auch außerhalb ihres Rahmens bestätigen. Man muss bereit sein, von gewissen Störfaktoren abzusehen um Gesetze zu bestätigen. Ansonsten wäre es sehr schwer überhaupt Wissen zu erlangen und Gesetze zu formulieren.
Da an dieser Stelle anscheinend eine Lösung gefunden wurde, beide Sichten zu kombinieren, muss aber ganz klar gesagt werden, dass der Regelmäßigkeitsansatz nicht funktioniert. Wenn Gesetze außerhalb und innerhalb von Experimenten möglich sind, dann können diese nicht mit Regelmäßigkeiten, die im Rahmen von Experimenten möglich sind, gleichgesetzt werden.[11]
Nun wurde die Regelmäßigkeitsthese einer strengen Prüfung unterzogen und festgestellt, dass sie so nicht funktioniert. Trotzdem ist die Regelmäßigkeitsthese heute noch ein wichtiges Instrument in der Wissenschaft um Erkenntnis zu erlangen, wurde aber im Laufe der Zeit öfters modifiziert und eingeschränkt, so das nicht allein aus Regelmäßigkeiten Gesetze entstehen.
7. Die Kontrahenten
Die Meinungsvielfalt über Naturgesetze ist sehr ausgeprägt. Wie sind Naturgesetze entstanden? Wie hat man herausgefunden, dass es sich tatsächlich um ein Naturgesetz handelt? Ist es wahr oder eine Illusion, was ich sehe? Diese Liste von Fragen könnte man beliebig weiterführen und würde wahrscheinlich zu keinem Ende finden, denn eines steht fest, es gibt keine Theorie über Naturgesetze, die von jedem Individuum als richtig und allgemeingültig akzeptiert werden würde, den keiner ist bereit seine geläufigen, tief verwurzelten Überzeugungen über die Natur der Welt an ein anderes Raster anzupassen.
Aus diesen Gründen blieb es nicht aus, dass sich im Laufe der Zeit Meinungsgruppen bzw. Verfechter dieser gebildet haben, welche vehement ihr Muster über Naturgesetze als richtig betrachten. All diese Kontrahenten setzen eigene Akzente und treten in verschiedenen Schattierungen auf.
Um die Kontrahenten zu differenzieren werden zunächst zwei Grundpositionen unterschieden.
Zum einen die Anhänger der Regularitätsthese - und zum anderen die Anhänger der Notwendigkeisthese der Naturgesetze.
Nach der Regularitätsthese sind Naturgesetze Aussagen über Regelmäßigkeiten in der Welt, eine Beschreibung wie die Welt ist und wie sie sich verhält. Ein positiver Aspekt an der Regularitätsthese ist, dass unsere Alltagserklärungen weder Allgemeinheit noch Notwendigkeit benötigen um als richtig zu gelten. Schon Gewohnheiten der Erfahrung genügen oft. Diese Gesetze „erzwingen“ oder „verursachen“ eigentlich nichts, denn sie sind keine handelnden oder materiellen Kausalkräfte.
Außerdem benötigt die Wissenschaftliche Praxis keine Annahme einer naturgesetzlichen oder metaphysischen Notwendigkeit, denn worin sich diese von logischer Notwendigkeit unterscheidet und ob sie unabhängig von Randbedingungen überhaupt definierbar ist, ist zweifelhaft.
Für die Notwendigkeitsthese sind die genannten Merkmale nicht ausreichend. Man kann schon aus dem Namen ableiten, das hier die Notwendigkeit und somit eine zusätzliche Bedingung hinzukommt.
Es wird angenommen, dass Naturgesetze als Prinzipien salopp gesagt, die natürlichen Phänomene regieren oder hervorbringen, d.h. die Welt gehorcht Naturgesetzen. Nun kommt dieser Thematik ein modales Element hinzu, das bestimmt, was möglich ist.
Wenn man beispielsweise Uran mit Gold vergleichen möchte, so kann man sagen, dass alle Urankugeln einen Durchmesser von weniger als zehn Kilometer haben, da eine solche Kugel sofort als Atombombe explodieren würde, hingegen dies für Goldkugeln nicht der Fall wäre, obwohl man weder das eine noch das andere jemals beobachtet hat.
Aus diesen beiden Stellungen heraus, bilden sich folgende erwähnenswerte Kontrahenten.[12]
7.1. Realisten oder Platoniker
Realisten oder Platoniker folgen dem Prinzip der Notwendigkeitsthese und glauben, dass Naturgesetze unabhängig von unseren Formulierungen existieren. Sie sind so wirklich wie Stühle, schrieb der Physik-Nobelpreisträger Steven Weinberg.
Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb der Logiker Gottlob Frege:
„Naturgesetze bedürfen nicht nur unserer Anerkennung nicht, um wahr zu sein, sie brauchen nicht einmal von uns gedacht zu werden. Ein Naturgesetz wird nicht von uns ersonnen, sondern entdeckt. Und wie eine wüste Insel im Eismeer längst da war, ehe sie vom Menschen gesehen wurde, so gelten auch die Gesetze der Natur und ebenso die mathematischen von jeher und nicht erst seit ihrer Entdeckung“[13],
Somit unterstreicht auch Frege den Glauben der Realisten bzw. Platoniker. Zusammenfassend existieren für diese Gattung alle Naturgesetze, auch jene die vom Menschen noch nicht entdeckt wurden. Ableitend ist das Universum mit Merkmalen ausgestattet, welche durch ihre Vielfalt wahrscheinlich nie alle entdeckt bzw. erforscht werden können, dennoch in Ihrer Anzahl endlich bzw. beschränkt sind.[14]
7.2. Positivisten und Nominalisten
Positivisten und Nominalisten folgen der Regularitätsthese. Sie nehmen an, dass Physikalische Theorien nur mathematische Modelle sind, die der Mensch erschaffen hat. Was der Wirklichkeit entspricht, kann nicht gefragt werden, da es keine Modellunabhängigen Überprüfungen gibt, was real ist und was nicht.
„Wirklich sind in der Natur nur die einzelnen Wirkungen vorhanden, die Gesetze existieren bloß in den Ideen der Naturforscher oder in den Systemen der Naturlehre“[15] brachte Johann Samuel Traugott Gehler bereits 1798 in seinem „Physikalischen Wörterbuch“ auf den Punkt.
Der Physiker Ernst Mach, einer der Väter des Positivismus, plädierte dafür, sich mit einer möglichst einfachen mathematischen Beschreibung des empirischen Forschens zu begnügen.
Extreme Positivisten bzw. Nominalisten gehen davon aus, dass der ganzen modernen Weltanschauung eine Täuschung zugrunde liegt, dass die so genannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien.[16]
7.3. Pragmatiker
Pragmatiker übernehmen in dieser ganzen Thematik eher eine neutrale Rolle, sie halten sich aus dem Streit heraus. Sie sehen Naturgesetze als nützliche Hilfsmittel an, welche Phänomene und beobachtbare Regelmäßigkeiten beschreiben, die für sie real sind.
Danach lässt sich ableiten, dass die Pragmatiker zu den Anhängern der Regularitätsthese gehören, da eine Notwendigkeit nicht zwingend ist.
„Mich interessiert das Modell, das die Beobachtungen am effizientesten erklärt“[17], sagte der Physiker und Kosmologe Paul Steinhardt und nennt sich in diesem Sinn einen Pragmatiker.
Für Pragmatiker sind Modelle immer Vereinfachungen, in denen die Realität keine zwingende Rolle spielt. Diese Modelle sollen die Eigenschaft haben, dass die größtmögliche Vielfalt an komplexen Phänomenen mit der einfachsten Menge an Konzepten erfasst werden kann. Welche für den Menschen leicht verständlich sind und Vorraussagen erlauben.
Beispielweise könnte man versuchen bei einem Fußballspiel vorherzusagen was die Spieler als nächsten tun. Zum einen könnte man hierzu Bilder heranziehen oder aber auch eine Aufzeichnung im Fernsehen anschauen. Bei beiden Modellen würde man zum gleichen Ergebnis kommen, es wäre beides nutzlos, wenn wir vorhersagen treffen wollten, was als nächstes passiert. Je nach dem welches Modell wir wählen, hängt davon ab, welche Fragen wir stellen, den Realität ist nicht immer, was man möchte. Dem Pragmatiker ist einfaches Verständnis lieber.[18]
7.4. Konventionalisten
Für Konventionalisten spielen neben den nützlichen Hilfsmitteln aus Naturgesetzen auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Dies unterscheidet sie von dem Pragmatiker und lässt sie radikaler erscheinen.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Naturgesetze durch Meinungsführer oder Forschermehrheit, ein reines soziales Konstrukt darstellen. Alle glauben was „einer“ sagt. Die Natur richtet sich nach den Menschen.
Ob die Sonne sich um die Erde dreht oder umgekehrt, ist übertrieben gesagt, eine Laune der Geschichte.[19]
7.5. Instrumentalisten und Konstruktivisten
Beide Gruppen sehen Naturgesetze als Mittel zur Beschreibung an. Die Instrumentalisten sehen Naturgesetze als Werkzeuge an und insofern praktisch oder unpraktisch, nicht aber wahr oder Falsch.
„Es mag eine Welt dort draußen geben oder nicht, wir haben jedenfalls nur Theorien, und die guten benutzen wir als „Schlussfahrkarten“[20].
Hohe Bedeutung hat der Werkzeugcharakter für die Konstruktivisten, welche ihn fast wörtlich nehmen. Anwendung findet er insbesondere als Vorschriften zum Bau und zur Bedienung von Apparaten und Messinstrumenten. Die Naturwissenschaft ist hier angewandte Technik, nicht umgekehrt.
„Es ist doch eine nicht aus der Welt zu schaffende Tatsache, dass unsere experimentellen Apparaturen nicht in der Natur herumliegen, sondern wir sie erst einmal bauen müssen. Uns leitet dabei das Ziel, Verläufe eines bestimmten Typs störungsfrei reproduzieren zu können“[21], schreibt Holm Tetens, Philosophie-Professor an der freien Universität Berlin in seiner Streitschrift „Was ist ein Naturgesetz“.
Radikale Konstruktivisten sehen Naturwissenschaft als nichts anderes als technisches Know-how an. Zugespitzt sind Naturgesetze demnach nur aussagen über funktionierende Maschinen.[22]
Ganz egal, welcher Sicht man sich nun anschließt oder nicht. Die Frage wer nun das richtige glaubt oder nicht, führt zu einem fortlaufenden Streit der die Wissenschaft, im Gegensatz zu vielen fruchtlosen Debatten in der Politik, weiterbringt.
8. Fazit
Wir haben in dieser Seminararbeit versucht zu erarbeiten, was Naturgesetze sind, wie man sie erkennt, was für verschiedene Methoden man zum Bestimmen von Gesetzen hat und wir haben uns mit den Kontrahenten auseinandergesetzt.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Naturgesetz nur schwer oder überhaupt nicht zu definieren ist. Diese Tatsache belegt ein Blick in die Geschichte der Wissenschaft in der sich z.B. Aristoteles und ein Grossteil der Menschheit zu dieser Zeit sicher waren, dass die Erde eine Scheibe war. Dies ist bekanntlich ein Irrtum. Doch was lässt die Wissenschaftler heute sicher sein, dass die aktuell geltenden Naturgesetze sicher sind? Wann ist etwas überhaupt sicher? Gestern war ich z.B. 100 % sicher einen Kommilitonen im Einkaufcenter gesehen zu haben. Als ich ihn jedoch einen Tag später darauf angesprochen hatte, sagte er mir, dass er zu dieser Zeit mit seiner Freundin zuhause Fernsehen geschaut hat. Daraus kann man schließen, dass niemals etwas zu 100 % sicher ist. Ein Irrtum ist nie ausgeschlossen.
Das gleiche gilt auch für Naturgesetze! Die Wissenschaftler sind sich heute „ziemlich“ sicher, dass ihre Theorien stimmen aber in tausend Jahren kann alles anders sein. Vielleicht hält man in tausend Jahren die Einstein´sche Relativitätstheorie ebenso für falsch.
Wir wollen noch etwas weiter gehen und stellen alles Bisherige in Frage! Vielleicht ist im gesamten Universum nichts so wie es scheint. Vielleicht ist alles nur ein Traum, vielleicht ist alles was wir für real erachten tatsächlich völlig unreal.[23]
Wie man sieht, werden Wissenschaftler und Philosophen sich in der nächsten Zeit nicht einigen können. Doch der Streit zwischen Ihnen bringt uns wohlmöglich immer näher der Antwort – Was Naturgesetze sind.
Wir kommen zu der Schlussfolgerung, dass man Naturgesetze nicht definieren kann aber dass mit Hilfe von Naturgesetzen die Welt äußerst erfolgreich beschrieben, erklärt, prognostiziert und verändert werden kann.
9. Literaturverzeichnis
α Bücher
Ritter, Joachim/Gründer, Karlfried: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 6, Basel/Stuttgart: Schwabe & Co. AG, 1984.
Chalmers, Alan F.: Wege der Wissenschaft, 5. Auflage, Berlin: Springer, 2001.
Genz, Henning: Wie die Naturgesetze Wirklichkeit schaffen, München/Wien: Hanser, 2002.
Baumann, Peter: Erkenntnistheorie, Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, 2001.
β Fachzeitschriften
Vaas, Rüdiger: Naturgesetze – Was die Welt zusammen hält, in: Bild der
Wissenschaft, 2003, Heft-Nr. 12, S. 38 – 56.
γ Internet
www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/wisstheo5.htm, 10.06.04
www.luna-tikk.de/lingen_09_2003/material/grundfragen_rest.pdf, 10.06.04,
[...]
[1] Vaas, Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S. 42
[2] Vgl. Vaas, Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.40-43
[3] Vaas Rüdiger, Naturgesetz, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.44
[4] Vgl. Ritter Joachim/Gründer Karlfried, Historisches Wörterbuch der Philosophie,Basel/Stuttgart (1984), S. 527 - 531; Chalmers Alan F., Wege der Wissenschaft, Berlin (2001), S. 171
[5] Vgl. www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/wisstheo5.htm, 10.06.04
[6] www.uni-koeln.de/phil-fak/voelkerkunde/prosem/wisstheo5.htm, 10.06.04
[7] Vgl. Genz Henning, Naturgesetze, München/Wien (2002), S. 250 - 251
[8] Chalmers Alan F., Wege der Wissenschaft, 2001, S.172
[9] Chalmers Alan F., Wege der Wissenschaft, 2001, S.172
[10] Chalmers Alan F., Wege der Wissenschaft, 2001, S.173
[11] Vgl. Chalmers Alan F., Wege der Wissenschaft, Berlin (2001), S.172 - 174
[12] Vgl. Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.44
[13] Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft,(2003) H.12, S.45
[14] Vgl. Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.45
[15] Vaas, Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.45
[16] Vgl. Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.45
[17] Vaas, Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S. 45
[18] Vgl. Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.45
[19] Vgl. Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.45
[20] www.luna-tikk.de/lingen_09_2003/material/grundfragen_rest.pdf, 10.06.04,
[21] Vaas Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft,(2003) H.12, S.46
[22] Vgl. Vaas, Rüdiger, Naturgesetze, in Fachzeitschrift: Bild der Wissenschaft, (2003) H.12, S.46
Häufig gestellte Fragen zu Naturgesetze
Was sind Naturgesetze laut dieser Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Naturgesetze schwer oder gar nicht zu definieren sind. Es wird betont, dass die Welt mit Hilfe von Naturgesetzen äusserst erfolgreich beschrieben, erklärt, prognostiziert und verändert werden kann.
Wie unterschieden sich Naturgesetze von juristischen und religiösen Gesetzen?
Juristische und religiöse Gesetze können übertreten werden, ohne dass sie dadurch außer Kraft gesetzt werden. Ein Naturgesetz hingegen kann nicht übertreten werden.
Welche unstrittigen Merkmale von Naturgesetzen werden in der Arbeit genannt?
Naturgesetze müssen überprüfbar sein, empirisch gut bestätigt sein, gelten generell und universell, machen Wenn-Dann-Aussagen, formulieren Zusammenhänge zwischen zwei oder mehr Größen und müssen als wahr akzeptierbar sein.
Welche wissenschaftlichen Methoden werden zur Bestimmung von Naturgesetzen erwähnt?
Die Arbeit erwähnt den Induktivismus (Ableitung von Gesetzen aus Tatsachen), den Falsifikationismus (Versuch, Gesetze durch Prüfung zu widerlegen) und Kuhns Paradigmen (Aufstellung eines Paradigmas mit einem harten Kern und einer austauschbaren Hülle).
Was ist die Regularitätsthese bezüglich Naturgesetzen?
Die Regularitätsthese besagt, dass Naturgesetze Aussagen über Regelmäßigkeiten in der Welt sind und beschreiben, wie die Welt ist und wie sie sich verhält. Sie „erzwingen“ oder „verursachen“ nichts.
Was ist die Notwendigkeitsthese bezüglich Naturgesetzen?
Die Notwendigkeitsthese geht davon aus, dass Naturgesetze als Prinzipien die natürlichen Phänomene regieren oder hervorbringen, d.h., die Welt gehorcht Naturgesetzen.
Welche Kontrahenten bezüglich Naturgesetzen werden in der Arbeit vorgestellt?
Die Arbeit stellt Realisten/Platoniker, Positivisten/Nominalisten, Pragmatiker, Konventionalisten sowie Instrumentalisten und Konstruktivisten vor. Diese Gruppen haben unterschiedliche Ansichten darüber, wie Naturgesetze entstanden sind und welche Rolle sie spielen.
Was glauben Realisten oder Platoniker über Naturgesetze?
Realisten oder Platoniker glauben, dass Naturgesetze unabhängig von unseren Formulierungen existieren. Sie sind so wirklich wie greifbare Gegenstände. Es wird angenommen, dass alle Naturgesetze existieren, auch jene die vom Menschen noch nicht entdeckt wurden.
Was nehmen Positivisten und Nominalisten über Naturgesetze an?
Sie nehmen an, dass physikalische Theorien nur mathematische Modelle sind, die der Mensch erschaffen hat. Ob ein Modell der Wirklichkeit entspricht, kann nicht gefragt werden.
Was ist der Standpunkt der Pragmatiker in Bezug auf Naturgesetze?
Pragmatiker betrachten Naturgesetze als nützliche Hilfsmittel, welche Phänomene und beobachtbare Regelmäßigkeiten beschreiben, die für sie real sind. Sie sehen Naturgesetze als Modelle, die die größte Vielfalt an komplexen Phänomenen mit der einfachsten Menge an Konzepten erfassen.
Was ist die Sichtweise der Konventionalisten in Bezug auf Naturgesetze?
Für Konventionalisten spielen neben den nützlichen Hilfsmitteln aus Naturgesetzen auch soziale Aspekte eine wichtige Rolle. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Naturgesetze durch Meinungsführer oder Forschermehrheit, ein reines soziales Konstrukt darstellen.
Wie sehen Instrumentalisten und Konstruktivisten Naturgesetze?
Beide Gruppen sehen Naturgesetze als Mittel zur Beschreibung an. Instrumentalisten sehen Naturgesetze als Werkzeuge an. Hohe Bedeutung hat der Werkzeugcharakter für die Konstruktivisten, welche ihn fast wörtlich nehmen. Die Naturwissenschaft ist hier angewandte Technik, nicht umgekehrt.
- Quote paper
- Jan Spies (Author), Christoph Hüther (Author), 2005, Naturgesetze und wissenschaftliche Methoden. Die verschiedenen Ansichten von Naturwissenschaftlern und Philosophen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109288