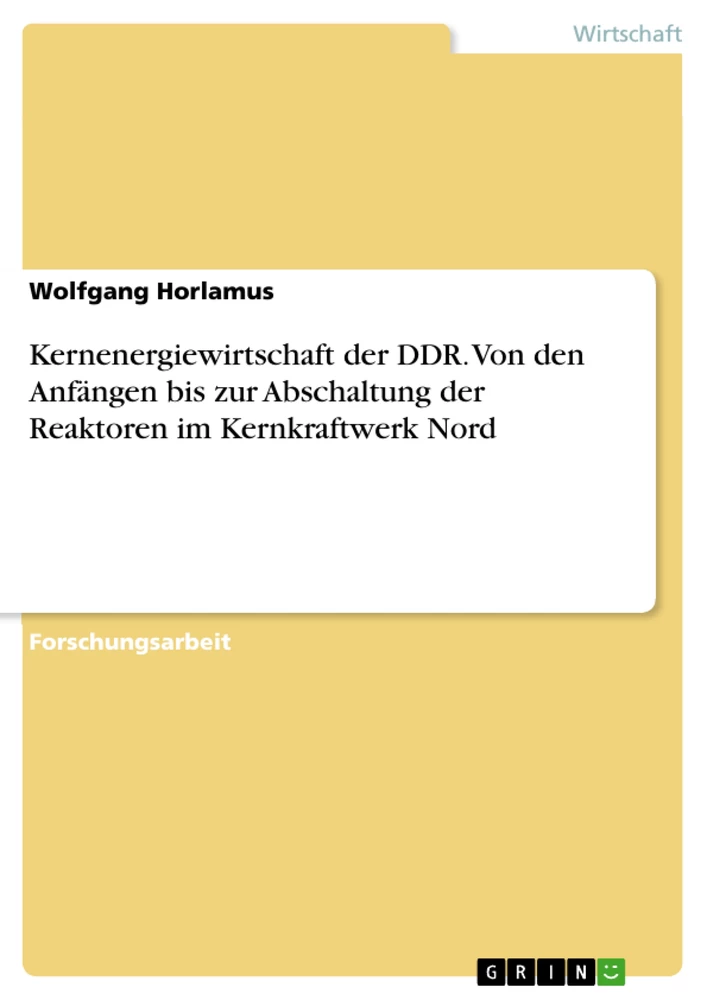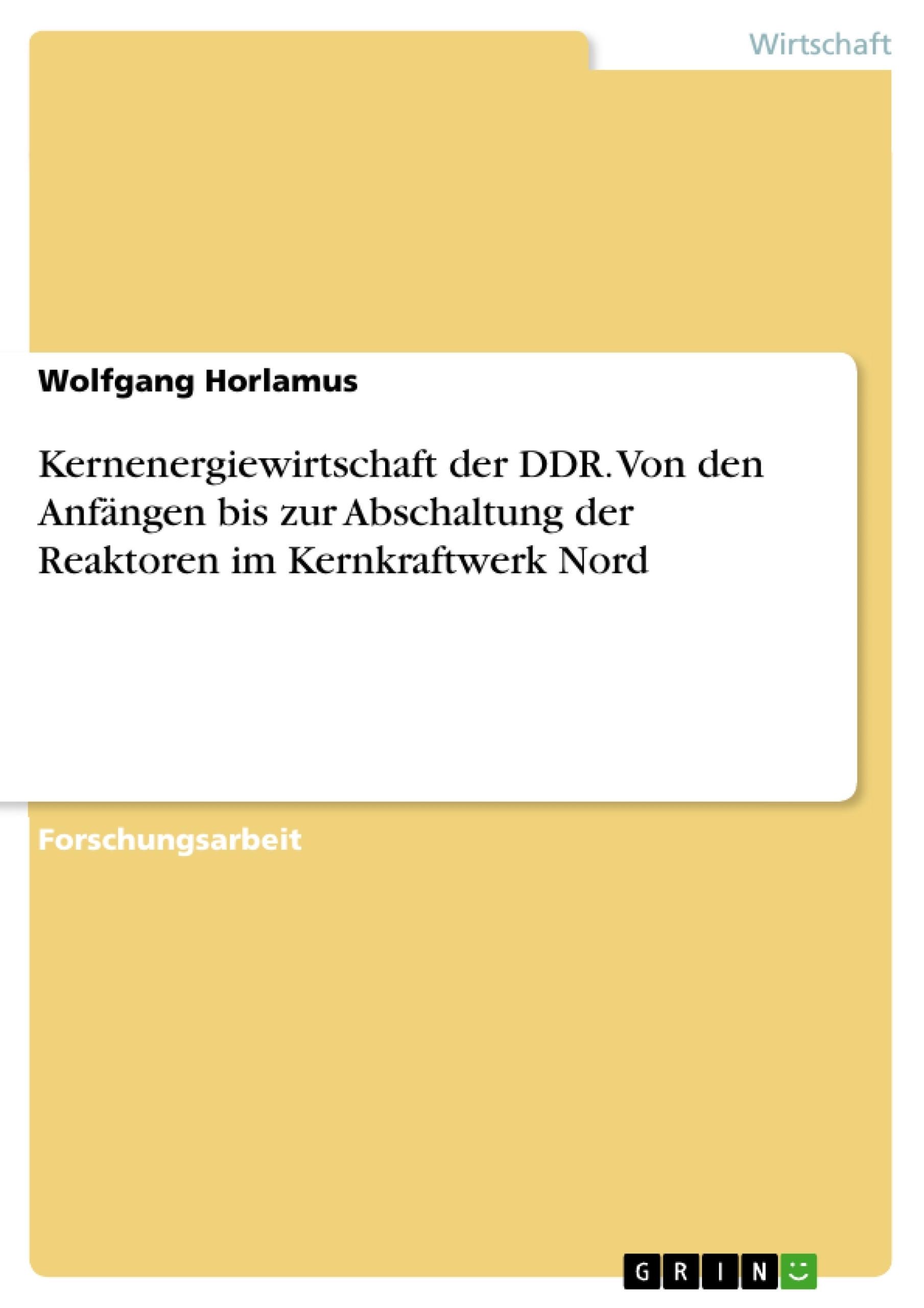Die Studie ist ein Beitrag zur Aufarbeitung der Wirtschafts-, Wissenschafts- und Technikgeschichte der DDR auf dem Gebiet der Kernenergiewirtschaft. Sie gliedert sich in zwei Kapitel: Erstens, die Vorgeschichte der Kernenergiewirtschaft der DDR und zweitens die Entwicklungsabschnitte in der Kernenergiewirtschaft der DDR.
Beginnend mit dem Zeitraum der 30erJahre bis hin zur Stilllegung Kernkraftwerke der DDR werden Im Einzelnen untersucht:
- die Vorleistungen deutscher Wissenschaftler für die Nutzung der kontrollierten Kernspaltung zur Energiegewinnung,
- das Verbot der deutschen Kernforschung und die Interessen der Alliierten nach dem zweiten Weltkrieg,
- der Einstieg der DDR in die Atomforschung und Isotopenanwendung sowie
- die Entwicklungsetappen der Kernenergiewirtschaft der DDR.
Aus regionaler, nationaler und internationaler Sicht verdient diese Problemstellung Beachtung. Insgesamt 76 Kernkraftwerks-Blöcke waren 1988 in der Wirtschaftsgemeinschaft des RGW in Betrieb. Kernkraftwerke des zerfallenen RGW-Blockes sind in Zusammenarbeit mit der Sowjetunion projektiert und gebaut worden. Wirtschaftshistorische und technologische Zusammenhänge in diesem einstigen Wirtschaftsverbund sind signifikant. Es werden Szenarien und Lösungen für die brisante Konstellation gebraucht. Historische Einblicke können hier für neuartige Sichtweisen zur Findung von Strategien und Aktivitäten vermitteln.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitende Bemerkungen
- 1. Zur Vorgeschichte der Kernenergiewirtschaft der DDR
- 1.1. Vorleistungen deutscher Wissenschaftler für die Nutzung der kontrollierten Kernspaltung zur Energiegewinnung
- 1.2. Das Verbot der deutschen Kernforschung und die Interessen der Alliierten
- 2. Entwicklungsabschnitte in der Kernenergiewirtschaft der DDR
- 2.1. Der Einstieg in die Atomforschung und Isotopenanwendung
- 2.2. Rheinsberg - Lubmin - Stendal: Anfang und Ende der Kernenergiewirtschaft der DDR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht die Geschichte der Kernenergiewirtschaft in der DDR, von ihren Anfängen bis zur Stilllegung des Kernkraftwerks Nord. Sie beleuchtet die technischen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Aspekte dieser Entwicklung und analysiert die Vorleistungen deutscher Wissenschaftler sowie die Einflüsse der politischen Rahmenbedingungen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der DDR innerhalb des RGW-Wirtschaftsraums.
- Die Vorgeschichte der Kernforschung in Deutschland und die Auswirkungen des Verbots nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Entwicklungsphasen der Kernenergiewirtschaft in der DDR
- Der Beitrag der DDR-Wissenschaftler und Ingenieure zur Kerntechnik
- Die politischen und gesellschaftlichen Aspekte der Kernenergie in der DDR
- Die Einbettung der DDR-Kernenergiewirtschaft in den RGW-Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitende Bemerkungen: Diese Einleitung skizziert die Ziele der Studie und betont die mangelnde Transparenz bezüglich der Risiken der Kernenergie für die Bevölkerung der DDR. Sie hebt hervor, dass die Kernenergiewirtschaft der DDR nicht nur ein wirtschaftlicher Faktor war, sondern auch technische, wissenschaftliche, soziale, ökologische und politische Aspekte umfasste. Die Einleitung formuliert zentrale Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf der Studie untersucht werden, darunter die Vorleistungen deutscher Wissenschaftler, die Gründe für die Entwicklung der Kernenergie in der DDR, sowie die zukünftige Nutzung ehemaliger Standorte.
1. Zur Vorgeschichte der Kernenergiewirtschaft der DDR: Dieses Kapitel untersucht die Vorleistungen deutscher Wissenschaftler im Bereich der Kernenergie vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Es analysiert den Einfluss des Verbots der deutschen Kernforschung nach dem Krieg durch die Alliierten und die daraus resultierenden Herausforderungen für die spätere Entwicklung der Kernenergie in der DDR. Der Abschnitt beleuchtet den wissenschaftlichen und technischen Wissensstand vor dem Hintergrund der politischen Restriktionen und legt die Grundlage für das Verständnis der späteren Entwicklungen in der DDR.
2. Entwicklungsabschnitte in der Kernenergiewirtschaft der DDR: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Phasen der Entwicklung der Kernenergiewirtschaft in der DDR, vom Einstieg in die Atomforschung und Isotopenanwendung bis hin zum Betrieb und zur Schließung der Kernkraftwerke. Es analysiert die technologischen Fortschritte, die Herausforderungen und die politischen Entscheidungen, die diese Entwicklung prägten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von Rheinsberg, Lubmin und Stendal als zentralen Standorten und deren Bedeutung für die gesamte DDR-Kernenergiewirtschaft. Die Zusammenfassung der einzelnen Unterkapitel in diesem Kapitel vermittelt ein umfassendes Bild der Entwicklung der Kernenergie in der DDR, von den Anfängen bis zu ihrem Ende.
Schlüsselwörter
Kernenergiewirtschaft DDR, Atomforschung, RGW, Kernkraftwerke, Technologieentwicklung, Wissenschaftsgeschichte, politische Rahmenbedingungen, soziale Auswirkungen, Umweltaspekte, Rheinsberg, Lubmin, Stendal, Tschernobyl.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Kernenergiewirtschaft der DDR
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie untersucht die Geschichte der Kernenergiewirtschaft in der DDR, von ihren Anfängen bis zur Stilllegung des Kernkraftwerks Nord. Sie analysiert die technischen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Aspekte dieser Entwicklung und berücksichtigt die Rolle der DDR im RGW-Wirtschaftsraum.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie beleuchtet die Vorgeschichte der Kernforschung in Deutschland, die Entwicklungsphasen der Kernenergiewirtschaft in der DDR, den Beitrag der DDR-Wissenschaftler, die politischen und gesellschaftlichen Aspekte der Kernenergie in der DDR und die Einbettung der DDR-Kernenergiewirtschaft in den RGW-Kontext. Besonderes Augenmerk liegt auf den Standorten Rheinsberg, Lubmin und Stendal.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie enthält eine Einleitung, ein Kapitel zur Vorgeschichte der Kernenergiewirtschaft der DDR (einschließlich der Vorleistungen deutscher Wissenschaftler und des Verbots der deutschen Kernforschung nach dem Zweiten Weltkrieg), und ein Kapitel zu den Entwicklungsabschnitten in der Kernenergiewirtschaft der DDR (mit Fokus auf Rheinsberg, Lubmin und Stendal).
Was ist das Ziel der Studie?
Die Studie zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der Kernenergiewirtschaft in der DDR zu zeichnen, einschließlich der mangelnden Transparenz bezüglich der Risiken für die Bevölkerung und der Analyse der komplexen Wechselwirkungen zwischen technischen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen und politischen Faktoren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Kernenergiewirtschaft DDR, Atomforschung, RGW, Kernkraftwerke, Technologieentwicklung, Wissenschaftsgeschichte, politische Rahmenbedingungen, soziale Auswirkungen, Umweltaspekte, Rheinsberg, Lubmin, Stendal, Tschernobyl.
Welche Aspekte der Kernenergiewirtschaft in der DDR werden besonders hervorgehoben?
Die Studie hebt die Vorleistungen deutscher Wissenschaftler hervor, analysiert die Auswirkungen des Verbots der deutschen Kernforschung nach dem Zweiten Weltkrieg und untersucht die Entwicklung der Kernkraftwerke in Rheinsberg, Lubmin und Stendal. Sie betrachtet auch die Einbindung der DDR-Kernenergiewirtschaft in den RGW-Kontext und die sozialen, ökologischen und politischen Aspekte.
Welche Forschungsfragen werden in der Studie untersucht?
Die Studie untersucht die Vorleistungen deutscher Wissenschaftler, die Gründe für die Entwicklung der Kernenergie in der DDR und die zukünftige Nutzung ehemaliger Standorte. Sie beleuchtet auch die mangelnde Transparenz bezüglich der Risiken der Kernenergie für die Bevölkerung der DDR.
- Citar trabajo
- Dr. Wolfgang Horlamus (Autor), 1993, Kernenergiewirtschaft der DDR. Von den Anfängen bis zur Abschaltung der Reaktoren im Kernkraftwerk Nord, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109206