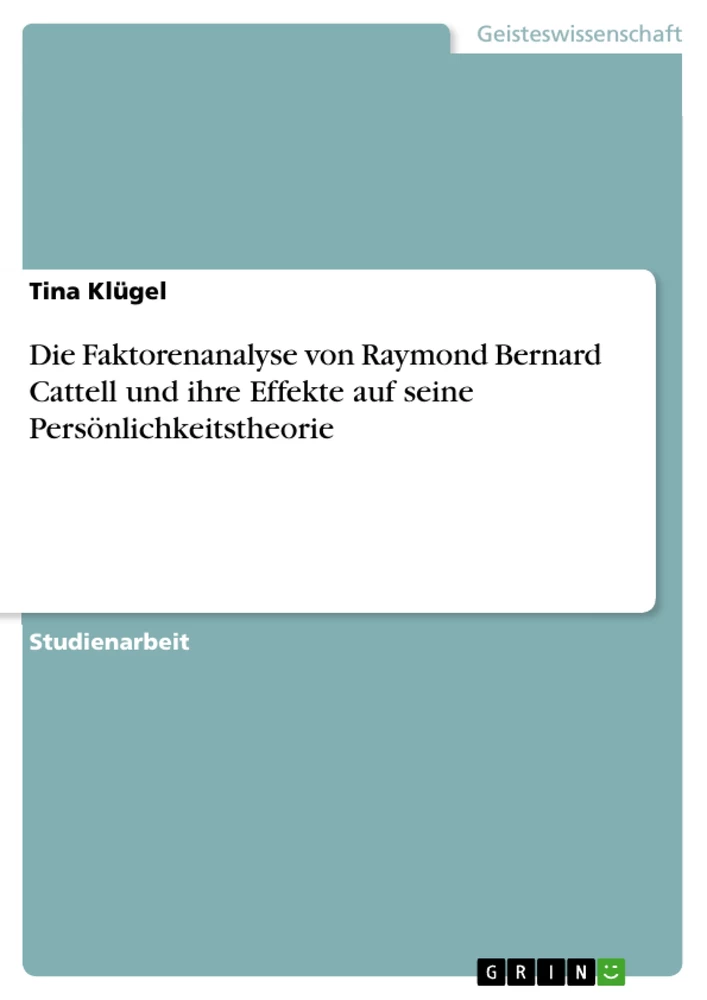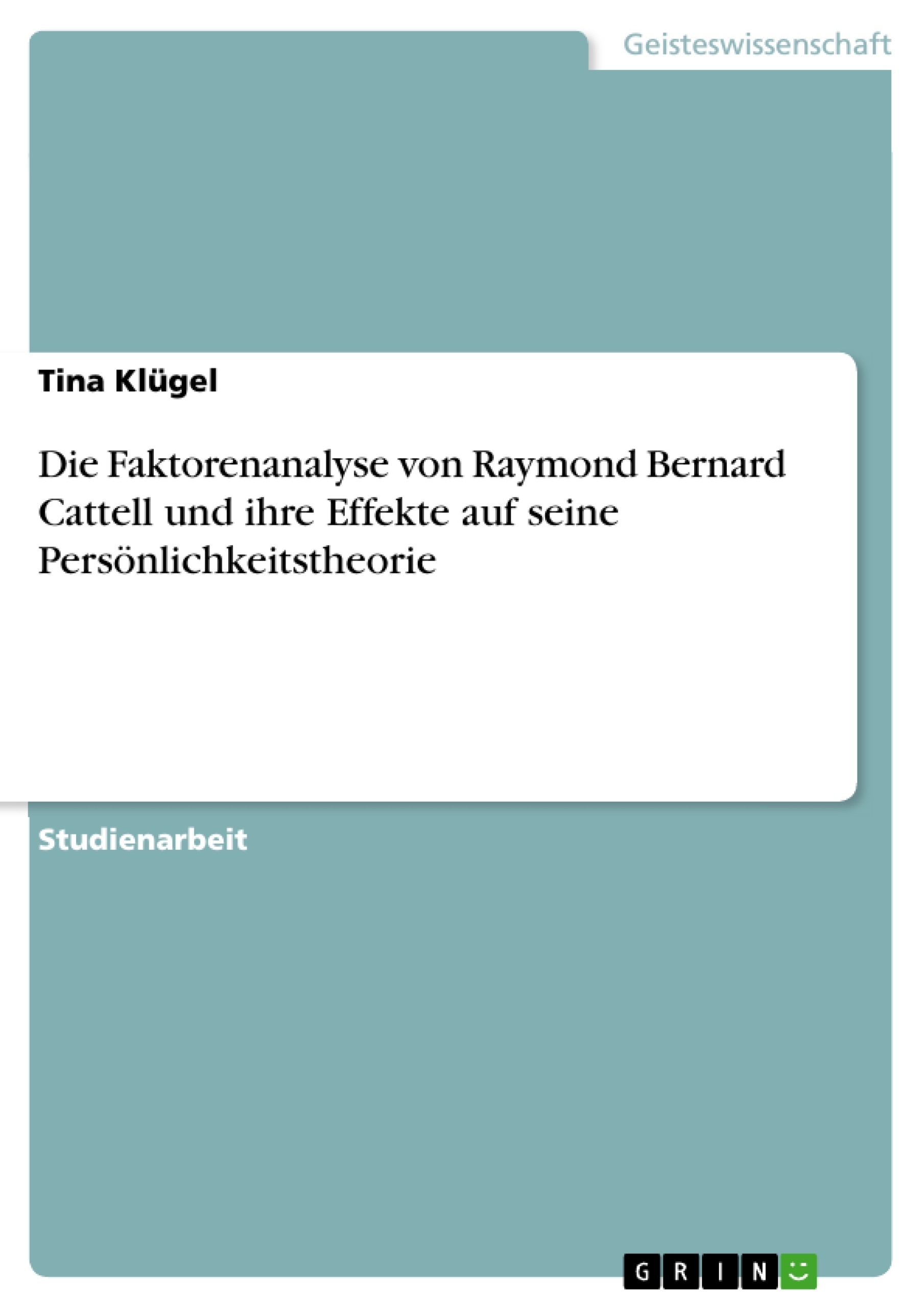Entdecken Sie die faszinierende Welt der Differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung, in der die Analyse individueller Unterschiede im Mittelpunkt steht! Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die Theorien und Methoden von Raymond Bernard Cattell, einem Pionier auf dem Gebiet der Persönlichkeits- und Intelligenzforschung. Tauchen Sie ein in Cattells bahnbrechende Arbeit zur Faktorenanalyse und erfahren Sie, wie er eine Vielzahl von Eigenschaftsbegriffen auf wenige grundlegende Persönlichkeitsdimensionen reduzierte. Ergründen Sie die Struktur seiner Persönlichkeitstheorie, die von Ability-Traits über Temperament bis hin zu dynamischen Merkmalen wie Ergic Drives und Sentiments reicht. Verstehen Sie, wie Cattell verschiedene Datenquellen nutzte, um ein umfassendes Bild der Persönlichkeit zu erstellen und wie er die Bedeutung situativer Einflüsse in seine Forschung integrierte. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Cattells hierarchischem Intelligenzmodell, das zwischen flüssiger und kristalliner Intelligenz unterscheidet und die Bedeutung genetischer und umweltbedingter Faktoren beleuchtet. Obwohl einige seiner Studien heute überholt sind, bleibt Cattell eine Schlüsselfigur für das Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit, Intelligenz und Verhalten. Dieses Buch bietet Ihnen einen fundierten Einblick in Cattells einflussreiche Arbeit und zeigt, wie seine Ideen die moderne psychologische Forschung bis heute prägen. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Studierende, Forscher und alle, die sich für die faszinierenden Geheimnisse der menschlichen Persönlichkeit interessieren. Erfahren Sie mehr über Persönlichkeitstests, Intelligenzmessung und die Bedeutung individueller Unterschiede in verschiedenen Lebensbereichen. Lassen Sie sich von Cattells innovativen Ansätzen inspirieren und entdecken Sie neue Perspektiven auf die Vielfalt menschlichen Verhaltens. Die Konzepte der differentiellen Psychologie, Persönlichkeitsmerkmale und Intelligenzstruktur werden verständlich erläutert und durch zahlreiche Beispiele veranschaulicht. Diese tiefgreifende Analyse der differentiellen Psychologie und Persönlichkeitsforschung bietet sowohl einen historischen Überblick als auch einen Einblick in aktuelle Forschungsansätze, was sie zu einer wertvollen Ressource für jeden macht, der sich mit der menschlichen Psyche auseinandersetzen möchte.
Inhalt
1 Einleitung
2 Faktorenanalyse
3 Die Persönlichkeitstheorie von Cattell
3.1 Struktur der Cattellschen Persönlichkeitstheorie
3.2 Verfahren der Cattellschen Persönlichkeitstheorie
4 Intelligenz
5 Fazit
6 Literatur
1 Einleitung
Die Differentielle Psychologie leistet einen Beitrag zur ökonomischen Steuerung sozialer Prozesse. Mit der Beschreibung und Analyse menschlichen Verhaltens und menschlicher Fähigkeiten identifizieren Teildisziplinen wie die Persönlichkeits- und Intelligenzforschung individuelle Stärken und Defizite im inter- und intrasubjektiven Vergleich. Damit schaffen sie eine Entscheidungsgrundlage für die nützlichkeitsorientierte Selektion in vielen gesellschaftlichen Bereichen (Erziehung, Arbeitswelt, Militär etc.). „Was Intelligenz... auch sein mag, immer trägt deren Ausmaß, das einem Individuum zugeschrieben wird, mit dazu bei, dessen Platz in der hierarchischen Struktur seiner Gruppe zu bedingen“ Dieses spezifische Erkenntnisinteresse ergibt sich zum Teil daraus, dass die verfügbaren wissenschaftlichen Methoden nur begrenzte Aussagen über Begriffe wie „Persönlichkeit“ erlauben, obwohl sie in der Alltagssprache sehr vielseitig eingesetzt werden. Umgekehrt prägt der ökonomische Auftrag der psychologischen Forschungen das Design ihrer Theorien und Methoden: Um auf breiter Front nützlich zu sein, muss die Wissenschaft selbst ökonomisch arbeiten.[1]
Eines der üblichen Verfahren, mit denen die Persönlichkeitstheorie die gewünschte Effektivität herstellt, ist die nomothetische Methode. Im Gegensatz zur idiographischen Methode erfasst sie Unterschiede zwischen den Einzelnen nicht mittels individueller Protokolle. Vielmehr entwickelt sie Techniken, mit denen Verhaltensweisen nicht nur erfasst, sondern auch kategorisiert und verglichen werden können. Das geschieht mit Hilfe theoriesprachlicher Konstrukte, die individuelle Merkmalsausprägungen durch einen abstrakten Begriff repräsentieren. Beispielsweise ist der Begriff Intelligenz ein solches theoriesprachliches Konstrukt. Wissenschaftliche Aussagen darüber können sich also immer nur auf den Rahmen einer klar vorgegebenen Definition beziehen.
Diese begriffliche Verallgemeinerung ist das Grundprinzip der Faktorenanalyse. Vielleicht ist es also kein Zufall, dass die Faktorenanalyse die Persönlichkeitspsychologie in den vergangenen sechs Jahrzehnten entscheidend geprägt hat. Einer der ersten, der diese Methode in ihrer Tragweite erschließt, ist Raymond Bernard Cattell, ein Pionier der Differentiellen Psychologie. Obwohl nur wenige seiner Ergebnisse noch heute genügend Validität besitzen, bauen viele der heutigen Forschungen auf seinen Ideen und Ansätzen auf. Das Interesse an dieser Aktualität leitet die Argumentation der vorliegenden Arbeit.
Das folgende Kapitel beschreibt kurz die Faktorenanalyse sowie ihre Anwendung und Erweiterung durch Cattell. Anschließend untersucht die Arbeit die Effekte der Faktorenanalyse auf Cattells Persönlichkeitstheorie. Da die Intelligenzforschung in diesem Zusammenhang einen großen Raum einnimmt, ist ihr ein eigenes Kapitel gewidmet. Die gesamte Darstellung bezieht sich vor allem auf das Standardwerk von Amelang und Bartussek[2].
2 Faktorenanalyse
Der Grundgedanke der Faktorenanalyse wird durch das Verfahren deutlich, mit dem Cattell eine hohe Anzahl von Eigenschaftsbegriffen auf eine verhältnismässig sehr geringe Zahl von Grundbegriffen reduziert:
Ihrem Bedürfnis, Personen und ihr Verhalten zu charakterisieren entsprechend, erstellen Allport und Odbert 1936 den sogenannten Allport-Odbert-Katalog aus ca. 17000 Eigenschaftsbegriffen.[3] Vor Allem Allport war ein Vertreter der idiographischen Methode. Somit werden Dispositionen berücksichtigt, die ausschließlich für den Einzelfall Geltung haben. Eine konsequente Idiographie müsste für jeden Einzelfall eine Privatsprache entwerfen. Der Versuch, die Differenziertheit der idiographischen und die Effektivität der nomothetischen Methode pragmatisch zu verbinden, bleibt hier unerwähnt, weil die Ergebnisse der entsprechenden idiothetischen Methode noch zu unsicher sind.
Ausgehend von diesem Katalog bildet Cattell 1943 auf der Basis der nomothetischen Methode zunächst 35 Cluster, um diese dann unter Einbezug empirischer Ergebnisse auf zwölf Faktoren zu reduzieren. Von diesen zwölf Dimensionen zur Beschreibung fremdbeurteilten Verhaltens wird angenommen, dass sie die Unterschiede zwischen Individuen bei höchstmöglicher Ökonomie abzubilden erlauben. Sie dienen häufig als Grundlage nachfolgender Untersuchungen anderer Wissenschaftler. Für die Leistungsfähigkeit der Faktoren ist es unerheblich, woher die Daten stammen, aus denen sie abgeleitet werden. Gerade durch diese Allgemeingültigkeit bewährt sich das Verfahren.
Die eigentliche Methode der Faktorenanalyse im analytischen Sinne stammt von Ch. Spearman. Dieser entwickelt am Begriff der Intelligenz das Zwei-Faktoren-Modell.[4] 1904 bereits stellt er die These auf, dass jedes Maß für Intelligenz auf zwei Faktoren, nämlich dem Faktor „g“ und dem Faktor „s“, beruht. Der g-Faktor steht für eine Art grundsätzlicher bzw. genereller Intelligenz, ihm wird eine Beteiligung bei allen Intelligenzleistungen zugesprochen. „s“ hingegen repräsentiert die spezifische Intelligenz, welche für die jeweiligen Besonderheiten in speziellen Leistungen verantwortlich ist. Wenn man nun verschiedene Intelligenztests miteinander vergleicht und versucht, Klassen von Faktoren zu finden, die nicht untereinander korrelieren, so erhält man die s-Faktoren. Das Maß, in dem die Faktoren trotz ihrer Unabhängigkeit kovariieren bzw. miteinander korrelieren, definieren dann die „general intelligence“, den Faktor „g“. Je grösser der Anteil des g-Faktors ist, der sich im Intelligenzmaß eines Tests niederschlägt, desto höher kann man diesen in einer Hierarchie von Intelligenztests ansiedeln.
Eine der Herausforderungen für die weitere Forschung ist die Tatsache, dass innerhalb der s-Faktoren entgegen Spearmans Ziel immer noch Überlappungen zu finden sind. Nichtsdestotrotz stellt das Zwei-Faktoren-Modell die Grundlage vieler Testverfahren dar. Auch R.B. Cattell, der bei Spearman seinen Ph.D erwirbt, bedient sich dieser Methode. Die nachfolgenden Kapitel führen das aus.
3 Die Persönlichkeitstheorie von Cattell
„Persönlichkeit ist die Summe dessen, was das Verhalten einer Person in einer Situation vorherzusagen erlaubt.“
3.1 Struktur der Cattellschen Persönlichkeitstheorie
Um das begriffliche Konstrukt Persönlichkeit unter der Maßgabe wahrscheinlicher Prognosen zu erfassen, klassifiziert Cattell es zunächst in den folgenden Dimensionen:
A Ability (die Fähigkeit etwas zu tun, das gesteckte Ziel zu erreichen), T Temperament (Stil/ das Wie des Verhaltens), E Ergic drives (Triebhaftigkeit, dynamische Komponente von biologischer Verankerung wie Sexualität, Angst und Selbstbehauptung), M Sentiments (Haltung, Einstellung, ebenfalls motivationaler Art, aber im Unterschied zu den ergic drives mehr das Resultat von Lernprozessen, z.B. Politik oder Religion betreffend), R Role Traits (Rolle, Zugehörigkeit, weitere Kategorie dynamischer Merkmale, die aus der Zugehörigkeit einer Person zu bestimmte Gruppen der Gesellschaft, etwa der Familie oder einem Verein resultieren und schon daher das Verhalten determinieren) und S States (momentane Stimmung).[5] Diese Bereiche untergliedert Cattell dann wieder so, dass A, T und S für sich stehen und E, M und R eher Untergruppen des Bereichs Motivation und Dynamik bilden. Jedem dieser Bereiche ist eine Reihe von Beschreibungsdimensionen untergeordnet, um der Variabilität des Verhaltens gerecht zu werden.
Wie bereits erwähnt, knüpft Cattell bei der Entwicklung seines Systems an die Vorarbeiten von Allport und Odbert an, um schliesslich durch rationale Variablenreduktion auf seine zwölf Faktoren zu gelangen. Dabei erhalten die Ausprägungen eines Merkmals bipolare Bezeichnungen, z.B. Dominanz gegenüber Submissivität. Es handelt sich bei diesen Faktoren um Beschreibungen für Dispositionseigenschaften, die so genannten Traits. Sie werden aus dem Verhalten erschlossen, sind nicht direkt beobachtbar und drücken Erwartungen an das zukünftige Verhalten aus. „Traits sind relativ breite und stabile Dispositionen oder Verhaltensweisen, die konsistent in verschiedenen Situationen auftreten.“[6] In eben dieser Erstellung von Traits spiegeln sich einerseits Cattells Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit und andererseits der ökonomische Vorteil, die Entlastung der informationsverarbeitenden Systeme durch Zusammenfassung unterschiedlicher Verhaltensweisen in Kategorien, wider.
Seine zwölf Faktoren bezeichnet Cattell als Source-Traits. Im Gegensatz zu den so genannten Surface-Traits handelt es sich hierbei um fundamentale, grundsätzliche Einflüsse auf das Verhalten, welche kovariieren und die Ursachen der sich in den so genannten Surface-Traits manifestierenden interindividuellen Unterschiede sind. Nur über Letztere sind Verhaltensweisen konkret beobachtbar, insofern sie untereinander korrelieren. Und sie bilden die Grundlage für die Erschliessung der dispositionellen Source-Traits. Wie man hier schon erkennen kann, ist das Cattellsche Persönlichkeitsmodell ein hierarchisches, gewonnen wird die Hierarchie durch die Faktorenanalyse.
Eine große Leistung von Cattell als Forscher ist, dass er sich nicht mit Informationen aus nur einem Datenmedium zufrieden gibt und seine Schlüsse immer wieder erneut empirisch überprüfte. Eine Methode seiner Datenerhebungen ist der Fragebogen. Um also Persönlichkeit nach seiner Definition möglichst präzise erfassen zu können, erstellt er zunächst den 16 Personality Factors Inventory (16PF). Dieser enthält 16 Skalen, welche die Bandbreite zwischen den jeweiligen Polen einer Merkmalsausprägung abdecken und sich nur in den letzten vier mit Q1-4 gekennzeichneten Konstrukten von den ursprünglichen zwölf Ratingfaktoren unterscheiden. Sie lauten, ins Deutsche übersetzt, wie folgt:
A Sachorientierung vs. Kontaktorientierung
B Konkretes Denken vs. Abstraktes Denken
C Emotionale Störbarkeit vs. Emotionale Widerstandsfähigkeit
E Soziale Anpassung vs. Selbstbehauptung
F Besonnenheit vs. Begeisterungsfähigkeit
G Flexibilität vs. Pflichtbewusstsein
H Zurückhaltung vs. Selbstsicherheit
I Robustheit vs. Sensibilität
L Vertrauensbereitschaft vs. Skeptische Haltung
M Pragmatismus vs. Unkonventionalität
N Unbefangenheit vs. Überlegenheit
O Selbstvertrauen vs. Besorgtheit
Q1 Sicherheitsinteresse vs. Veränderungsbereitschaft
Q2 Gruppenverbundenheit vs. Eigenständigkeit
Q3 Spontanität vs. Selbstkontrolle
Q4 Innere Ruhe vs. Innere Gespanntheit
Es existieren unterschiedliche Formen des 16 PF für verschiedene Personengruppen. Die Formen A und B sind hauptsächlich für „Zeitung-lesende Erwachsene“ bestimmt und umfassen 187 Items. C und D beinhalten 105 Items, richten sich an „durchschnittliche Erwachsene“ und setzen geringere Anforderungen voraus. Die letzte Form, welche aber eine untergeordnete Rolle spielt, ist E, enthält 128 Fragen und wurde für „weniger gebildete Erwachsene“ erstellt.
Die individuellen Antworten werden in den 16 Skalen aufgezeichnet und aus der Positionierung der Antworten ergeben sich dann die Primärfaktoren. Da Einfachstruktur während der Entwicklung das höchste Gebot war, bestehen zwischen diesen Primärfaktoren auch Wechselbeziehungen. Nichtsdestotrotz konnte man von den 16 Primärfaktoren, den first statum source traits, fünf second stratum source traits extrahieren um diese auf die third stratum source traits zu reduzieren.
3.2 Verfahren der Cattellschen Persönlichkeitstheorie
Cattell benützt als Datenquellen für seine Variablen sowohl sogenannte L-, F- oder Q- als auch T-Daten. L-Daten sind Lebensprotokolldaten, also Beobachtungen zum Verhalten im alltäglichen Leben, F- oder Q-Daten sind Selbsteinschätzungen, welche meist im Fragebogenverfahren ermittelt werden, und T-Daten stehen für Fremdbeurteilungen, die in den sogenannten Objective Tests erhoben werden. Letztere sind schwer zu fälschen, da der Proband möglichst nicht in der Lage ist, die Absichten der Fragen bzw. Fragenstellung zu durchschauen. Außerdem eignen sie sich gut zur Trennung zwischen Kontrollgruppen und beispielsweise Alkoholikern oder Schizophrenen.
Cattell ist zu seiner Zeit einer der wenigen, der versucht, seine Daten aus möglichst vielen unterschiedlichen Quellen zu beziehen. Das zeigt sich auch in seiner Spezifikationsgleichung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit den Definitionen
V= Verhalten
A= ability source traits
T= temperament source traits
E= ergic source traits
M= sentiment source traits
R= Role traits
S= States
Six= Gewichtung je nach Situation
Cattell ist auch derjenige, der die Variations- und Korrelationsforschung sowie Psychographie und Komparationsforschung von William Stern, bei der es um Beziehungen zwischen Individuen und unterschiedlichen Merkmalen geht, um eine dritte Dimension, nämlich der der zeitlichen bzw. situativen Bedingungen erweitert. Dies ist eine äußerst wichtige Komponente, da sich das Verhalten von Personen ja nicht nur über verschiedene Variablen hinweg verändert, sondern auch situationsspezifischen Einflüssen und momentanen Stimmungen unterliegt. So kann beispielsweise einem Individuum dieselbe Aufgabe heute schwer fallen und morgen leicht von der Hand gehen.
Mit der zeitlichen bzw. situativen Dimension entsteht ein Datenquader, der von Cattell mit Buchstaben versehen wird, welche die verschiedenen Korrelationstechniken wie folgt unterscheiden:
R-Technik: Vergleich unterschiedlicher Merkmale über mehrere Personen
Q-Technik: Vergleich von Personen über mehrere Merkmale
O-Technik: Vergleich von Situationen über Merkmale
P-Technik: Vergleich von Merkmalen einer Person über eine Reihe von Situationen
S-Technik. Vergleich von Personen in einem Merkmal über verschiedene Situationen
T-Technik: Vergleich von Situationen hinsichtlich eines Merkmals über verschiedene Personen.
Wie schon erwähnt, fühlt sich Cattell dem nomothetischen Ansatz verpflichtet, und wie ebenfalls erwähnt nutz er sowohl die rationale als auch die analytische Form der Trait-Findung.
4 Intelligenz
Der Ursprung von Cattells hierarchischem Intelligenzmodell liegt vermutlich in seiner Zusammenarbeit mit Spearman während der Entwicklung von dessen Zwei-Faktoren-Theorie. Denn genau wie Spearman nimmt Cattell einen g-faktor an. Diesen teilt er jedoch in mehrere unterschiedliche auf, wobei das Hauptaugenmerk hier auf den beiden ersten liegt:
- Dem General Fluid Ability Faktor (gf) oder fluid intelligence
- Dem General Crystallized Ability Faktor (gc) oder crystallized intelligence
Die „flüssige Intelligenz“ (gf) ist eine weitgehend angeborene, allgemeine Leistungsfähigkeit und kommt ungefähr mit dem 14. oder 15. Lebensjahr zum Entwicklungsstillstand. Sie spiegelt die Fähigkeit wider, sich in neuen Situationen zurechtzufinden und neue Probleme zu bewältigen, ohne dass es dafür umfangreicher früherer Lernerfahrung bedarf. Die Ladungen von gf und gc streuen über viele der Primärskalen. „Nach der von Horn (1968) zusammengestellten Übersicht mehrerer Sekundäranalysen ist die ‚fluid intelligence’ vor allem durch ‚Figural Relations’, ‚Memory Span’ und ‚Induction’ gekennzeichnet.“[7] Gf ist also relativ kulturfrei erfassbar, d.h., das dabei verwendete Material ist Mitgliedern unterschiedlicher Gesellschaften und Kulturen gleich gut bekannt (z.B. bildhafte Darstellungen, einfache Symbole). Und sie ist in höherem Maße an intakte neuronale Strukturen und Prozesse gebunden.
„Die kristallisierte Intelligenz (gc) ist gewissermaßen das Endprodukt dessen, was flüssige Intelligenz und Schulbesuch gemeinsam hervorgebracht haben“ (Cattell, 1973). Sie beendet ihre Entwicklung ungefähr zwischen dem 18. und dem 20. Lebensjahr, wobei das von den jeweiligen Lern- und Erziehungseinflüssen abhängt und sich bei besonders Begabten auch bis ins 50. Lebensjahr erstrecken kann. Sie zeichnet sich durch die vom Individuum rezipierten und organisierten Wissensinhalte und –systeme aus, welche für die Gesellschaft und Kultur charakteristisch sind, in der das Individuum lebt. Im Gegensatz zu gf erfasst man gc deshalb am besten mit kulturspezifischen Faktoren.
Darüber hinaus gibt es mehrere Primärfaktoren die auf beiden g-Faktoren laden. Durch diese Korrelation von gf und gc kann man auf einen noch allgemeineren Faktor schliessen, der Spearmans g-Faktor entspricht: der Faktor gf(h). Für diesen fordert Cattell jedoch höhere Ladungen von gf, weil die flüssige Intelligenz in den früheren Lebensjahren von grösserer Bedeutung ist.
Er ist auch der Überzeugung, dass genetische Einflüsse bei der flüssigen Intelligenz stärker sind; so wie er glaubt, dass gf gc stärker beeinflusst als umgekehrt. Allerdings gibt es für diese Theorien keine ausreichenden Belege. Auch sind bisher Hypothesen über differenzierte Umwelteinflüsse ungenügend überprüft, und es gibt keine Studien zu Auswirkungen von Schädigungen des Gehirns während unterschiedlicher Lebensabschnitte. Intelligenztestverfahren wie der CFT wurden auf der Grundlage dieses Modells konstruiert.
5 Fazit
In R.B. Cattells Definition von Persönlichkeit schlägt sich bereits ein soziales Nützlichkeitsdenken nieder, das der sozialen Rolle der Differentiellen Psychologie entspricht. Schließlich verspricht ein hohes Maß an Prognostizierbarkeit menschlichen Verhaltens eine effektive Steuerung sozialer Risiken und Chancen.
Obwohl viele von Cattells Studien heute teils durch ihn selbst widerlegt sind oder zumindest mangelnde Validität aufweisen, ist er immer noch eine Schlüsselfigur für das Verständnis der Persönlichkeits- und Intelligenzforschung. Vor allem aus zwei Gründen: Zum einen bearbeitet er als theoriesprachliche Konstrukte sozial sensible Begriffe, deren wissenschaftliche Operationalisierbarkeit starke Effekte auf gesellschaftliche Hierarchien hat. Zum anderen führt er die zeitliche bzw. situative Dimension in den methodischen Zugang der Differentiellen Psychologie ein. Dadurch werden intrasubjektive Vergleiche von Verhaltensweisen erst möglich, Fehlerquellen in intersubjektiven Vergleichen lassen sich reduzieren.
6 Literatur
- Amelang, Manfred/ Bartussek, Dieter: „Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung“ Stuttgart, Berlin, Köln; 2001
- Revenstorf, Dirk: „Persönlichkeit“ München; 1982
Differentielle- und Persönlichkeitspsychologie
Raymond Bernard
Cattell
Prof. Dr. phil. H. Häcker
Tina Klügel, 9934063
[...]
[1] siehe Effektivierung der Eignungstests im ersten Weltkrieg (Amelang, Martin/ Bartussek, Dieter: Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung; 2001, S. 27)
[2] Amelang/ Bartussek, 2001
[3] vgl. Amelang/ Bartussek, 2001, S. 315
[4] vgl. Amelang/ Bartussek, 2001, S. 204
[5] Amelang/ Bartussek, 2001, S.315
[6] Amelang/ Bartussek, 2001, S.49
Häufig gestellte Fragen zu "Differentielle- und Persönlichkeitspsychologie: Raymond Bernard Cattell"
Was ist der Allport-Odbert-Katalog?
Der Allport-Odbert-Katalog ist eine Sammlung von ca. 17000 Eigenschaftsbegriffen, die 1936 von Allport und Odbert erstellt wurde. Er diente als Ausgangspunkt für Cattells Forschung zur Reduzierung der Anzahl an Persönlichkeitsmerkmalen.
Was ist die Faktorenanalyse und wie hat Cattell sie angewendet?
Die Faktorenanalyse ist eine statistische Methode zur Reduzierung der Anzahl an Variablen durch Identifizierung von zugrunde liegenden Faktoren. Cattell nutzte die Faktorenanalyse, um aus einer großen Anzahl von Eigenschaftsbegriffen eine überschaubare Anzahl von grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen (Source-Traits) zu extrahieren.
Was sind Source-Traits und Surface-Traits?
Source-Traits sind fundamentale, grundsätzliche Einflüsse auf das Verhalten, die kovariieren und die Ursachen interindividueller Unterschiede sind. Surface-Traits sind beobachtbare Verhaltensweisen, die untereinander korrelieren und die Grundlage für die Erschliessung der dispositionellen Source-Traits bilden.
Was ist der 16 Personality Factors Inventory (16PF)?
Der 16PF ist ein von Cattell entwickelter Fragebogen zur Messung von 16 grundlegenden Persönlichkeitsfaktoren (Primärfaktoren). Es existieren verschiedene Formen des 16PF für verschiedene Personengruppen.
Welche Datenquellen verwendete Cattell für seine Persönlichkeitsforschung?
Cattell verwendete L-Daten (Lebensprotokolldaten), F- oder Q-Daten (Selbsteinschätzungen) und T-Daten (Fremdbeurteilungen) als Datenquellen für seine Persönlichkeitsforschung.
Was ist die Spezifikationsgleichung von Cattell?
Die Spezifikationsgleichung ist ein Modell von Cattell, das versucht, das Verhalten einer Person in einer bestimmten Situation vorherzusagen, basierend auf verschiedenen Persönlichkeitsfaktoren und deren Gewichtung in dieser Situation.
Was sind die R-, Q-, O-, P-, S- und T-Techniken von Cattell?
Dies sind verschiedene Korrelationstechniken, die Cattell zur Analyse von Daten verwendete, um Beziehungen zwischen Merkmalen, Personen und Situationen zu untersuchen. Sie unterscheiden sich darin, welche Variablen (Merkmale, Personen, Situationen) verglichen werden.
Was sind "flüssige Intelligenz" (gf) und "kristallisierte Intelligenz" (gc)?
Dies sind zwei Hauptfaktoren der Intelligenz in Cattells hierarchischem Intelligenzmodell. Flüssige Intelligenz (gf) ist eine angeborene Fähigkeit, sich in neuen Situationen zurechtzufinden, während kristallisierte Intelligenz (gc) das Ergebnis von Lernerfahrungen und Wissen ist.
Wie unterscheidet sich Cattells Intelligenzmodell von Spearmans Zwei-Faktoren-Theorie?
Cattell übernimmt Spearmans g-Faktor, teilt ihn aber in mehrere unterschiedliche Faktoren auf, wobei das Hauptaugenmerk auf den Faktoren flüssige und kristallisierte Intelligenz liegt. Spearmans Modell unterscheidet zwischen einem generellen Intelligenzfaktor (g) und spezifischen Intelligenzfaktoren (s).
Welche Bedeutung hat Cattells Arbeit für die Differentielle Psychologie?
Obwohl viele von Cattells Studien heute teils widerlegt sind oder zumindest mangelnde Validität aufweisen, ist er immer noch eine Schlüsselfigur für das Verständnis der Persönlichkeits- und Intelligenzforschung. Vor allem wegen seiner Erarbeitung von theoriesprachlichen Konstrukten und seiner Einführung der zeitlichen bzw. situativen Dimension in den methodischen Zugang der Differentiellen Psychologie.
- Citar trabajo
- Tina Klügel (Autor), 2004, Die Faktorenanalyse von Raymond Bernard Cattell und ihre Effekte auf seine Persönlichkeitstheorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109134