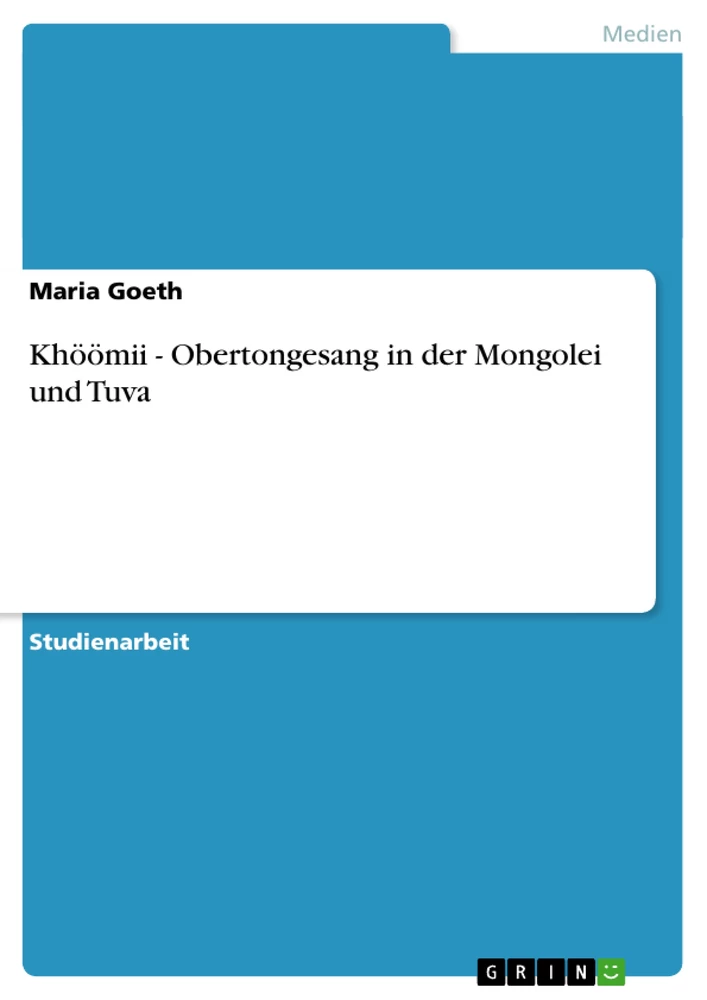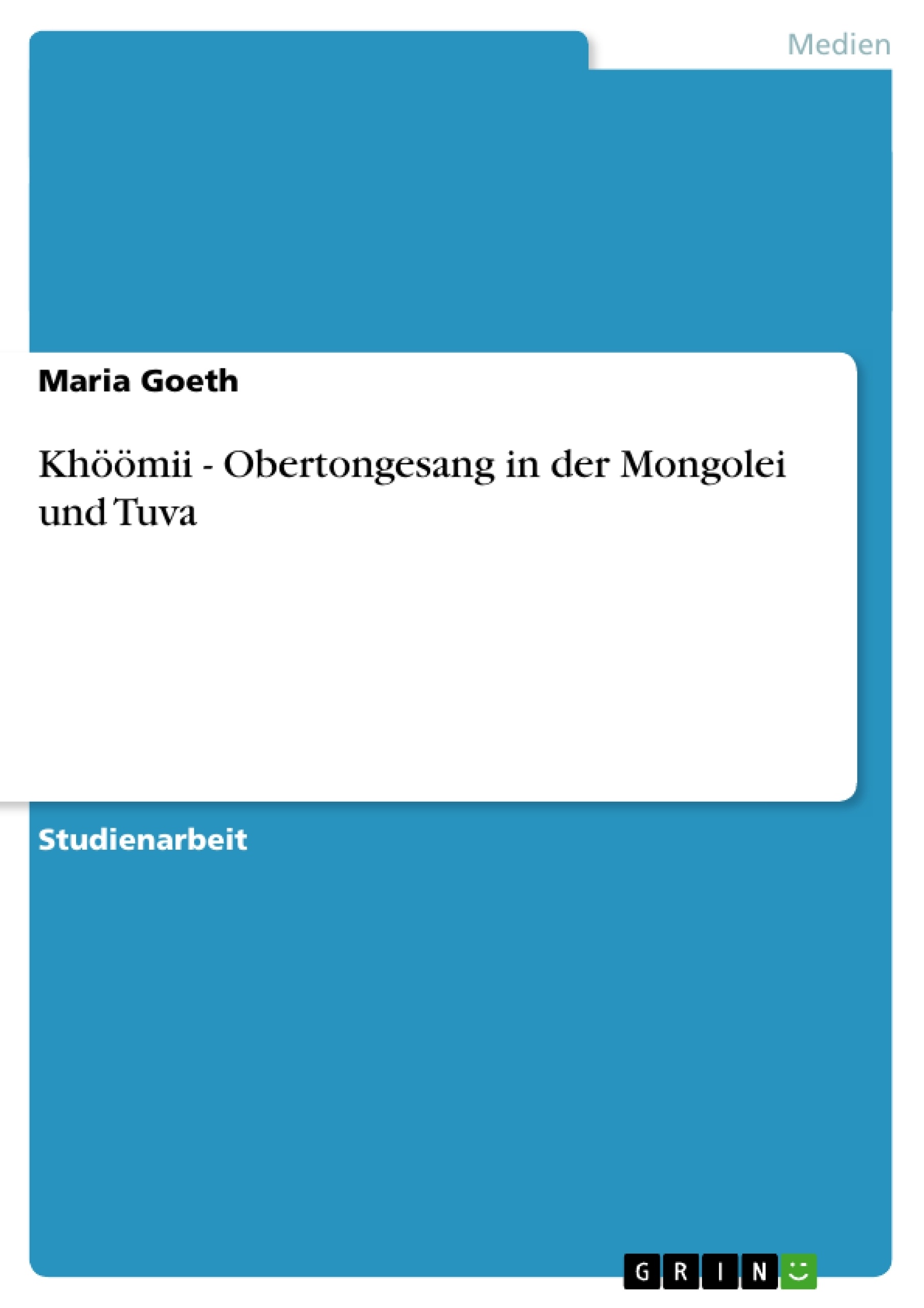Index
I. Einleitung
II. Analyse
1. Definition und Terminologie
2. Ursprung und Verbreitung
3. Klangerzeugung und Lehre
4. Arten des Kehlgesangs in Tuva
4.1 Kargiraa
4.2 Khomei und Borbannadir
4.3 Sygyt und Ezengileer
5. Arten des Kehlgesangs in der Mongolei
6. Melodiebildung, Skalen und Charakteristika mongolischer Musik
III. Schlussbemerkungen
IV. Literaturverzeichnis
J’ay veu, comme il semble
Ung fort homme d’honneur
Luy seul chanter ensemble
Et dessus et teneur.[1]
Französisches Gedicht, 16. Jahrhundert
I. Einleitung
Irgendwo in den Weiten einer kargen Steppe vor einer einsamen Jurte erhebt ein einzelner Mann seine Stimme zum Gesang. Ein heller, strahlend klarer Ton erklingt wie aus dem Nichts zu dem murmelnden Brummen seines fulminanten Basses.
Nicht Magie sondern Khöömii, der Obertongesang Tuvas und der Mongolei, ist es, was hier vor sich geht, eine Gesangstechnik, die sich das Phänomen der Formantenbildung zu Nutze macht und im Vergleich zu westlichen Praktiken kehllastiger ist.
In dieser Arbeit sollen Ursprung, Klangerzeugung, Arten und Melodiebildung dieses zentralasiatischen Obertongesangs untersucht werden.
Schwierigkeiten waren bei der Recherche einerseits das mangelnde Schrifttum der Nomadenvölker, das einen Rückgriff auf alte Quellen fast unmöglich macht, andererseits die Tatsache, dass Obertongesang erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts, besonders seit dem aufsehenerregenden Artikel des russischen Komponisten Aksenov 1964[2], intensiver beforscht wird und die Quellenlage somit lückenhaft ist, beziehungsweise neuere Forschungsergebnisse zum Großteil noch nicht in Druck sind. Auch die Menge unübersetzter russischer Literatur stellte ein Hindernis dar, sowie der Umstand bezüglich der Erforschung physiologischer Vorgänge, dass die Lehrmethodik in Tuva und der Mongolei wenig mit technischen Erklärungen, sondern mit Imitation und Bildhaftigkeit arbeitet.
II. Analyse
1. Definition und Terminologie
„Beim zweistimmigen Gesang, dem bitonalen Singen, wird bei gepresster Stimmgebung ein möglichst tiefer und damit teiltonreicher primärer Stimmschall im Kehlkopf erzeugt (Pedal-Ton). Danach folgt eine selektive Verstärkung einzelner Obertöne durch Resonanz in der Mundhöhle, deren Volumen variiert wird (Kantilene-Melodie).“[3]
„One note provides the fundamental and the other is a harmonic resulting from a modification of the mouth cavity without moving the lips, which stay half-open. The upper partial varies according to the mouth formation of either a back vowel (a, o, u), which gives a low partial or a front vowel (e, ö, ü), which gives a high partial. The cheek and tongue muscles are taut.“ [4]
So und ähnlich lauten die lexikalischen Definitionen von Obertongesang. Wir haben es hier also mit einer Gesangskunst zu tun, deren Charakteristikum die Zweistimmigkeit im Gesang eines einzelnen Sängers ist und welche auf dem Prinzip der Verstärkung einzelner Stimmformanten durch Veränderung der Mundstellung, der Zungenposition, des Gaumensegels und des Kehldeckels beruht. Zusätzlich werden bei manchen Techniken Hals- und Bauchmuskeln kontrahiert oder ausgedehnt.
Im Deutschen werden neben Obertongesang auch die Bezeichnungen Formantsingen, bitonales Singen, diaphonischer Gesang, Zweilautgesang, Maultrommelgesang und zweistimmiger Sologesang gebraucht. Allerdings herrscht hier keine definitorische Einheitlichkeit, so benutzen manche Autoren genannte Termini teils als Überbegriff, teils als Bezeichnung für spezifische Techniken.
Eine wichtige Abgrenzung ist nun zwischen dem westlichen und dem im Folgenden zu untersuchenden östlichen Obertongesang zu treffen. Wobei auch darauf aufmerksam zu machen ist, dass eine klare Stiltrennung in unseren Zeiten kultureller Durchmischung zunehmend weniger durchführbar ist.
Die östlichen Techniken verwenden die Kehlstellung als zusätzliches Element, verallgemeinert gesprochen werden hierbei Spannungen in den verschiedenen Kehlöffnungen, insbesondere um die Stimmbänder herum, erzeugt. Ein besonderes Phänomen ist dabei der sogenannte aryepiglottische Sphinkter, der im 3. Kapitel „Klangerzeugung und Lehre“ näher untersucht werden soll.
Die asiatischen Begriffe für diese Form des Obertongesangs sind zahlreich: Khoomi, Khomei, Khommei, Khöömii, Khöömej, Kögemej, Chöömij, Chöömej, Choomii, Höömij, Homi, Hö-mi, Xöömij, Xomej und viele mehr. Im weitesten Sinne lassen sich alle vom tuvinischen Wort Khoomei ableiten, was „Rachen“ oder „Kehle“ bedeutet. In dieser Arbeit wird deshalb bevorzugt der Begriff Kehlgesang verwendet.
Auch bei den asiatischen Bezeichnungen ist allerdings darauf zu achten, dass sie als Überbegriffe ebenso wie als einzelne Stiltermini in den Quellen erscheinen. So bezeichnet etwa Khomei auch eine der drei Hauptstilrichtungen der tuvinischen Techniken.
2. Ursprung und Verbreitung
Über den tatsächlichen Ursprung des Kehlgesangs kann nur gemutmaßt werden. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Wurzeln dieser eigentümlichen Gesangstechnik bei den Türkvölkern in Zentralasien liegen, insbesondere in der Altai-Region, der heutigen Republik Tuva und der Mongolei. So ist Kehlgesang noch heute unter Mongolen, Oiraten, Uyguren, Kakassen, Kalmücken, Tuvinern und Bashkiren verbreitet.
In den Quellen herrscht ein großer Konsens darüber, dass der Kehlgesang seine Inspiration in obertonreichen Naturgeräuschen fand, so seien Tierlaute wie Wolfsgeheul und Pferdegewieher imitiert worden, das Pfeifen der Winde, das Echo der Berge oder das Rauschen der Flüsse. Umgedreht werden Lieder bis heute eingesetzt, um ihrerseits auf die Tiere Einfluss zu nehmen. So wird etwa in der Westmongolei Kehlgesang zum Anlocken von Yaks verwendet. Andernorts existieren Stücke, die Kühe zum Kalben oder Stuten zum Säugen bringen sollen.
Auch als Wiegenlieder werden Obertonstücke gesungen; hierbei wird oftmals eine Tasse vor den Mund gehalten.
Die extremen Temperaturschwankungen und sonstigen Witterungsbedingungen in den besagten Regionen macht die Hypothese der Entstehung des naturimitierenden Kehlgesangs durch die zwangsweise Naturnähe dieser Völker durchaus plausibel.
Die Entwicklung einer ausgeprägten Gesangskultur in Staaten mit Nomadentum ist ebenfalls schlüssig. Denn eine Instrumentalkultur konnte sich wegen den Schwierigkeiten des Transportes kaum ergeben. Noch heute ist die Mongolei mit 1,6 Einwohnern pro Quadratkilometer[5] eines der dünnbesiedeltsten Länder der Erde. Oft waren und sind deshalb tagelange Märsche notwendig. Professionelle wie halbprofessionelle Rhapsoden reisten umher, sangen bei diesen Steppenwanderungen, bei Gelagen, Volksfesten, in Kriegslagern und Fürstenjurten. Da sich auch die Schriftkultur im Nomadentum nicht entwickelte – noch heute liegt die Analphabetenrate in der Mongolei bei 38,5%[6] – waren diese Rhapsoden auch wichtige Träger und Bewahrer der Tradition.
1240 finden die Gesänge, insbesondere epische Heldengesänge, Hochzeits-, Lob- und Klagelieder in der inoffiziellen Chronik „Geheime Geschichte der Mongolen“[7] erstmals Erwähnung, jedoch ohne explizite Nennung des Kehlgesangs. Auch die Reiseberichte Pian del Carpinis, Wilhelm von Rubrucks und Marco Polos lassen ihn unerwähnt, berichten über schamanische und epische Gesänge, sowie musikalische Gepflogenheiten bei Trinkgelagen, Tänzen, Thronbesteigungen und Empfängen, sowie über die Gesangsfreudigkeit der Mongolen im Allgemeinen.
Erst in der Übersetzung eines chinesischen Dokuments aus dem 16. Jahrhundert von Henri Serruy wird von „ vielen Klängen aus der Kehle und den Lippen “[8] gesprochen. Dies kann als früheste Erwähnung des asiatischen Obertongesangs betrachtet werden.
Umstritten ist die Frage, inwieweit religiöse Aspekte in der Entwicklung des Kehlgesangs eine Rolle spielten. Betonen manche Quellen die enge Verbindung pastoraler tuvinischer und mongolischer Musik zum Animismus und seiner Ritualisierung im Schamanismus, die sie daraus ableiten, dass hier jedem Naturphänomen eine Seele oder ein Geist zugeschrieben wird[9], so ordnen andere sie eindeutig der Alltagsästhetik zu[10]. Letztere Ansicht lässt sich dadurch untermauern, dass bei einem religiösen Hintergrund der Gesang dem Schamanen vorbehalten wäre, da die Klänge angeblich heilende Wirkung haben.
Abbildung 1 zeigt die Gebiete, in denen heute verstärkt Kehlgesang gepflegt wird, vor allem also in der Westmongolei und in den Republiken Altai und Tuva.
Obertongesang prägte sich auch in anderen Kulturen als der südsibirischen und mongolischen heraus. So beispielsweise bei den Frauen der Tembu Xhosa in Südafrika, in Bulgarien, bei den Shomyo Buddhisten in Japan, auf Korsika und in den Gesängen tibetischer Mönche, die die Obertöne jedoch nicht bewusst steuern.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Hauptverbreitungsgebiet des Khöömi.[11]
3. Klangerzeugung und Lehre
Beim Singen wird nicht ein einzelner Ton erzeugt – denn unter Ton im engeren Sinne versteht man ausschließlich eine reine Sinusschwingung – sondern ein vielschichtiger Klang, der sich aus ungefähr 50 Einzeltönen[12] rekrutiert. Das grundlegende Prinzip des Obertongesanges ist vergleichbar mit der Verwendung eines Prismas vor weißem Licht: es werden bestimmte Farbtöne aus dem alle Farben enthaltenden Strahl gefiltert. Beim Obertonsingen werden also durch verschiedene Techniken einzelne Töne aus dem Gesamtgesangsklang hervorgehoben, die tatsächlich auch bei allen anderen Arten von Gesang mitklingen, dort jedoch nicht oder kaum hörbar sind.
Ein Instrument, dessen Klang auch auf dem Phänomen der Obertöne beruht, ist die Maultrommel, die im ostasiatischen Raum ebenfalls weit verbreitet ist. Auch hier werden die Mundhöhle, andere Kopfhöhlen und der Kehlkopf als Resonatoren eingesetzt und eine Veränderung der Zungen-, Wangen-, Kehlkopf- und Mundstellung bewirkt das Erklingen der Obertöne[13]. Im Unterschied zum Obertongesang ist die Maultrommel aber tonal wesentlich eingeschränkter, da sie auf nur einem einzigen Grundton basiert.
Der Unterschied zweier auf einer Tonhöhe gesungenen Vokale ergibt sich lediglich aus deren spezifischer Obertonstruktur. Daraus lässt sich ableiten, dass die Vokale über charakteristische Formanten verfügen, die unabhängig von der jeweils gesprochenen oder gesungenen Tonhöhe immer um die gleiche Frequenz angesiedelt sind. Abbildungen 2 und 3 zeigen die Frequenzbereiche der Vokale i, a und u schematisch auf, sowie deren charakteristische Mund- und Rachenstellung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Vokalformanten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3
Nach dieser Betrachtung liegt nahe, dass einige Obertongesangstechniken sich stark an der Vokalbildung orientieren. Sie basieren darauf, die ohnehin schon ausgeprägten Formanten weiter zu verstärken. Unter den tuvinischen Stilen sind dies insbesondere Khomei und Kargiraa, die im folgenden Kapitel ausführlicher erläutert werden sollen.
Da Kehlgesang traditionell durch Imitation des Lehrers und nicht funktional gelehrt und gelernt wird, existiert keine einheitliche Technik. Jeder Weg, der zum erwünschten Klangziel führt, ist akzeptiert.
Grundsätzlich lassen sich die Einhöhlentechniken von den Zweihöhlentechniken unterscheiden. Hierbei handelt es sich um eine Klassifizierung danach, inwieweit die Zunge den Mundraum in zwei Resonanzräume unterteilt, indem man sie etwa wie bei der Aussprache des Buchstaben „l“ zum Gaumen führt, oder man sie am Mundboden belässt und so einen einzelnen größeren Resonanzraum erhält. Ersteres lässt schärfere, deutlichere Obertöne zu, wie man den Sonagrammen in Abbildung 4 entnehmen kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Ein- und Zweihöhlentechnik im Vergleich.[14]
Die prominentesten Lernhilfen für die Zweihöhlentechnik sind die Bird- und die L- Technik. Bei ersterer berührt die hintere Zunge den weichen Gaumen und die Zungenränder liegen an den Innenseiten der oberen Backenzähne wie bei der Aussprache des englischen Wortes „bird“, wobei das „d“ allerdings vernachlässigbar ist und so ein kehliges „bö“ entsteht. Nun wird der Vokalkreis „u – o – ou – a – ae – e – i“ abgesungen, wobei die Zunge sich etwas nach vorne schiebt und die Zungenspitze spannt. Auch die Lippenöffnung wird vokalgemäß minimalst verändert. Mit etwas Übung entsteht so bereits eine klare, aufsteigende Obertonreihe.
In ähnlicher Weise funktioniert die L-Technik, wobei hier die Zunge in die gleiche Position gebracht wird wie beim Sprechen des Konsonanten „l“. Die Zungenspitze befindet sich demnach an der Gaumenkante circa einen Zentimeter über der Zahnkante und verändert ihre Stellung nicht. Die Obertöne werden durch leichtes Heben und Senken des hinteren Zungenteils und Veränderung des Mundresonanzraumes hervorgerufen. Der Grundklang ist hier kräftig und kehlig zu singen und möglichst wenig Luft über die Nase zu verströmen.[15]
Bereits in Kapitel 1 „Definition und Terminologie“ wurde darauf hingewiesen, dass der wesentliche Unterschied zwischen dem westlichen und östlichen Obertongesang im sogenannten aryepiglottischen Sphinkter besteht. Bei Sven Grawunder findet sich die medizinische Erläuterung dieses Phänomens:
„Der Aditus laryngis verschließt sich derart, dass die Aryknorpel bzw. deren obere Enden, die Tuberculi corniculati nebst Tuberculi cuneiformi, über die sich verdickenden aryepiglottischen Falten nach ventral an das Tuberculum epiglotticum anlegen. An der Interarytaenoidea verbleibt eine kleine Öffnung, durch die hindurch ‚phoniert’ wird. Während sich die Spitzen der Aryknorpel annähern, bewegen sich auch die vestibulären Falten aufeinander zu. Der Verschluss ist also nicht vollständig.“[16]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Laryngoskopien[17]
Aus Abbildung 5 wird deutlich, dass der aryepiglottische Sphinkter eine starke Ähnlichkeit zu der laryngealen Struktur nach Auslösung des Würgereflexes hat. So lässt sich also vereinfacht aussagen, dass beim Kehlgesang in der Mongolei und in Tuva eine Kehlkopfspannung erzeugt wird, welche ansatzweise dem Würgen entspricht. Je stärker der Kehlkopf auf diese Weise verengt wird, desto deutlicher trennt sich beim Gesang der Oberton vom Fundamentton.
4. Arten des Kehlgesangs in Tuva und der Mongolei
In Tuva lassen sich deutlicher Stilrichtungen des Kehlgesangs voneinander abgrenzen als in der Mongolei, die eine Vielzahl von Ethnien und deren individuellen Stilen beheimatet. Im Wesentlichen existieren die drei Arten Kargiraa, Khomei und Sigit. Oftmals werden auch die Stile Borbannadir und Ezengileer separat genannt, jedoch lässt sich ersterer als Unterform des Khomei und letzterer als Unterform des Sigit betrachten.
4.1 Kargiraa
Kargiraa ist eine sehr vokalnahe Variante des Kehlgesangs. Der tuvinische Begriff Kargiraa oder Kargyraa bedeutet „röcheln“, „heiser sein“, „expektorieren“.
Das hervorstechendste Merkmal des Kargiraa ist die extreme Tiefe des Fundamenttons, der etwa eine Oktave unter der normalen Basslage in der Kontraoktave zwischen H1 und E1[18] oder den ersten vier Tönen der großen Oktave[19] liegt. Dieser wird als Ostinatoton gehalten, lediglich beim achten Oberton ist ein Wechsel des Fundamenttons um eine kleine Terz nach unten möglich. Während eines Atems wird der Fundamentton nicht unterbrochen. Die Zunge wird flach am Mundboden gehalten, der Kargiraa gehört also zu den Ein-Höhlen-Techniken. Das Kinn hängt leicht und die Mundhöhle wird durch Absenkung des Kiefers vergrößert.
Der klare, bambusflötenartige Oberton bewegt sich in der hohen ersten und niedrigen zweiten Oktave. Jeder Oberton steht in direkter Verknüpfung mit einem Vokal.
Zum Repertoire zählen speziell verzierte, langatmige Melodien, die nicht als Lieder aufgeführt werden.
4.2 Khomei und Borbannadir
Auch Khomei ist eine recht vokalnahe Technik und wird von den Tuvinern als ursprünglichste alle Kehlgesangsarten angesehen, weshalb ihr Name, der wie schon erwähnt „Kehle“ oder „Rachen“ bedeutet, auch zum Überbegriff für alle Typen geworden ist.
Wie beim Kargiraa wird auch hier der Basiston als Pedalton ausgehalten, jedoch ist er wesentlich höher, nämlich in der Regel einer der drei Mitteltöne der großen Oktave.
Die Lippen bleiben beim Khomei fast geschlossen wie etwa bei einem stimmhaften „v“, die Zunge wird weitgehend am Mundboden gehalten, womit es sich um eine Ein-Höhlen-Technik handeln würde. Jedoch wird die Zungenspitze dazu eingesetzt die Obertonmelodie mitzuformen, indem sie leicht angehoben wird, also kann man auch von einer Zwei-Höhlen-Technik sprechen.
Der Basiston ist hier weicher und leiser als beim Kargiraa, auch die Obertöne sind weich, resonant und celloartig. Letztere bewegen sich innerhalb der ganzen zweiten und tiefen dritten Oktave.
Der Fundamentton kann wie beim Kargiraa durchgehalten werden, es sind aber auch Unterbrechungen durch Explosivlaute wie x, b, m und mn möglich.
In manchen Regionen wird die Bezeichnung Borbannadir synonym mit Khomei verwendet und hiermit auch repertoirebezogen eine spezielle melodische Rezitation von Liedtexten, die mit mehreren Teilen im Kargiraa - Stil beginnt.
Jedoch bezeichnet Borbannadir auch eine speziell ornamentierte Form des Khomei, bei der schnelle Triller um eine zentrale Note geführt werden[20].
4.3 Sygyt und Ezengileer
Sygyt oder Sigit ist der weitverbreitetste Stil der tuvinischen Formen des Kehlgesangs. Sygyt steht tuvinisch für „pfeifen“, womit bereits das markanteste Charakteristikum dieses Typus genannt ist: der Oberton tritt klar, brillant, fast schrill und pfeiftonartig hervor, während der Basiston oft fast bis zur Unhörbarkeit gedämpft wird. Der Mund ist dabei halb geöffnet, die Zungenspitze berührt die obere Zahnreihe und wird kaum bewegt, etwa wie in der oben beschriebenen L- Technik. Die Obertonmelodie wird durch Heben und Senken der Zungenwurzel und Zungenmitte geformt.
Während Aksenov davon spricht, dass der Basiston, der sich beim Sygyt in der Mitte der kleinen Oktave befindet, nicht konstant bleibt, sondern eine eigenständige, mobile Melodie bildet[21], betont Grawunder, dass ein Wechsel der Grundtöne auch hier nicht möglich sei und als „Zeichen von Dilettantismus“[22] gelte, was auch durch die für diese Arbeit herangezogenen Tonbeispiele untermauert wird[23]. Der Widerspruch lässt sich damit erklären, dass Sygyt normalerweise in Lieder eingebettet auftritt. Das heißt, dass zunächst ausschließlich mit tiefer Stimme eine Textzeile deklamiert wird, über deren ausgehaltene Endnote eine ornamentale Sygyt - Obertonmelodie gelegt wird.
Abbildung 6 stellt die drei Stile nochmals schematisch mit ihren charakteristischen Eigenschaften dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Die drei Haupttechniken des tuvinischen Obertongesangs.[24]
5. Arten des Kehlgesangs in der Mongolei
Im Gegensatz zu den tuvinischen Kehlgesangsstilen sind die mongolischen nicht klar voneinander differenzierbar. Eine Vielzahl von versuchten Abgrenzungen und Terminologien ist die Folge. Eines jedoch ist den meisten Systematisierungen gemeinsam: sie differenzieren danach, welcher Körperbereich hauptsächlich zur Klang- beziehungsweise Obertonerzeugung dient. So spricht Carole Pegg[25] beispielsweise von sieben Stilen: dem labialen, dem palatalen, dem nasalen, dem glottalen, dem Magen- Khöömi, dem Türlegt, der eine Art Mischform ist, und dem nicht melodieorientierten Khöömi. In Abbildung 7 sind diese Stile schematisch dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Mongolische Obertongesangsstile nach Carole Pegg.[26]
Als weitere Möglichkeit der Differenzierung gibt sie vier Stile an: nasalen (hamryn) und pfeifenden (isgeree) Khöömi, karkiraa und Khöömi mit Druck (shahaltai). Jeder dieser Techniken exisitiere mit und ohne Glottesschluss (tsohilt).
Ähnlich systematisiert Hosoo[27]. Er spricht von pfeifartigem Höömij (isgeree), brummendem und krächzendem Höömij (charchiraa) und komprimierendem Höömij (schachaa). Ersten unterteilt er in die Techniken Rachen- Höömij (chooloin), Brustkorb- Höömij (zeedshnij), Nasen- Höömij (chamrijn) und gedesnij davchar zochilttoi-Höömij, welcher mit der Bauchmuskulatur arbeitet.
Als letzter Systematisierungsversuch sei derjenige des mongolischen „Ensemble Temuzhin“[28] genannt: Nasen- Höömij (khamriin), Rachen- Höömij (tövönkhiin), Nacken- Höömij (bagalzuuriin) und kharkhiraa als Lungen- Höömij.
Auch akustisch ist es nicht einfach, diese Techniken voneinander zu unterscheiden. Generell arbeitet Brust Khöömi mit einem helleren, höheren Grundton, bei Rachen Khöömi ist dieser rauer und in Mittellage. Charchira Khöömi ist ungefähr eine Oktave tiefer als Rachen Khöömi und erfordert eine spezielle Atemtechnik[29]. Er entspricht dem tuvinischen Kargiraa.
6. Melodiebildung, Skalen und Charakteristika mongolischer Musik
In aller Kürze soll nun abschließend noch auf Skalen, Melodien und Charakteristika mongolischer und tuvinischer Musik eingegangen werden. Dabei ist der Zusammenhang, der sich aus dem Kehlgesang ergebenden Merkmale mit den allgemeinen Charakteristika auch der nicht-obertönenden Musik des zentralasiatischen Raumes auffallend.
Die Frage, ob nun der Kehlgesang auf die übrigen Musikstile Einfluss nahm oder umgedreht der Kehlgesang eine naheliegende Gesangsform einer bereits ausgeprägten Musikkultur war, wird schwerlich zu klären sein.
Die vorherrschende Skala in den zu betrachtenden Regionen ist eine anhemitonische Pentatonik mit gelegentlichen diatonischen Wendungen durch die Kombination zweier Fünftonreihen. Diese lässt sich hervorragend im Obertongesang umsetzen, da sich, wie in den Abbildungen 8 bis 10 dargestellt, ab dem 4. Oberton automatisch eine solche Skala ergibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Obertonreihe über den Grundton G[30]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[31]
Abbildungen 9 und 10: Bevorzugte Skala tuvinischer Sänger
Weiterhin typisch für mongolische und tuvinische Musik ist die liedhafte Gestaltung der Melodien sowie die Verwendung großer Sprungintervalle und eines großen Ambitus. Letzterer ergibt sich im Kehlgesang ja automatisch aus der Spanne zwischen Grund- und Obertönen, besonders bei Liedern, in denen Kehlgesangsteile mit anderen Gesangsstilen vermischt auftreten.
Quarten und Quinten kommt eine große Bedeutung als Melodie- und Gerüstintervallen zu – wie sie auch eine große Bedeutung in der natürlichen Partialtonreihe haben.
Zudem wechseln einzelne Melodietöne häufig ihre tonale Funktion innerhalb eines Stückes. Auch dies lässt sich insofern auf den Kehlgesang übertragen, dass mit dem Wechsel des Basstones auch ein funktionaler Neubezug der Obertöne stattfindet.
Als letztes Charakteristikum ist die variierte Wiederholung einzelner Motive und Motivgruppen zu nennen.[32] Im Kehlgesang, besonders in Stilen wie dem Sygyt, können Obertöne so als variierende Ornamente eingesetzt werden. In Abbildung 11 sind Beispiele für Melodieverläufe der in Kapitel 4 „Arten des Kehlgesangs in Tuva“ behandelten tuvinischen Kehlgesangsstile aufgezeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Typische Skalen und Melodien der tuvinischen Stile[33]
III. Schlussbemerkungen
Der zentralasiatische Obertongesang ist sicher eine der faszinierendsten Gesangstechniken unserer Zeit. Deshalb ist es wohltuend zu beobachten, dass das wissenschaftliche Interesse am Kehlgesang rasant zunimmt, sich die Beschäftigung mit der Thematik langsam aus der Vorherrschaft der Esoteriker befreien kann und Ethnologen, Sprechwissenschaftler, Mediziner und Musikwissenschaftler gleichermaßen die nach wie vor ungeklärten Details der Technik zu ergründen suchen.
Auch das praktische Interesse am Obertongesang wächst stetig. Seit Karl Stockhausen 1968 in seinem Stück „Stimmung“ Obertongesang einsetzte, wurden zahlreiche Obertonchöre in Europa gegründet sowie Obertongesang zur Verbesserung des Chorklanges traditioneller Chöre verwendet. Auch zunehmend mehr Frauen lenken dabei die Aufmerksamkeit auf sich.
So sind in den kommenden Jahren mit Spannung die nächsten Ergebnisse der Forschung in diesem Bereich zu erwarten. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, Kehlgesang immer häufiger und zunehmend professioneller aufgeführt zu hören.
IV. Literaturverzeichnis
Bücher, Sammelbände und Lexika
- Baratta, Dr. Mario (Hrsg.): Der Fischer Weltalmanach 2001, Frankfurt am Main 2000.
- Boenninghaus, Lenarz: Hals- Nasen- Ohren- Heilkunde für Studierende der Medizin, Berlin 2000.
- Emsheimer, Ernst: „Mongolen“ in Finscher, Ludwig (Hrsg.): Außereuropäische Musik in Einzeldarstellungen, Kassel 1980.
- Emsheimer, Ernst: Studia ethnomusicologica eurasiatica, Stockholm 1964.
- Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994 ff. .
- Forkert, Fred und Barbara Stelling: Mongolei, Bielefeld 1999.
- Haenisch, Erich: Die geheime Geschichte der Mongolen, Leipzig 1948.
- Pegg, Carole: Mongolian Music, Dance and Oral Narrative- Performing Diverse Identities, Washington 2001.
- Reimann, Michael: Unendlicher Klang- Obertöne in Stimme und Instrument, Norderstedt 1993.
- Sadie, Stanley (Hrsg.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980.
- Schenk, Amélie: Mongolei, München 2003.
- Serruys, Henri: Pei-lou fong-sou: Les coutumes des Esclaves Septentrionaux de Hsiao Ta-heng, Peking 1945.
- Tongeren, Marc C. van: Overtone Singing, Amsterdam 2002.
Zeitschriften und Sonderdrucke
- Aalto, Pentti: “Music of the Mongols: An Introduction” in Sinor, Denis (Hrsg.): Aspects of Altaic Civilization, Band 23, Bloomington 1963.
- Aksenov, A. N.: “Tuvin Folk Music” in Asian Music 4 (2), New York 1973 (S. 7-18).
- Grawunder, Sven: „Der südsibirische Kehlgesang als Gegenstand phonetischer Untersuchungen.“ in Krech, Eva-Maria und Eberhard Stock (Hrsg.): Gegenstandauffassung und aktuelle phonetische Forschungen der halleschen Sprechwissenschaft, Halle 2003.
- Lawall, Georg: „Obertöne- Das innere Universum“ in musikball extra- Zeitschrift für Gitarre, Folklore und Lied, Nov 1991.
- Léothaud, Gilles: „Considérations acoustiques et musicales sur le chant diphonique.“ in Le Chant Diphonique, Dossier Nr. 1, Limoges 1998.
- Walcott, Ronald: “The Chöömij of Mongolia- A Spectral Analysis of Overtone Singing” in Hood, Mantle (Hrsg.): Selected Reports in Ethnomusicology, Band 2, Nr. 1, Los Angeles 1974 (S. 55- 60). Seminarbeihefte
- Baumann, Prof. Dr. Max Peter (Dir.): Festival traditioneller Musik´91- Seidenstraße, Berlin 1991.
- Gunji, Sumi: “An Acoustical Consideration of Xöömij” in Emmert, Richard und Yuki Minegishi (Hrsg.): Musical Voices of Asia- Report of [Asian Traditional Performing Arts 1978], Tokyo 1978.
- Quang Hai, Trân und Denis Guillou: “Original Research and Acoustical Analysis in connection with the Xöömij Style of Biphonic Singing” in Emmert, Richard und Yuki Minegishi (Hrsg.): Musical Voices of Asia- Report of [Asian Traditional Performing Arts 1978], Tokyo 1978.
Diplomarbeiten
- Grawunder, Sven: Obertongesang versus Kehlgesang- Die Erforschung eines besonderen Stimmgebrauchs, Diplomarbeit am Institut für Sprechwissenschaft und Phonetik der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale 1999.
Internet
- http://khoomei.com, Dezember 2003.
- http://oberton.org/, April 2004.
- http://peyote.com/jonstef/khoomi.htm, Dezember 2003.
- www.acoustics.org/press/136th/kakita3.htm, Dezember 2003.
- www.boerte.de, Dezember 2003.
- www.geocities.com/shamanmusic/, Dezember 2003.
- www.hosoo.de, April 2004.
- www.music.ch/face/instrum/mongolia-instrum.html, Dezember 2003.
- www.obertoene.com/Obertongesang/obertongesang.html, Dezember 2003.
- www.sciam.com, Dezember 2003.
- www.stuarthinds.com, Dezember 2003.
- www.tranquanghai.net, Dezember 2003.
- www.tranquanghai.org, Dezember 2003.
CDs
- Ensemble Temuzhin-Altai-Khangain-Ayalguu 2, Face Music Switzerland, FM 50026, Thalwil 1998.
- Overtone Singing, Fusica, FUS 001, Amsterdam 2002.
- Tenguerleg Duun- Khöömi du Désert de Gobi, Association URGA, BH11, 1998.
- Tuvinian Singers and Musicians, WDR World Network, 55.838, Frankfurt 1993.
Seminare
- Saus, Wolfgang: Anfängerkurs Obertongesang, München 13. 12. 2003.
[...]
[1] vgl. Léothaud, Gilles: „Considérations acoustiques et musicales sur le chant diphonique.“ in: Le Chant Diphonique, Dossier no. 1, Limoges 1998 (S. 17-44).
[2] vgl. Aksenov, A. N.: “Tuvin Folk Music” in Asian Music 4 (2), New York 1973 (S. 7-18).
[3] vgl. Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 8 (Sachteil), Kassel 1998 (S. 1423).
[4] vgl. Sadie, Stanley (Hrsg.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 1980.
[5] vgl. Baratta, Dr. Mario (Hrsg.): Der Fischer Weltalmanach 2001, Frankfurt am Main 2000 (S. 551).
[6] vgl. ebd.
[7] vgl. Haenisch, Erich: Die geheime Geschichte der Mongolen, Leipzig 1948.
[8] vgl. Serruys, Henri: Pei-lou fong-sou: Les coutumes des Esclaves Septentrionaux de Hsiao Ta-heng, Peking 1945.
[9] vgl. beispielsweise Levin, Theodore C. und Michael E. Edgerton: „The Throat Singers of Tuva“ in www.sciam.com, Dezember 2003.
[10] vgl. beispielsweise Aksenov, A. N.: “Tuvin Folk Music” in Asian Music 4, H. 2, New York 1973 (S. 7-18) oder Grawunder, Sven: „Der südsibirische Kehlgesang als Gegenstand phonetischer Untersuchungen.“ in Krech, Eva-Maria und Eberhard Stock (Hrsg.): Gegenstandauffassung und aktuelle phonetische Forschungen der halleschen Sprechwissenschaft, Halle 2003.
[11] vgl. Pegg, Carole: Mongolian Music, Dance and Oral Narrative- Performing Diverse Identities, Washington 2001 (S. 12).
[12] vgl. Saus, Wolfgang: Anfängerkurs Obertongesang, München 13. 12. 2003.
[13] vgl. Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 5 (Sachteil), Kassel 1996 (S. 1694 f.).
[14] vgl. Gunji, Sumi: “An Acoustical Consideration of Xöömij” in Emmert, Richard und Yuki Minegishi (Hrsg.): Musical Voices of Asia- Report of [Asian Traditional Performing Arts 1978], Tokyo 1978 (S.171).
[15] vgl. beispielsweise Barke, Wolfgang in www.obertoene.com/Obertongesang/obertongesang.html, Dezember 2003 und Saus, Wolfgang: Anfängerkurs Obertongesang, München 13. 12. 2003.
[16] vgl. Grawunder, Sven: „Der südsibirische Kehlgesang als Gegenstand phonetischer Untersuchungen.“ in Krech, Eva-Maria und Eberhard Stock: Gegenstandauffassung und aktuelle phonetische Forschungen der halleschen Sprechwissenschaft, Halle 2003 (S. 82).
[17] vgl. Grawunder, Sven: Obertongesang versus Kehlgesang- Die Erforschung eines besonderen Stimmgebrauchs, Diplomarbeit am Institut für Sprechwissenschaft und Phonetik der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale 1999 (S. 65-66).
[18] vgl. Grawunder, Sven: „Der südsibirische Kehlgesang als Gegenstand phonetischer Untersuchungen.“ in Krech, Eva-Maria und Eberhard Stock (Hrsg.): Gegenstandauffassung und aktuelle phonetische Forschungen der halleschen Sprechwissenschaft, Halle 2003 (S. 62).
[19] vgl. Aksenov, A. N.: “Tuvin Folk Music” in Asian Music 4 (2), New York 1973.
[20] vgl. beispielsweise Tongeren, Marc C. van: Overtone Singing, Amsterdam 2002 (S. 59).
[21] vgl. Aksenov, A. N.: “Tuvin Folk Music” in Asian Music 4 (2), New York 1973 (S. 7-18).
[22] vgl. Grawunder, Sven: „Der südsibirische Kehlgesang als Gegenstand phonetischer Untersuchungen.“ in Krech, Eva-Maria und Eberhard Stock (Hrsg.): Gegenstandauffassung und aktuelle phonetische Forschungen der halleschen Sprechwissenschaft, Halle 2003.
[23] vgl. beispielsweise Tuvinian Singers and Musicians, WDR World Network, 55.838, Frankfurt 1993.
[24] Obertöne
[25] vgl. Pegg, Carole: Mongolian Music, Dance and Oral Narrative- Performing Diverse Identities, Washington 2001.
[26] vgl. ebd.
[27] vgl. www.hosoo.de, April 2004.
[28] vgl. CD- Beiheft von: Ensemble Temuzhin-Altai-Khangain-Ayalguu 2, Face Music Switzerland, FM 50026, Thalwil 1998.
[29] vgl. auch Schenk, Amélie: Mongolei, München 2003.
[30] vgl. Saus, Wolfgang in http://oberton.org/, April 2004.
[31] vgl. www.sciam.com, Dezember 2003 und Fujimura, Prof. Osamu in www.acoustics.org/press/136th/kakita3.htm, Dezember 2003.
[32] vgl. zu allen Charakteristika beispielsweise Emsheimer, Ernst „Mongolen“ in Finscher, Ludwig (Hrsg.): Außereuropäische Musik in Einzeldarstellungen, Kassel 1980.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Kehlgesang?
Kehlgesang, auch Obertongesang genannt, ist eine Gesangstechnik, bei der ein einzelner Sänger scheinbar zwei Töne gleichzeitig erzeugt. Dies geschieht durch selektive Verstärkung einzelner Obertöne (Formanten) des Stimmklangs durch Veränderung der Mundstellung, der Zungenposition, des Gaumensegels und des Kehldeckels.
Woher stammt der Kehlgesang?
Der Ursprung des Kehlgesangs liegt wahrscheinlich bei den Türkvölkern in Zentralasien, insbesondere in der Altai-Region, der heutigen Republik Tuva und der Mongolei. Heute ist er noch unter Mongolen, Oiraten, Uyguren, Kakassen, Kalmücken, Tuvinern und Bashkiren verbreitet.
Welche Arten des Kehlgesangs gibt es in Tuva?
In Tuva lassen sich hauptsächlich drei Stilrichtungen des Kehlgesangs unterscheiden: Kargiraa, Khomei und Sygyt. Die Stile Borbannadir und Ezengileer werden oft auch separat genannt, können aber als Unterformen von Khomei bzw. Sygyt betrachtet werden.
Wie unterscheiden sich die tuvinischen Stile des Kehlgesangs?
- Kargiraa: Sehr tiefer Fundamentton (Kontraoktave), klare Obertöne in hoher Lage, vokalnahe Variante.
- Khomei: Pedalton in der großen Oktave, weiche und resonante Obertöne, Lippen fast geschlossen, Zungenspitze formt Obertonmelodie mit.
- Sygyt: Klarer, brillanter, pfeiftonartiger Oberton, Basiston oft kaum hörbar, Zungenspitze berührt obere Zahnreihe.
Welche Arten des Kehlgesangs gibt es in der Mongolei?
Die mongolischen Kehlgesangsstile sind weniger klar voneinander differenzierbar als die tuvinischen. Es gibt verschiedene Systematisierungsversuche, die sich oft danach richten, welcher Körperbereich hauptsächlich zur Klangerzeugung dient, z.B. labial (Lippen), palatal (Gaumen), nasal (Nase), glottal (Kehlkopf) oder Magen-Khöömi.
Welche Rolle spielen Obertöne in der mongolischen und tuvinischen Musik?
Die Pentatonik, die häufig in mongolischer und tuvinischer Musik verwendet wird, ergibt sich auf natürliche Weise aus den Obertönen eines Grundtons. Auch die Verwendung großer Sprungintervalle und Ambitus sowie die variierte Wiederholung einzelner Motive ähneln der Spanne zwischen Grund- und Obertönen beim Kehlgesang.
Was ist der aryepiglottische Sphinkter und welche Rolle spielt er beim Kehlgesang?
Der aryepiglottische Sphinkter ist eine Verengung des Kehlkopfes, die durch Spannungen in verschiedenen Kehlöffnungen erzeugt wird. Diese Verengung ähnelt ansatzweise dem Würgen und ermöglicht eine deutlichere Trennung des Obertons vom Fundamentton.
Wie wird Kehlgesang gelernt?
Traditionell wird Kehlgesang durch Imitation des Lehrers und nicht funktional gelehrt. Jeder Weg, der zum erwünschten Klangziel führt, ist akzeptiert.
Gibt es religiöse Aspekte beim Kehlgesang?
Die Frage, inwieweit religiöse Aspekte in der Entwicklung des Kehlgesangs eine Rolle spielten, ist umstritten. Manche Quellen betonen die enge Verbindung zum Animismus und Schamanismus, während andere ihn eindeutig der Alltagsästhetik zuordnen.
Wo wird Kehlgesang heute gepflegt?
Kehlgesang wird heute vor allem in der Westmongolei und in den Republiken Altai und Tuva gepflegt.
- Quote paper
- Maria Goeth (Author), 2004, Khöömii - Obertongesang in der Mongolei und Tuva, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109093