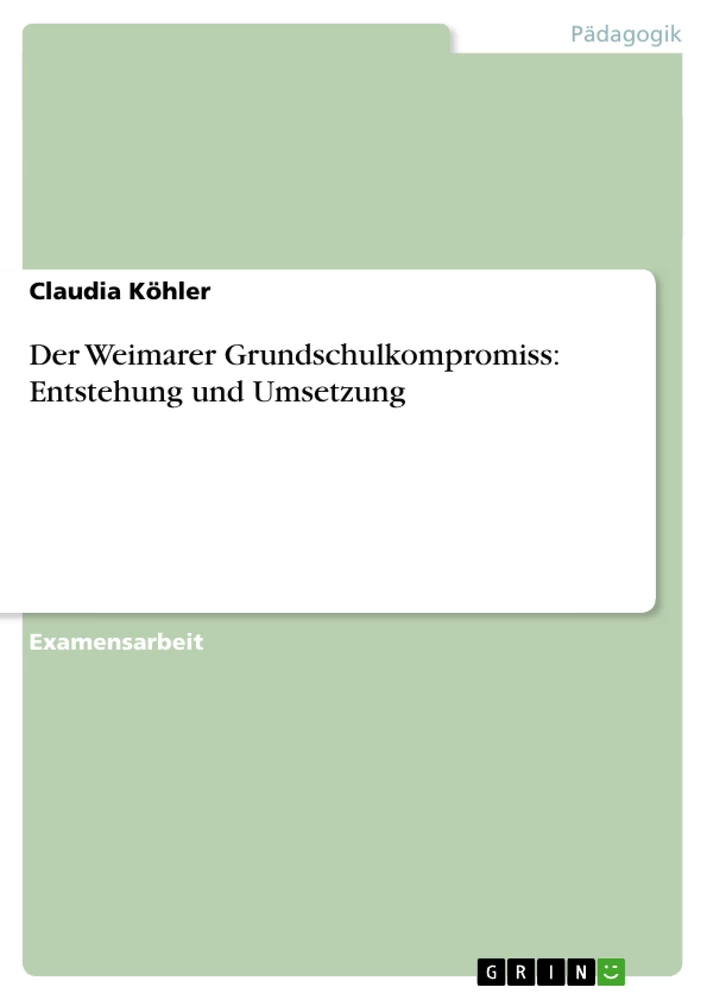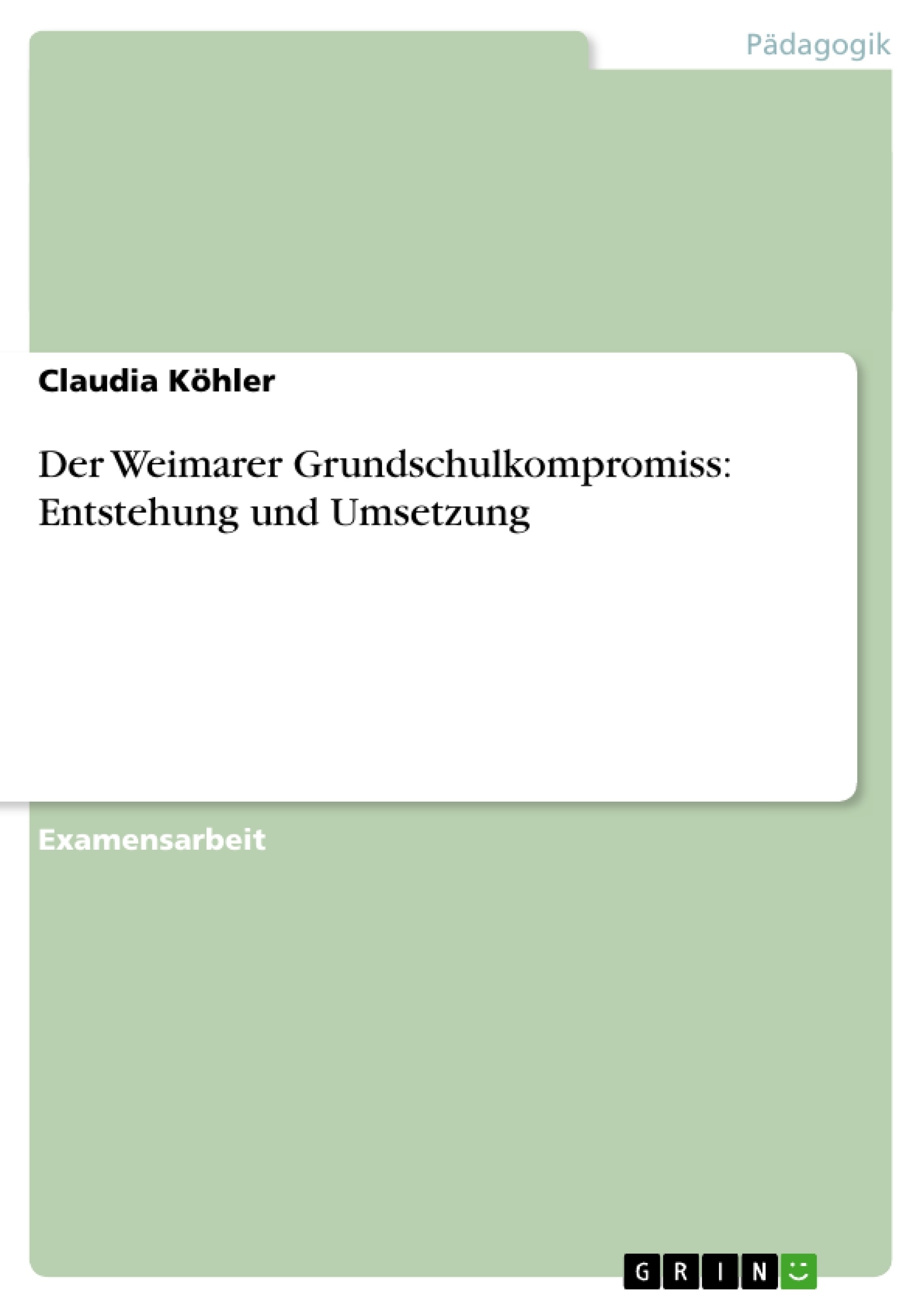Eine Grundschule ist die für alle Kinder gemeinsame Eingangsstufe eines allgemeinbildenden staatlichen Schulwesens. Die Elementarschuleinrichtung bildet einen tragenden Unterbau, auf dem sich die nach Funktion und Bildungsaufgaben unterschiedlichen Institutionen des Sekundarschulwesens aufbauen. Um beim Schuleintritt eine Trennung der Schüler und Schülerinnen nach der gesellschaftlichen Stellung der Eltern bzw. nach dem beabsichtigten Schulabschluss zu verhindern, ist eine Grundschule organisatorisch niemals aufgegliedert in die verschiedenen übergeordneten Schulformen. Vielmehr bildet sie eine einheitliche Basis, auf der sich die weiterführenden differenzierten Schularten stützen.
Grundschulen haben die Verpflichtung "allgemein" zu sein. Dies bedeutet, dass die Elementarschuleinrichtung alle schulfähigen Kinder, ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer Begabung, unterschiedslos aufnimmt.
Als Eingangsstufe des Schulwesens hat die Grundschule die Aufgabe, in einer gesetzlich vorgeschriebenen Zeit ihren Schülern eine einheitliche Erziehung und Bildung zu vermitteln. Auf diese, in der Grundschulzeit erworbenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten bauen die Lehrgänge der weiterführenden Schulen auf. Lässt man die individuellen Lernmöglichkeiten und Erfahrungen der einzelnen Kinder außer Acht, so ermöglicht theoretisch die Elementarausbildung der Grundschule jedem Schüler, eine beliebige, von ihm gewählte Schullaufbahn zu verfolgen.
Die allgemeine obligatorische Grundschule besteht in Deutschland seit 1919/20. Die Schulartikel der am 11. August 1919 verabschiedeten Weimarer Verfassung sowie das Reichsgrundschulgesetz von 1920 etablierten in Deutschland erstmals ein durch eine Grundschule allgemein zugängliches staatliches Schulwesen. Seit 1920 erhalten nun alle Kinder, ungeachtet der sozialen und wirtschaftlichen Stellung ihrer Eltern, in einer einzigen Schulinstitution die gleiche Elementarausbildung. Die Idee von der Errichtung eines staatlichen Schulsystems, dessen weiterführenden Schulinstitutionen sich auf den Lehrgang einer allgemeinen Grundschule aufbauen, besteht jedoch schon länger. Insbesondere die Einheitsschulbewegung engagierte sich jahrhundertelang für die Vereinheitlichung und Demokratisierung des deutschen Schulwesens. Obwohl die Vertreter der schulpolitischen Reformbewegung zum Teil sehr unterschiedliche pädagogische und bildungspolitische Auffassungen darüber vertraten, [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Struktur des deutschen Bildungswesens am Vorabend der Novemberrevolution 1918
- 3. Die politische und schulpolitische Entwicklung von November 1918 bis Juni 1920
- 3.1. Die Schulreformen der Länderregierungen 1918/19
- 3.1.1. Die Entflechtung von Staat, Schule und Kirche
- 3.1.2. Der Aufbau eines einheitlichen Schulsystems
- 3.2. Der Entwurf einer Reichsverfassung
- 3.2.1. Die schulpolitischen Positionen der Parteien
- 3.3. Die Weimarer Schulkompromisse
- 3.4. Die Schulartikel der Weimarer Verfassung
- 3.5. Das „Gesetz betreffend die Grundschulen und Aufhebung der Vorschulen“ vom 28.4.1920
- 3.6. Die Reichsschulkonferenz von 1920
- 3.7. Fazit
- 3.1. Die Schulreformen der Länderregierungen 1918/19
- 4. Die Umsetzung der Weimarer Schulkompromisse in den Jahren 1920 - 1933
- 4.1. Der Widerstand bürgerlicher Elternverbände gegen die Einrichtung der allgemeinen obligatorischen Grundschule
- 4.2. Das „kleine“ Grundschulgesetz vom April 1925
- 4.3. Die preußischen Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für die Grundschule - die innere Reform der Volksschulunterstufe
- 4.3.1. Die Grundschule als Stätte kindgemäßer und grundlegender Bildung
- 4.4. Die Bewährung der allgemeinen Grundschule in der Weimarer Republik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Umsetzung des Weimarer Grundschulkompromisses. Sie beleuchtet die schulpolitischen Entwicklungen der Weimarer Republik, die zu der Einführung der allgemeinen obligatorischen Grundschule führten, und analysiert die Herausforderungen bei der Umsetzung dieses Kompromisses.
- Die Entwicklung des deutschen Bildungssystems vor und nach dem Ersten Weltkrieg
- Die politischen und ideologischen Auseinandersetzungen um die Gestaltung des Schulsystems
- Der Prozess der Einführung der allgemeinen Grundschule
- Der Widerstand gegen die Reform und deren Auswirkungen
- Die Bedeutung der Weimarer Schulkompromisse für die Geschichte des deutschen Bildungswesens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung definiert die allgemeine obligatorische Grundschule als einheitliche Eingangsstufe des Bildungssystems, die alle Kinder unabhängig von Herkunft und Begabung aufnimmt und eine gemeinsame Grundlage für weiterführende Schulen schafft. Sie führt in die historische Entwicklung der Idee einer solchen Schule ein, die auf die Bemühungen der Einheitsschulbewegung zurückgeht, und betont das Ziel, den Zugang zum höheren Bildungswesen für alle zu ermöglichen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Einführung dieser Grundschule in der Weimarer Republik.
2. Die Struktur des deutschen Bildungswesens am Vorabend der Novemberrevolution 1918: Dieses Kapitel beschreibt vermutlich die bestehende Struktur des deutschen Bildungssystems vor dem Ersten Weltkrieg und der Novemberrevolution. Es legt wahrscheinlich die Grundlage für das Verständnis der Notwendigkeit von Reformen dar, indem es die bestehenden Ungleichheiten und Ineffizienzen des Systems aufzeigt, die zu den späteren Reformen führten. Hier wird vermutlich die soziale Selektion durch das Schulsystem vor der Weimarer Republik dargestellt.
3. Die politische und schulpolitische Entwicklung von November 1918 bis Juni 1920: Dieses Kapitel beschreibt die politischen und schulpolitischen Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg und die Entwicklung der Weimarer Schulkompromisse. Es analysiert die Schulreformen der Länderregierungen, den Entwurf der Reichsverfassung und die verschiedenen Positionen der Parteien zum Thema Schulwesen. Der Fokus liegt vermutlich auf dem Prozess der Aushandlung und dem Zustandekommen des Kompromisses um die Grundschule. Es beschreibt wahrscheinlich die verschiedenen politischen Akteure und ihre jeweiligen Interessen.
4. Die Umsetzung der Weimarer Schulkompromisse in den Jahren 1920 - 1933: Dieses Kapitel behandelt die praktische Umsetzung der Schulreformen in der Weimarer Republik. Es beleuchtet den Widerstand gegen die Einführung der allgemeinen Grundschule, insbesondere von bürgerlichen Elternverbänden, und diskutiert die Herausforderungen bei der Umsetzung. Hier wird wahrscheinlich der Widerstand gegen die Reform thematisiert und es werden mögliche Auswirkungen auf die Schulpraxis diskutiert. Es wird vermutlich die Entwicklung und die Grenzen des Reformvorhabens analysiert.
Schlüsselwörter
Weimarer Republik, Grundschule, Schulreform, Einheitsschule, Bildungssystem, Schulpolitik, Novemberrevolution, politische Ideologien, Elternverbände, Reichsgrundschulgesetz, Kompromissbildung, Umsetzung, Widerstand.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über den Weimarer Grundschulkompromiss
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Umsetzung des Weimarer Grundschulkompromisses in der Weimarer Republik. Sie analysiert die schulpolitischen Entwicklungen, die zur Einführung der allgemeinen obligatorischen Grundschule führten, und die Herausforderungen bei deren Umsetzung.
Welche Zeitspanne wird behandelt?
Die Arbeit betrachtet die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Novemberrevolution 1918, die Weimarer Republik (bis 1933) und die damit verbundenen schulpolitischen Entwicklungen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Struktur des deutschen Bildungssystems vor dem Ersten Weltkrieg, die politischen und ideologischen Auseinandersetzungen um die Gestaltung des Schulsystems nach dem Krieg, den Prozess der Einführung der allgemeinen Grundschule, den Widerstand gegen die Reform und deren Auswirkungen sowie die Bedeutung der Weimarer Schulkompromisse für die Geschichte des deutschen Bildungswesens.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einleitung, Kapitel 2 beschreibt die Struktur des deutschen Bildungswesens vor der Novemberrevolution. Kapitel 3 analysiert die politische und schulpolitische Entwicklung von 1918 bis 1920, inklusive der Weimarer Schulkompromisse. Kapitel 4 befasst sich mit der Umsetzung dieser Kompromisse von 1920 bis 1933 und dem Widerstand dagegen.
Welche Schlüsselereignisse werden untersucht?
Wichtige Ereignisse sind die Schulreformen der Länderregierungen nach 1918, der Entwurf der Reichsverfassung und die darin enthaltenen schulpolitischen Positionen der Parteien, die Reichsschulkonferenz von 1920, das „Gesetz betreffend die Grundschulen und Aufhebung der Vorschulen“ von 1920, das „kleine“ Grundschulgesetz von 1925 und die preußischen Richtlinien zur Aufstellung von Lehrplänen für die Grundschule.
Welche Akteure werden berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet die Rolle von Länderregierungen, Parteien, Elternverbänden und anderen politischen Akteuren bei der Gestaltung und Umsetzung der Schulreformen.
Was war das Ziel der Schulreform?
Das Ziel war die Einführung einer einheitlichen, allgemeinen und obligatorischen Grundschule als Eingangsstufe des Bildungssystems, die allen Kindern unabhängig von Herkunft und Begabung den Zugang zu weiterführenden Schulen ermöglichen sollte.
Gab es Widerstand gegen die Reform?
Ja, es gab erheblichen Widerstand, insbesondere von bürgerlichen Elternverbänden, gegen die Einführung der allgemeinen obligatorischen Grundschule.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Erfolge und Grenzen des Weimarer Grundschulkompromisses und dessen Bedeutung für die Geschichte des deutschen Bildungswesens. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Text selbst detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Weimarer Republik, Grundschule, Schulreform, Einheitsschule, Bildungssystem, Schulpolitik, Novemberrevolution, politische Ideologien, Elternverbände, Reichsgrundschulgesetz, Kompromissbildung, Umsetzung, Widerstand.
- Quote paper
- Claudia Köhler (Author), 2000, Der Weimarer Grundschulkompromiss: Entstehung und Umsetzung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10898