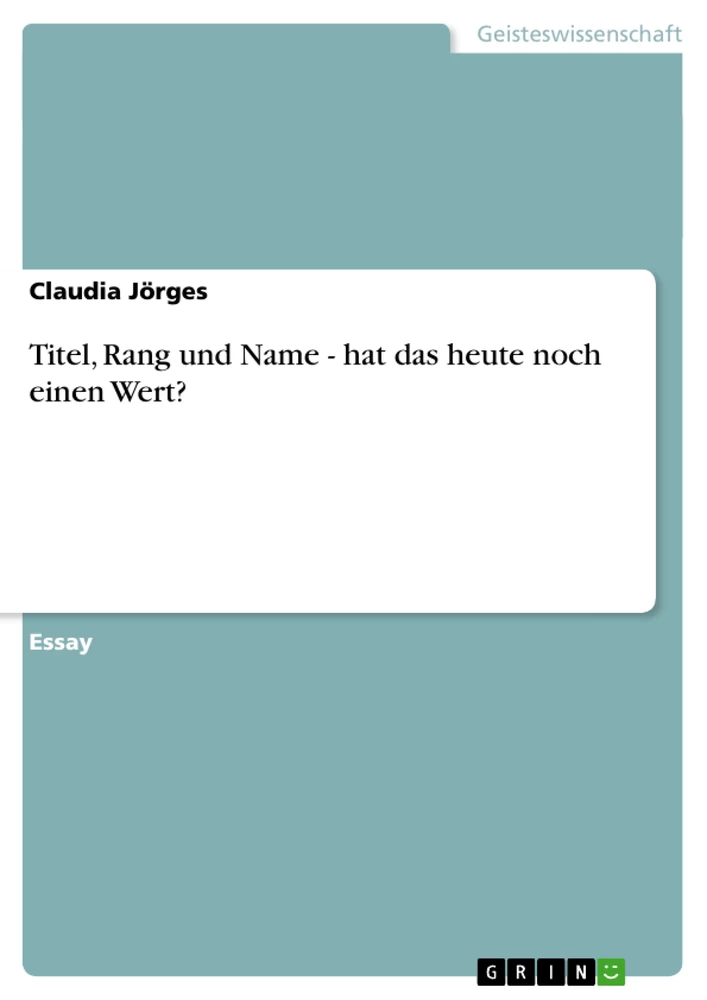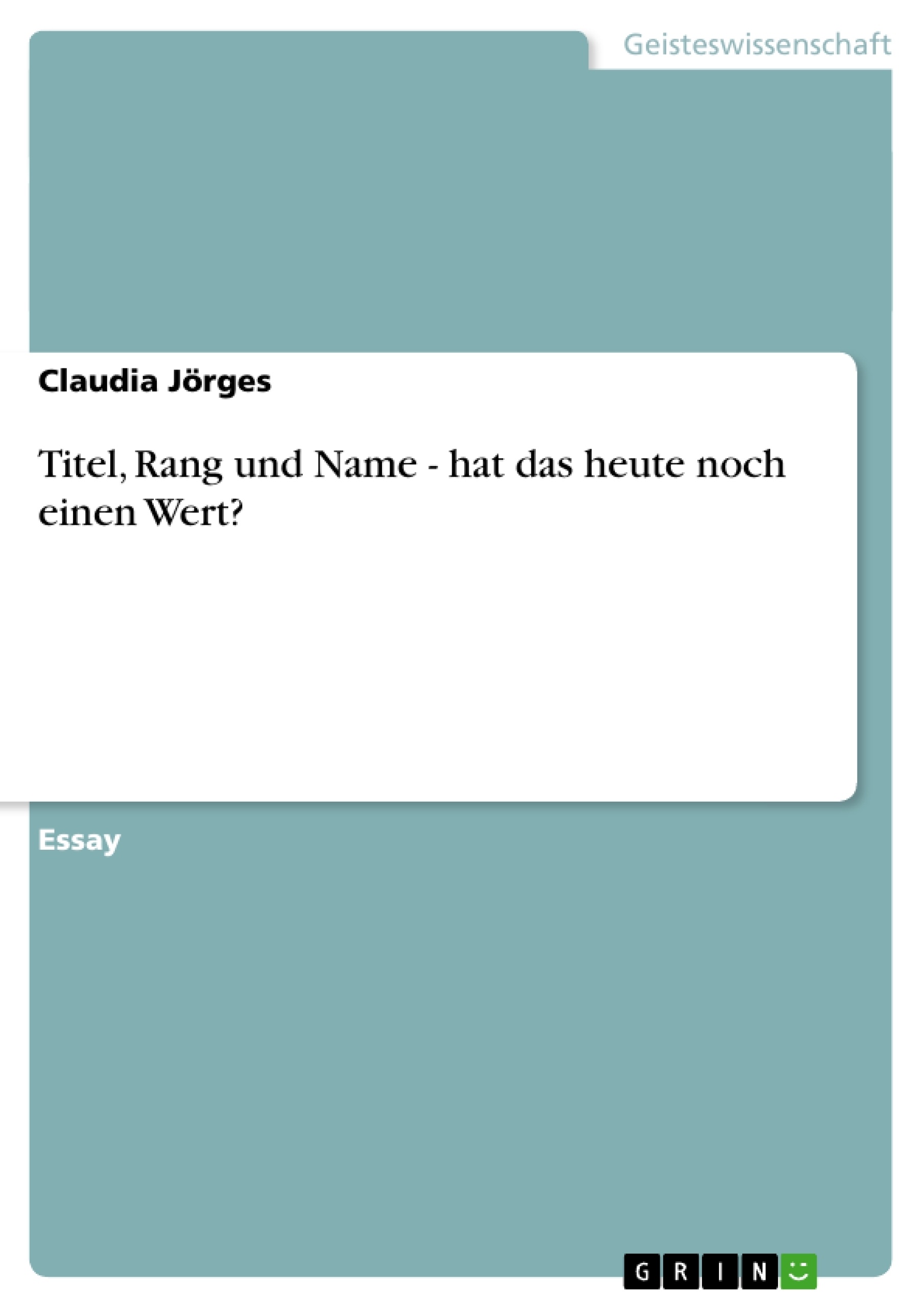Verbirgt sich hinter dem schlichten Namensschild an der Tür mehr als nur eine Berufsbezeichnung? Entdecken Sie in dieser faszinierenden Analyse, wie Namen, Titel und Ränge unsere Identität prägen und gleichzeitig verschleiern können. Von den feudalen Ursprüngen adliger Zusätze wie „von“ und „zu“ bis hin zu den modernen akademischen Graden wie „Dr.“ und „Prof.“, untersucht dieses Buch die subtilen Botschaften, die wir mit unserer Namensgebung aussenden, und die Erwartungen, die dadurch in der Gesellschaft geweckt werden. Tauchen Sie ein in die Welt der Familiennamen, die Hinweise auf Herkunft, Beruf oder charakteristische Eigenschaften geben, und erfahren Sie, wie diese historischen Wurzeln unser heutiges Selbstverständnis beeinflussen. Doch was passiert, wenn der Titel nicht mit der Leistung übereinstimmt, wenn der „Meister“ im Handwerk keine höchste Qualität liefert oder der „Graf“ sich seiner Herkunft unwürdig erweist? Anhand von Beispielen aus Wirtschaft und Gesellschaft wird aufgezeigt, dass wahre Identität mehr ist als nur ein Etikett. Es geht um Persönlichkeit, Charakter und die Art und Weise, wie wir unsere Rollen ausfüllen. Lassen Sie sich von den Erkenntnissen Anselm Strauss', Erik H. Eriksons und anderer Experten inspirieren, um zu verstehen, wie unser Selbstbild und die Wahrnehmung durch andere miteinander interagieren und wie wir uns von gesellschaftlichen Erwartungen befreien können, um unsere eigene, authentische Identität zu finden. Dieses Buch ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Macht der Namen und Titel und eine Einladung zur Selbstreflexion über die eigene Rolle in der Welt. Es ist eine essentielle Lektüre für alle, die sich fragen, wie viel Wahrheit in den Konventionen steckt und wie wir uns von ihnen emanzipieren können, um ein erfülltes und authentisches Leben zu führen. Ergründen Sie die verborgenen Schichten hinter den Fassaden und entdecken Sie die wahre Bedeutung von Rang und Namen – eine spannende Reise zur Selbsterkenntnis und zum Verständnis unserer komplexen Gesellschaft, die unser Bild von Erfolg und sozialer Anerkennung hinterfragt.
Rang und Name
Mitte der sechziger Jahre hat sich Anselm Strauss in seinem Essay „Spiegel und Masken“ mit der Stellung und Bedeutung von Namen in der Gesellschaft beschäftigt. Er vertritt die Auffassung, dass sich im Namen die eigene Persönlichkeit, die Identität, widerspiegeln lässt. Das also im Namen die Bewertungen der Namensgeber miteingebunden sind – was natürlich nicht immer bedeuten mag, dass der Namensträger sich auch mit seinem Namen stets identifizieren kann. Anselm Strauss weißt hierzu in seinem Essay auf die Veränderung des Namens hin. Der Namenswechsel ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass im neuen, sich selbst auserwählten Namen persönliche Werte und Auffassungen ausschlaggebend sind. Strauss nennt dies das „unlösbare Band zwischen Name und Selbstbild“. Auch Rang, Klasse, Epoche sowie religiöse und politische Einstellungen sollen die Herkunft des Einzelnen deutlich machen. Die adligen Zusätze wie „von“ und „zu“ geben Aufschluss über die wohlmöglich ehemals feudale Herkunft der Vorfahren. Mag sich dahinter ein Graf oder ein Baron verstecken? Es gibt tatsächlich Menschen, die sich ihrer unwürdig fühlen und sich einen Titel hinzukaufen, um ihre Identität mit einer gewissen Bewertung und mit Ansehen zu veredeln. Diverse Familiennamen können Hinweise auf bestimmte Berufsfelder innerhalb der Familien sein und sicherlich weisen einige Vornamen auf gesellschaftspolitische sowie auf religiöse Einstellungen hin. Das Charakterbild von einer Person, dass sich in uns entwickelt, wenn wir deren Namen hören, ist allerdings nicht immer gleich auf die Person zu projizieren, die diesen Namen trägt. Die Namensgeber waren letztendlich die Eltern. Nun kommt natürlich die Vermutung auf, dass vor allem in früheren Zeiten der erzieherische und religiös bedingte Einfluss der Eltern die Persönlichkeit des Kindes erheblich geprägt haben könnte. Man kann also sagen, dass der Name des Kindes, zumindest im vorletzten Jahrhundert, einen Teil des Charakter- und eventuell auch des Weltanschauungsbildes der Eltern wiedergibt und zugleich im Kind die Merkmale der Eltern zu erkennen sind. Der Name und die Identität des Namensträgers scheinen demnach in enger Verbindung zueinander zu stehen.
Ein anderes Beispiel anhand von Benennung einen Teil der Identität zu bestimmen, ist die Zurückverfolgung der Entstehung unserer Familiennamen. Einige Familiennamen können uns Aufschluss darüber geben, was oder wer sich dahinter versteckt. Nehmen wir z. B. solche Familiennamen die auf einen bestimmten Herkunftsort hinweisen können: Breitenbacher, Bamberger, Augsburger. Typische norddeutsche Namen sind z. B. Johannsen oder Jansen. Das sagt natürlich nicht viel über die Person aus, aber wir können die Personen ggf. einer Region bzw. ihrer Regionsherkunft zuordnen. So wurde u.a. die ungefähre Herkunft des mittelhochdeutschen Dichters Hartmann von Aue ausfindig gemacht. Nicht nur sein Dialekt, den er in seine Schriften mit aufnahm, sondern auch der Name „von Aue“ wies auf einen Ort Nähe des Bodensees hin.
Wolfgang Petershagen hat in seinem Buch „Was steckt hinter Familiennamen“ versucht etwas mehr über die Identität bestimmter Personen zu erfahren[1]. Seine Familiengeschichtsforschung ließ ihn darauf stoßen, dass sich einige Familiennamen aus Rufnamen abgeleitet haben. Nicht selten wurden Leute nach Herkunft, Wohnstätte, Beruf, Amt und Stand benannt. In sofern erfahren wir zumindest etwas über die regionale und auch gesellschaftliche Herkunft einer Familie. Die Betonung muss hier unbedingt auf „Herkunft“ liegen, da im Laufe der Zeit vor allem die sozialen Verhältnisse, schon nicht mehr mit denen von vor 100 Jahren zu vergleichen sind. Neben diesen „Herkunftsnamen“ entstanden zu Beginn des letzten Jahrtausends sogenannte „Vaternamen“ (Patronyme) und „Übernamen“. So wurde aus dem Sohn des Friedrichs, der mit Rufnamen Hans hieß, ein Hans Friedrichsen und ist der Kategorie der Vaternamen zuzuordnen. Die Übernamen hingegen spielen auf persönliche Merkmale, wie etwa die Haarfarbe, Körperbeschaffenheit oder Charaktereigenschaften an. Nun schreibt Petershagen, dass diese Namen heute noch aktuell sind. Aktuell wohl im Sinne, dass sie heute noch existieren, doch eher kaum, dass vor allem in bezug auf die Übernamen, die persönlichen Merkmale noch zu finden sind. Ein Herr Fröhlich, ein Herr Groß und ein Herr Braun mag heute mehr dem Bild eines Herrn Sorg, Herrn Klein und Herrn Rot gleichen.
Die Identität hinter dem Titel
Doch welche Namen sind nicht nur einfach noch existent, sondern auch aktuell? In der heutigen Zeit werden wir häufig mit akademischen Titeln konfrontiert. Wie sieht es aus mit dem Selbstbild und dem Bild, dass sich die Mitmenschen von jemandem machen, der vor seinem Namen noch einen „Dr.“ oder „Prof.“ stehen hat? Wir sprechen nicht mehr von Adelstiteln, die auf eine ranghohe Position hindeuten, sondern vielmehr von berufsbezogenen Titeln, die auch von Bürgerlichen getragen werden können. Lösen die akademischen Titel die hochgeschätzten Namen und Adelstitel in der Gesellschaftsbewertung ab? Und kann man Menschen auf diese Art und Weise überhaupt bewerten? Erik H. Erikson schrieb in einem seiner Werke, dass die Identität der Schnittpunkt zwischen dem sei, was eine Person sein will und was die Welt ihr zu sein gestattet.[2]
Im März 2003 hat die Handwerkskammer Wiesbaden an alle Betriebe im Bezirk ein Schreiben verschickt, dass von nun an alle Handwerksmeister vor ihren Namen die Abkürzung „me.“ setzen dürfen.[3] Es wird behauptet, dass sich durch die Verwendung der Abkürzung „me.“ jeder Handwerksmeister und jede Handwerksmeisterin genauso wie jeder „Dr.“ oder „Dipl.-Ing.“ in der Öffentlichkeit unverwechselbar präsentieren kann. Ein paar Zeilen weiter wird erwähnt für welche Merkmale der „Meister“ steht: für höchste Qualität einen Produktes, für herausragende Leistungen und für Persönlichkeit und Charakter.
Hier wird noch einmal deutlich die Meinung vertreten, dass der Titel und die Identität in ganz engem Kontakt zueinander stehen. Doch was sagt der Titel über die Persönlichkeit und den Charakter wirklich aus? Viele Menschen werden mit Sicherheit den Aufwand hinter einem Titel sehen, der notwendig gewesen ist, um einen Titel überhaupt erst zu bekommen. Das geistige Niveau wird auf eine höhere Ebene gestellt, die Titel-Abkürzungen für bestimmte Fachrichtungen geben Aufschluss über das Interesse an einer Materie und letztendlich will uns der Titel zeigen, dass die Person das entsprechende Potential hat um ein sogenannter Meister im Fach zu sein und wir uns auf hervorragende Leistungen freuen können. Doch angenommen, die Leistung lässt nach – was sehen wir dann hinter dem Titel? Ist dort dann immer noch der von so hoher Intelligenz beschenkte und von Tüchtigkeit bestückte Mensch zu sehen? Wenn die Erwartungen und das Persönlichkeitsbild, das man auf Grund eines Titels, von einer Person hat, nun doch nicht erfüllt werden, dann zeigt sich sehr schnell, dass der Titel nur so lange einen Wert besitzt, wie auch die Person, die den Titel trägt, ihre eigene Bemühungen hineinsteckt und ihre Identität in ihm sieht. Man kann einen Menschen also nur durch das was er macht und wie er es macht bewerten. Der Titel und der Rang müssen nicht wirklich aussagekräftig über die Fähigkeiten und Einstellungen eines Menschen sein.
Angenommen es stehen zwei Rechtsanwälte zur Verfügung. Der eine hat promoviert, der andere nicht, der Promovierte hat zehn Jahre Berufserfahrung, der andere nur fünf. Wenn nun der promovierte Rechtsanwalt den Prozess verliert und der andere ihn gewinnt, liegt die Bewertung der beiden Rechtsanwälte eindeutig zu Gunsten des nicht promovierten. Der Titel trägt hier zu keiner Beurteilung bei. Anselm Strauss belegt dies anhand des Beispiels eines Führungskraftwechsels in einem Unternehmen. Die frühere Führungskraft mag ein hochgeschätzter „Dr.“ gewesen sein, der die Erwartungen des Personals zum größten Teil erfüllt hat. Die neue Führungskraft mag ebenfalls ein „Dr.“ sein, doch sie muss mit Ressentiments und Reserviertheit der Kollegen rechnen. Der Titel spielt hier ebenfalls keine große Rolle mehr.
Kommen wir noch einmal zurück auf die adeligen Titel. Wie zu Anfang erwähnt gibt es manche Menschen, die sich ihren „von“-Titel erkauft haben und somit auf sich aufmerksam machen wollen. Wenn sich nun wirklich ein Graf oder Baron dahinter versteckt, woher wissen wir dann, welche Persönlichkeit wir hinter diesem Titel vorzufinden haben? Zu aller erst reagieren die Menschen mit Hochachtung. Aber vor was? Ist ein Graf heute noch das, was ein Graf vor 200 Jahren war? Hat er heute immer noch die gleichen Aufgaben und die Repräsentanz wie damals? Ebenso gut kann der Graf heute ein ungebildeter und interessenloser Mensch sein, der gerade seinen Job wegen seines unsozialen Verhaltens gegenüber seines Vorgesetzten verloren hat und der sich jetzt auf seine Arroganz bezüglich des ihm angeborenen Titels ausruht. Genauso gut kann es allerdings sein, dass er eine Verpflichtung gegenüber dem Namen und seiner Abstammung empfindet – nämlich die Verpflichtung dem Namen und dem Titel weiterhin Ehre zu erweisen. Dementsprechend mag er erzogen worden sein und seine Identität seiner Herkunft angepasst haben.
Persönlichkeit und Charakter
Der „Meister“, der „Dr.“, der „Dipl.Ing.“ und der „von“ – in allen haben wir nun die berufsbezogenen Interessen und Fähigkeiten sowie die Herkunft entdecken können. Doch das reicht nicht aus um die vollkommende Identität eines Menschen bestimmen zu können. Wie steht es um die Persönlichkeit, den Charakter? Mit was beschäftigen sich diese Menschen in ihrer Freizeit oder wenn sie zu Hause sind? Ein großer Schritt um die vollständige Identität eines Menschen zu entdecken, und wahrscheinlich auch der größte Schritt, ist es, die Charaktereigenschaften des Einzelnen herauszufinden. Titel und Rang geben wenig Aufschluss über die Gefühle und Gedankengänge, Lebenseinstellungen, Ausstrahlung und Persönlichkeitsmerkmale, die sich in einer Person verbergen. Stattdessen sind sie Symbole für besondere Leistungen.
Man kann also behaupten, dass weder in Familiennamen, noch in Titel und Rang ein eindeutiger Bezug zur persönlichkeitsbezogenen Identität gegeben wird. Und wenn wir uns das Zitat von Erik H. Erikson noch einmal näher betrachten, stellt sich die Frage, ob sich nicht auch die Persönlichkeit zu einem gewissen Maß, nach den Vorstellungen und Wünschen der Gesellschaft richtet. Die Identität, die sich hinter dem Titel und dem Rang befindet, wird laut Erikson bereits durch die Bewertungen der Gesellschaft beeinflusst. Die Werte werden also nicht angeboren, wie der Adelstitel, sondern jeder erfährt im Laufe der Zeit seine eigene Bewertung durch die Gesellschaft. Das Selbstbild, dass man ebenso im eigenen Namen wieder zu erkennen meint, kann in der Öffentlichkeit demnach ein ganz anderes Bild widerspiegeln. Inwiefern die beiden Bilder Gemeinsamkeiten aufweisen können, wäre noch etwas näher zu untersuchen – auch im Hinblick darauf, welches der Persönlichkeitsbilder nun die tatsächlichere Identität verdeutlicht.
Literatur:
- Anselm L. Strauss: Spiegel und Masken. Die Suche nach Identität. Frankfurt/Main: Suhrkamp 1987.
- Erik H. Erikson: Identität und Lebenszyklus. Suhrkamp 2002.
- Handwerkskammer Wiesbaden: me. – Neue Abkürzungen für Meister im Handwerk. 2003.
- Wolf-Henning Petershagen, Maier, Jauch & Eisele: Was steckt hinter den Familiennamen?
Stuttgart: Theiss 2001.
[...]
[1] Wolf-Henning Petershagen, „Maier, Jauch & Eisele – Was steckt hinter den Familiennamen?“
[2] Erik H. Erikson, „Identität und Lebenszyklus“
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Anselm Strauss' Auffassung über Namen in der Gesellschaft, wie sie im Text "Rang und Name" erwähnt wird?
Anselm Strauss vertritt die Auffassung, dass der Name die Persönlichkeit und Identität widerspiegelt und Bewertungen der Namensgeber enthält. Ein Namenswechsel deutet auf die Bedeutung persönlicher Werte hin. Er spricht vom "unlösbaren Band zwischen Name und Selbstbild".
Welche Informationen können Namen laut dem Text "Rang und Name" über eine Person oder Familie geben?
Namen können Hinweise auf Rang, Klasse, Epoche, religiöse und politische Einstellungen geben. Adlige Zusätze wie "von" und "zu" deuten auf feudale Herkunft hin. Familiennamen können Berufsfelder andeuten, und Vornamen können gesellschaftspolitische oder religiöse Einstellungen reflektieren.
Wie beeinflusst die heutige akademische Titelvergabe die Gesellschaftsbewertung, wie sie im Text "Rang und Name" diskutiert wird?
Der Text diskutiert, ob akademische Titel Adelstitel in der Gesellschaftsbewertung ablösen und ob Menschen auf diese Weise überhaupt bewertet werden können. Erik H. Erikson wird zitiert, dass Identität der Schnittpunkt zwischen dem ist, was eine Person sein will und was die Welt ihr zu sein gestattet.
Was wurde Handwerksmeistern im Bezirk Wiesbaden im Jahr 2003 erlaubt und was sollte dies bewirken, wie es im Text "Rang und Name" zitiert wird?
Die Handwerkskammer Wiesbaden erlaubte Handwerksmeistern, die Abkürzung "me." vor ihren Namen zu setzen, um sich wie "Dr." oder "Dipl.-Ing." unverwechselbar in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Meistertitel sollte für höchste Qualität, herausragende Leistungen, Persönlichkeit und Charakter stehen.
Inwieweit sind Titel und Rang wirklich aussagekräftig über die Fähigkeiten und Einstellungen eines Menschen, laut dem Text "Rang und Name"?
Der Text argumentiert, dass Titel und Rang allein nicht aussagekräftig über die Fähigkeiten und Einstellungen eines Menschen sind. Die Leistung und das Handeln einer Person sind wichtiger für die Bewertung als der Titel selbst. Ein verlorener Prozess eines promovierten Anwalts gegenüber einem gewonnenen eines nicht-promovierten Anwalts verdeutlicht dies.
Welche Rolle spielt die Herkunft (z.B. Adelstitel) im Hinblick auf die Persönlichkeit und Identität einer Person, wie es im Text "Rang und Name" beschrieben wird?
Die Herkunft, wie ein Adelstitel, kann zwar Hochachtung hervorrufen, aber die Persönlichkeit dahinter ist entscheidend. Der Text fragt, ob ein Graf heute noch das gleiche bedeutet wie vor 200 Jahren und ob er seine Verpflichtungen gegenüber dem Namen und seiner Abstammung erfüllt.
Was ist laut dem Text "Rang und Name" notwendig, um die vollständige Identität eines Menschen zu bestimmen?
Um die vollständige Identität eines Menschen zu bestimmen, reichen Titel und Rang nicht aus. Es ist wichtig, die Persönlichkeit, den Charakter, die Gefühle, Gedankengänge, Lebenseinstellungen, Ausstrahlung und Persönlichkeitsmerkmale zu berücksichtigen.
Inwiefern beeinflusst die Gesellschaft die Identität einer Person, wie im Text "Rang und Name" basierend auf dem Zitat von Erik H. Erikson diskutiert?
Laut Erik H. Erikson wird die Identität durch die Bewertungen der Gesellschaft beeinflusst. Das Selbstbild, das man im eigenen Namen wiedererkennt, kann in der Öffentlichkeit ein anderes Bild widerspiegeln.
- Quote paper
- Claudia Jörges (Author), 2003, Titel, Rang und Name - hat das heute noch einen Wert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108944