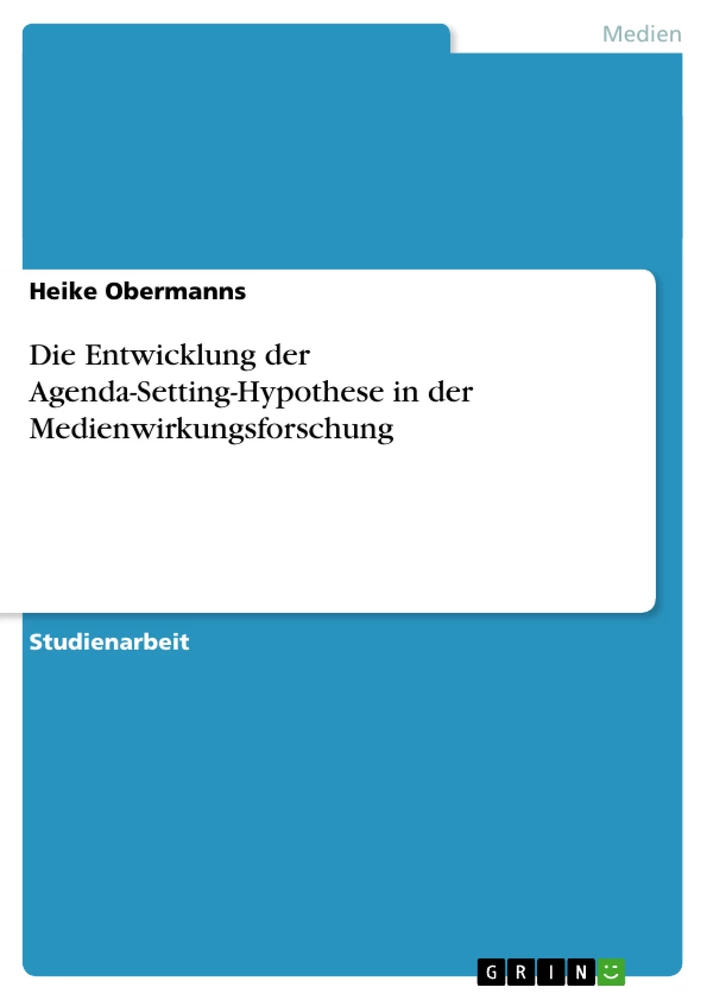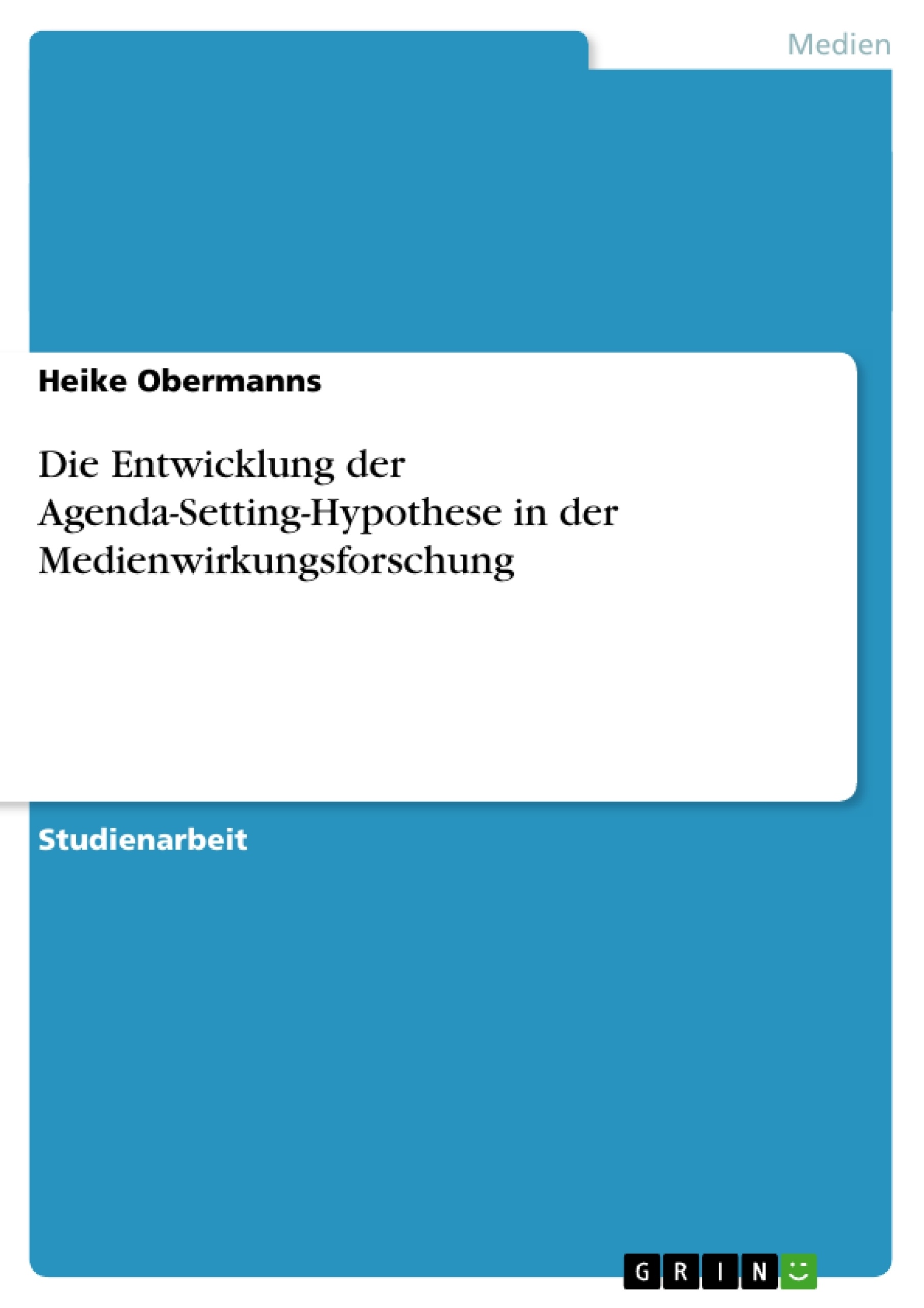In seiner erstmals 1962 erschienenen Schrift "Struk¬turwandel der Öffentlichkeit" lenkt Jürgen Habermas das Augenmerk der politischen Theorie der Bundes¬republik auf eine demokratietheoretische Größe, die in der Wahl- und Kommunikationsforschung der USA seit Lippmanns "Public Opinion" von 1922 Beachtung fand, hier jedoch "ihr abgeschiedenes, von den So¬ziologen nicht recht ernst genommenes Dasein führt" ( Habermas, S.351): die 'öffentliche Meinung'.
Er charakterisiert sie als staatsrechtliche Fiktion des bürgerlichen Rechtsstaats, die gleichwohl als verfassungsrechtlich institutionalisierte Norm nichts weniger als die einzig anerkannte Basis der Legi¬timation politischer Herrschaft sei; er folgt der Auffassung Siegfried Landshuts, nach der der moderne Staat als das Prinzip seiner Wahrheit die Volks¬souveränität voraussetzt - diese soll die öffentliche Meinung sein (vgl. Habermas, S. 344). Sie sei eine Zurechnung, eine Substitution des Ursprungs aller Autorität der für die Gesamtheit verbindlichen Ent¬scheidungen, ohne der der modernen Demokratie die Substanz ihrer eigenen Wahrheit fehlen würde. Zwischen den öffentlichen Verlautbarungen der poli¬tischen Institutionen und der "nichtorganisierten Masse des Publikums" sieht Habermas eine über die Massenmedien geleitete Verbindung, "und zwar durch jene demonstrativ oder manipulativ entfaltete Publi¬zität, mit deren Hilfe sich die am politischen Machtvollzug und Machtausgleich beteiligten Gruppen beim mediatisierten Publikum um plebiszitäre Folgebereit¬schaft bemühen" (S. 356); der der liberalen Vorstel¬lung folgende Kommunikationszusammenhang eines räso¬nierenden Publikums von Privatleuten sei zerrissen. Da die öffentliche Meinung die zentrale Legitimationsgrundlage der modernen Demokratie ist, sieht Habermas nur über die Institutionalisierung einer kritischen Öffentlichkeit die Möglichkeit des 'Publi¬kums', Anteil an der und Einfluß auf die beim Staat konzentrierten Entscheidungsgewalt zu nehmen.
(...)
Inhaltsverzeichnis
1) Öffentliche Meinung - zum theoretischen Bezugsrahmen der Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik
2) Das Konzept vom Agenda-Setting-Effekt
2.1) Die Pilotstudie
2.2 Wirkungs- und Forschungsmodelle
3) Zur Weiterentwicklung der Agenda-Setting-Forschung
3.1 Methodische Fragen
3.2 Publikumsorientierte Ansätze
3.2.1) Der "Uses and Gratifications-Approach"
3.2.2) Das Konzept vom "need for orientation" und der transaktionale Ansatz
3.2.3) Themensensibilisierung und Umweltvariablen: Die Studie von Erbring/
4) Zur Integration der Agenda-Setting-Hypothese in die Theorie der Schweigespirale
Literaturverzeichnis
1) Öffentliche Meinung - zum theoretischen Bezugsrahmen der Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik
In seiner erstmals 1962 erschienenen Schrift "Strukturwandel der Öffentlichkeit" lenkt Jürgen Habermas das Augenmerk der politischen Theorie der Bundesrepublik auf eine demokratietheoretische Größe, die in der Wahl- und Kommunikationsforschung der USA seit Lippmanns "Public Opinion" von 1922 Beachtung fand, hier jedoch "ihr abgeschiedenes, von den Soziologen nicht recht ernst genommenes Dasein führt" ( Habermas, S.351): die 'öffentliche Meinung'.
Er charakterisiert sie als staatsrechtliche Fiktion des bürgerlichen Rechtsstaats, die gleichwohl als verfassungsrechtlich institutionalisierte Norm nichts weniger als die einzig anerkannte Basis der Legitimation politischer Herrschaft sei; er folgt der Auffassung Siegfried Landshuts, nach der der moderne Staat als das Prinzip seiner Wahrheit die Volkssouveränität voraussetzt - diese soll die öffentliche Meinung sein (vgl. Habermas, S. 344). Sie sei eine Zurechnung, eine Substitution des Ursprungs aller Autorität der für die Gesamtheit verbindlichen Entscheidungen, ohne der der modernen Demokratie die Substanz ihrer eigenen Wahrheit fehlen würde. Zwischen den öffentlichen Verlautbarungen der politischen Institutionen und der "nichtorganisierten Masse des Publikums" sieht Habermas eine über die Massenmedien geleitete Verbindung, "und zwar durch jene demonstrativ oder manipulativ entfaltete Publizität, mit deren Hilfe sich die am politischen Machtvollzug und Machtausgleich beteiligten Gruppen beim mediatisierten Publikum um plebiszitäre Folgebereitschaft bemühen" (S. 356); der der liberalen Vorstellung folgende Kommunikationszusammenhang eines räsonierenden Publikums von Privatleuten sei zerrissen. Da die öffentliche Meinung die zentrale Legitimationsgrundlage der modernen Demokratie ist, sieht Habermas nur über die Institutionalisierung einer kritischen Öffentlichkeit die Möglichkeit des 'Publikums', Anteil an der und Einfluß auf die beim Staat konzentrierten Entscheidungsgewalt zu nehmen.
Der Bezugsrahmen der Medienwirkungsforschung, nämlich die Anforderung oder die Vorstellung, "die Medien sollen die Realität und die öffentliche Meinung widerspiegeln" (Schulz 1982, S.49), ist daher ein primär politischer: Öffentliche Meinung wird vor allen über und durch die Massenmedien vermittelt und konstituiert, sie sind Informationsquelle für nicht unmittelbar erfahrbare Ereignisse. Das politische System hat in diesem Zusammenhang das Interesse an Erklärungsmustern für "Strategien der Massenbeeinflussung", insbesondere durch Wahlkämpfe (vgl. Ehlers 1983 b, S. 319), oder auch an Politikvermittlung, während die kritische Öffentlichkeit im Sinne Habermas' das Interesse haben müßte, gerade nicht beeinflußt zu werden und ihre Interessen dem politischen System zu vermitteln.
Als Niklas Luhmann 1970 das Thema "öffentliche Meinung" ausgehend von Habermas' Überlegungen aufgreift, geschieht dies aus der Vorstellung, daß die Veränderungen der modernen Gesellschaft "eine radikalere Überprüfung des Konzepts der öffentlichen Meinung (erfordern), als die einflußreichen Ausführungen von Habermas sie vorgesehen hatten." (Luhmann 1970, S.6). Luhmanns These ist, daß 'öffentliche Meinung' heute nur noch die Festlegung von Themen der politischen Kommunikation bedeuten kann - vor der Hintergrund dieser theoretischen Diskussion wurden dann die seit 1972 primär in den USA angefertigten Studien zur 'Agenda-Setting' durch die Medien in der Bundesrepublik aufmerksam und kontrovers rezipiert, versprachen sie doch Aufschluß darüber, wie die Themen der politischen Tagesordnung überhaupt von der Bevölkerung als solche zur Kenntnis genommen und nach Wichtigkeit beurteilt werden. Die Idee, Meinungsbildung wäre als Ausdruck der Volkssouveränität eine eigenständige Leistung 'mündiger Bürger', müßte, träfe die Agenda-Setting-Hypothese in ihrer Reinform zu, endgültig aufgegeben werden.
Luhmann folgt dann Habermas auch nur insoweit, als auch er feststellt, daß in der liberalen Konzeption der öffentlichen Meinung die naturrechtliche Wahrheitsbindung der Politik aufgelöst werden sollte: das neue Vernunftprinzip hieß Meinung (vgl. Luhmann, S.4). Ein Verständnis von öffentlicher Meinung als Kontrolle von Herrschaft ordnet er jedoch der alteuropäischen Denkweise zu, deren "Vernunftglaube und damit auch der Glaube in das kritisch kontrollierende, Herrschaft verändernde Potential einer öffentlichen Meinung sich nicht halten ließ" (S.5). Die moderne Gesellschaft, die weitgehend in funktional differenzierte Teilsysteme spezifiziert sei, würde zum "turbulenten Feld, in dem alle Systeme durch Komplexität überfordert werden" (S.6) und in der Kontingenz im Sinne eines 'auch-anders-möglich-Seins' - vor allem des rechtlich und politisch Möglichen - zum Problem werde (S.7). Öffentliche Meinung sieht er daher als Reduktions- und Selektionsmechanismus für die Kontingenz des politische Möglichen durch Differenzierung von Themen politischer Kommunikation: "Nicht an der Form der Meinungen ist die Funktion der öffentlichen Meinung abzulesen, sondern an der Form der Themen politischer Kommunikationen, an ihrer Eignung als Struktur des Kommunikationsprozesses. Und diese Funktion besteht nicht in der Richtigkeit der Meinungen, sondern in der Unsicherheit absorbierenden, Struktur gebenden Leistung von Themen. " ( S. 9 ).
Die normative Vorstellung, etwas wie 'Volkssouveränität' durch öffentliche Meinung realisieren zu wollen, trifft nach Luhmann nicht die Strukturproblematik der modernen Gesellschaft. In seiner Sicht liegt die Funktion öffentlicher Meinung "nicht in der Durchsetzung des Willens - des Volkswillens, jener Fiktion des schlichten Kausaldenkens -, sondern in der Ordnung von Selektionsleistungen" (S. 27).
Es muß also überhaupt erst einmal festgelegt werden, was ein Thema politischer Kommunikation ist. Und die Agenda-Setting-Hypothese in ihrer Urform geht darauf zurück, daß diese Selektionsleistung durch die Massenmedien wahrgenommen wird: "(...) it is hypothesized that the mass media set the agenda for each political campaign, influencing the salience of attitudes toward the political issues."(McCombs/Shaw, S.177).
2) Das Konzept vom Agenda-Setting-Effekt
Bis Anfang der siebziger Jahre war Gegenstand der 'klassischen' Medienwirkungsforschung die Analyse von Einstellungs- oder Verhaltensänderungen der Rezipienten; das Persuasionsmodell beherrschte die Forschung (vgl. Schenk, S.194).
Doch ausgehend von der von Cohen bereits 1963 formulierten Auffassung, die Medien seien nicht unbedingt erfolgreich darin zu vermitteln, was die Leute denken sollen, sondern eher, worüber sie zu denken haben (vgl. McCombs/Shaw, S.177), richtet sich die Aufmerksamkeit der Agenda-Setting-Forschung auf die "von der Intention her bescheidenere Frage nach Wissensvermittlung bzw. Wissensstrukturierung durch Massenkommunikation" (Uekermann/Weiss, S. 70).
Es geht um die Aufmerksamkeit für bestimmte Themen, und dem Konzept liegt eine kausale, medienzentrierte Wirkungsannahme zugrunde, so daß es insofern doch in der traditionellen Wirkungsforschung verbleibt (vgl. Ehlers 1983 b, S.320).
Neu ist die Fokussierung latenter, kognitiver Medieneffekte: die Medien "prägen die Vorstellungen (Images) von politischen Figuren. Sie präsentieren fortlaufend Objekte, die vorschlagen, worüber die Individuen der Masse denken und etwas wissen bzw. fühlen sollen" (Lang/Lang 1966, zit.n. Schenk, S.196).
2.1) Die Pilotstudie
Die Aussage von Lang/Lang war der Ausgangspunkt für McCombs' und Shaws erster Studie von 1972 zur Agenda-Setting-Hypothese. In ihrer Untersuchung verglichen sie die Themenprioritäten von ca. 100 noch unentschiedenen Wählern während des Präsidentschaftswahlkampfs von 1968 in Chapel Hill, North Carolina mit den Ergebnissen einer Inhaltsanalyse von vier Lokalzeitungen und den Abendnachrichten von NBC und CBS.
Die Themen-"Hitlisten" der Wähler wurden durch die Frage nach ihren zwei oder drei wichtigsten Themen unabhängig von aktuellen Aussagen der Politiker ermittelt; die Medieninhalte wurden je nach Umfang und Positionierung in "major" und "minor" items unterschieden. Die Ranglisten der Wähler (Publikumsagenda) und die der Medien (Medienagenda) korrelierten miteinander sehr stark, so daß auf einen engen Zusammenhang der Themenstrukturen geschlossen wurde: "the data suggest a very strong relationship between the emphasis placed on different campaign media ( ... ) and the judgments of voters as to salience and importance of various campaign (...) the judgments of the voters seem to reflect the composite of the mass media coverage." (McCombs/Shaw, S. 181). Die Übereinstimmung lag sowohl bei "major'' als auch bei "minor" items vor.
Darüber hinaus überprüften McCombs und Shaw, ob eine selektive Wahrnehmung der Berichterstattung über die jeweils bevorzugte Partei durch die Rezipienten stattfand - die These einer selektiven Wahrnehmung war ein Schlüsselkonzept der Persuasionsforschung (vgl. Schenk, S.195). Läge selektive Wahrnehmung vor, so müßte die Korrelation zwischen Wählern und der Berichterstattung über ihre Partei am stärksten sein, wenn nicht, so müßten sich höhere Übereinstimmungen mit der gesamten Berichterstattung ergeben, unabhängig davon, welche Partei im Vordergrund sieht: "This would be evidence of the agenda-setting function." (McCombs/Shaw, S.182). Die Korrelation zwischen der Wähler-Agenda und der Gesamtberichterstattung war höher als die zur Berichterstattung über die bevorzugte Partei: Agenda-Setting erwies sich als der stärkere Effekt.
Dieser Studie folgte eine große Anzahl von Nachfolgeuntersuchungen, die trotz vorhandener Kritik an primär methodischen Mängeln "dieses vergleichsweise simple Design und sogar die methodischen Fehler'' (Ehlers 1983 a, S.167) übernommen haben. Als methodische Mängel nennt Ehlers ein zu kleines Wähler-Sample, keine Erhebung von Mediennutzungsdaten und den Vergleich aggregierter statt individueller Daten (ebd.); auch McCombs und Shaw weisen in ihrer Untersuchung selbst darauf hin, daß diese nur als erster Test der Hypothese befriedigen könne, weitere Forschung darüber hinaus individuelle Einstellungen der individuellen Mediennutzung zuordnen müsse (vgl. McCombs/Shaw, S.184f.).
Im Laufe der Nachfolgeuntersuchungen wurden gleichwohl auch methodologische Verbesserungen und Verknüpfungen mit anderen Konzepten der Medienwirkungsforschung vorgenommen (s.u. Kap.3.).
Hauptsächlich McCombs selbst hat das Modell differenziert und auch die Forschung typologisiert.
2.2 Wirkungs- und Forschungsmodelle
Der Agenda-Setting-Hypothese liegen nach McCombs drei Modellvorstellungen zugrunde (vgl. Ehlers 1983 a, S.169; Schenk, S. 198f.):
a) Awareness-Modell:
als Medienwirkung wird unterstellt, daß das Publikum auf bestimmte Themen aufmerksam wird, weil sie von den Medien behandelt werden. Die Themen werden als diskussionswürdig bekannt gemacht.
b) Salience-Modell:
Die Medienwirkung besteht in der unterschiedlichen Hervorhebung von Themen, die dann auch vom Publikum unter schiedlich beachtet und nach Wichtigkeit klassifiziert werden.
Dieses Modell ist Grundlage der meisten empirischen Studien. Es wird die aggregierte Publikumsagenda als Themen-"Hitliste"mit der Medienagenda verglichen.
c) Priorities-Modell:
Es wird angenommen, daß die Themenrangfolge der Medien sich spiegelbildlich im Bewußtsein der Rezipienten niederschlägt.
Modifiziert wurde die in diesen Modellvorstellungen sehr pauschal angelegte Wirkungshypothese in bezug auf die Themenkomplexe durch das Konzept "relativen Aufdringlichkeit" (obstrusiveness) der Themen für Rezipienten (vgl. Ehlers 1983 a, S.177; Schenk, S. 206). Es geht davon aus, daß bei Themen, die vom einzelnen nicht aus erster Hand in seiner direkten Umwelt erfahrbar sind, die Chancen für Medienwirkungen am größten sind. Als "aufdringliche" Themen werden demnach diejenigen angesehen, die direkt erfahrbar sind (z.B. Inflation, Kriminalität, Kommunalpolitik); "unaufdringliche" Themen sind dagegen diejenigen, für die die Medien geradezu ein Monopol als Informationsquelle besitzen und die außerhalb der persönlichen Reichweite liegen (z.B. internationale Beziehungen, nationale Politik). Themenstrukturierungseffekte werden vor allem für unaufdringliche Themen nachgewiesen.
Die Vielzahl der empirischen Studien typologisiert McCombs danach, ob l. bei der Auswertung der Medien ein Thema (single issue) oder mehrere Themen (set of issues) berücksichtigt wurden und ob 2. jeweils Durchschnittswerte von Publikums- und Medienanalyse einander zugeordnet wurden (aggregate data) oder die direkte Beziehung Medium - Mediennutzer (individual data) analysiert wurde (vgl. Schenk, S.199).
Während die Pilotstudie wie auch viele andere Untersuchungen dem Modell der Ermittlung eines "set of issues" auf der Medienseite und der Zuordnung von "aggregate data" auf seiten des Publikums folgt, stehen bei neueren Studien zunehmend individuellere Daten im Vordergrund. So untersuchten z.B. Winter und Eyal (1981) Thematisierungseffekte für nur ein Thema - Bürgerrechte -, allerdings unter Rückgriff auf aggregierte Publikumsdaten. Diese gingen auf 27 Meinungsumfragen aus den Jahren 1954 bis 1976 zurück. Es wurde ein deutlicher Agenda-Setting-Effekt für das Thema Bürgerrechte nachgewiesen.
Im Mittelpunkt der Untersuchung stand jedoch die Frage nach der Zeitspanne, die zwischen Aufgreifen und Hervorhebung des Themas in der Berichterstattung und dem deutlichen Auftreten der Medienwirkung beim Publikum anzusetzen ist. Als optimale Zeitspanne wurden hier vier bis sechs Wochen vor der Publikumsbefragung festgestellt (vgl. Winter/Eyal, S. 381). Im Vorgriff auf die unten behandelten methodischen Fragestellungen und Probleme, vor denen die Agenda-Setting-Forschung steht, ist an diesem Beispiel bereits die Problematik der Bestimmung des Zeitrahmens der Inhaltsanalyse, insgesamt für das Nachvollziehen von kumulativen Medienwirkungen festzuhalten:
Die empirische Forschung hat fünf Zeitaspekte zu berücksichtigen (vgl. Ehlers 1983 a, S.180; Schenk, S. 210), und zwar
1. den Gesamtzeitraum der Untersuchung; 2. die Verzugszeit (time lag) zwischen Publikation eines Themas und dem Niederschlag in der Publikumsagenda (Problem des Beginns der Publikumsbefragung); 3. die Dauer der Medienberichterstattung (Auswertungszeitraum); 4. Dauer der Publikumsbefragung; 5. die optimale Wirkungsspanne zwischen der stärksten Beachtung eines Themas in den Medien und derjenigen des Publikums.
Da die Ergebnisse der Untersuchungen zur Verzugszeit und optimalen Wirkungsspanne unterschiedlich sind, kann der optimale Zeitrahmen für eine Agenda-Setting-Studie nicht pauschal geklärt werden. Er hängt vor allem vom unterschiedlichen Verlauf der "Karrieren" einzelner Themen ab.
3) Zur Weiterentwicklung der Agenda-Setting-Forschung
3.1 Methodische Fragen
Um die Kausalhypothese des Zusammenhangs der Medien- und Publikumsagenda zu verifizieren, wurden meist die per Inhaltsanalyse ermittelten Medienaussagen mit der durch Befragung erfaßten Publikumsagenda durch statistische Korrelationsmaße als Rangskalen verglichen. Rangkorrelationen können jedoch allenfalls Wechselbeziehungen, nicht aber Kausalrelationen aufdecken (vgl. Uekermann/Weiss, 5.72). Der im salience- und priorities-Modell implizierte Anspruch, nicht nur inhaltliche Übereinstimmungen, sondern auch Bewertungen, die Wichtigkeit von Themen und ihre Übertragung von Medien auf Rezipienten, zu erfassen, kann mittels Rangkorrelationen empirisch nicht verifiziert werden.
Diese Einsicht hat dazu geführt, daß zur Ermittlung der Publikumsdaten zunehmend "Panel-Designs" eingesetzt werden. Dabei werden dieselben Personen mehrmals - mindestens zweimal - befragt; für diese Zeitpunkte sind auch entsprechende Medienanalysen vorzunehmen. Durch diese Methode wird die Richtung der Kausalbeziehung zwischen Medien und Publikum korrekt bestimmt, da die Frage, ob die Medien- oder die Publikumsagenda zuerst da war, beantwortet werden kann (vgl. Schenk, 5.201). Eine endgültige Aussage über die Richtung des Kausalzusammenhangs kann durch die Anwendung der Methode der "cross-lagged-correlations" getroffen werden, bei der beide Variablen (Themenrangfolge der Medien und des Publikums) zu zwei Zeitpunkten gemessen werden. Kernannahme ist, daß ein Effekt mit einer vorherigen Ursache höher korrelieren muß als mit einer folgenden Ursache (vgl. Schenk, 5.202). Das bedeutet zur Überprüfung der Agenda-Setting-Hypothese, daß die Medienagenda vom Zeitpunkt 1 mit der Publikumsagenda vom Zeitpunkt 2 signifikant höher korrelieren muß als die Publikumsagenda vom Zeitpunkt 1 mit der Medienangenda vorn Zeitpunkt 2. Dann gilt als nachgewiesen, daß die Themenrangfolge in den Medien die Prioritäten des Publikums bewirkt hat und nicht umgekehrt (vgl. Ehlers 1983 a, 5.174).
Bei der Inhaltsanalyse der Medien werden zumeist der politische Teil der Tageszeitungen und der Nachrichtenmagazine sowie die Fernsehnachrichten ausgewertet. In der Studie von Winter und Eyal wurde, da es sich um eine Langzeitanalyse zu nur einem Thema handelte, nur die New York Times als landesweit repräsentative Zeitung ausgewertet. Wichtig ist auch, die formale Gewichtung der Themen (Plazierung, Überschrift, Länge der Artikel) zu berücksichtigen, da es um die Reflexion dieser 'salience' beim Publikum geht (vgl. Schenk, S. 203). Die Kategorienschemata sind in den meisten veröffentlichten Studien nicht aufgeschlüsselt, so daß eine detaillierte Kritik dazu nicht möglich ist (vgl. Ehlers 1983 a, 5.172).
3.2 Publikumsorientierte Ansätze
Die Vorstellung, daß Agenda-Setting ein universeller, nahezu unabhängig von individuellen Merkmalen des Publikums und Besonderheiten der Medien und ihrer Aussagen wirkender Prozeß sei, wurde schon früh aufgegeben (vgl. Ehlers 1983 a, 5.174).
Die entscheidende Stelle für gravierende Modifizierungen und Differenzierungen des Konzepts wird in den Bedingungen gesehen, die die Mediennutzer selbst setzen (vgl. Uekermann/Weiss, 5.73). Im Übergang von der anfangs rein medienzentrierten zu einer rezipientenorientierten Sichtweise liegt der bedeutendste Wandel der Agenda-Setting-Hypothese: Publikumsfaktoren werden zumindest als intervenierende Variablen angesehen. Die radikalste Aufforderung zur Rezipientenorientierung beinhaltet die Studie von Erbring/Goldenberg/Miller (1980), auf die unten näher eingegangen wird.
Wichtigen Einfluß hat das Umfeld der Agenda-Setting-Forschung ausgeübt, in dem parallel rezipientenorientierte Wirkungsansätze entwickelt wurden, die mit in die Agenda-Setting-Forschung eingebunden wurden.
3.2.1) Der "Uses and Gratifications-Approach"
Die Annahmen des 'Nutzen und Belohnungs-Ansatzes' stellen zunächst nicht nur die Grundlagen der klassischen Medienwirkungsforschung, sondern auch die der Agenda-Setting-Hypothese in Frage: das kausale, medienzentrierte Wirkungsmodell (vgl. Uekermann/ Weiss, S. 73). Denn der Ansatz geht von der Grundvorstellung eines "aktiven Rezipienten" aus, der intentional und selektiv Medien nutzt (vgl. Schenk, S.382f.). Der Rezipient bestimmt, ob ein Kommunikationsprozeß stattfindet. Bezogen auf Wirkungsprozesse heißt das: Medien sind in dem Maße wirksam, in dem ihnen das Publikum eine Wirkung zugesteht. Das Wirkungszugeständnis hängt von den Bedürfnissen der Rezipienten ab; wenn sie über den Kontakt mit Massenmedien befriedigt werden können, ist deren Wirkungschance groß (vgl. Schulz 1982, 5.54). Kommunikation wird als symmetrischer Prozeß gesehen. Die spezifische Form von Wirkung, die der Rezipient bestimmt, verschafft ihm Nutzen und Gratifikation (individuelles Wohlbefinden, psychische Stabilität, Anpassung an Umweltanforderungen; vgl. Schulz 1982, S. 55). Was zunächst als Gegenposition zum "Power of the press"-Wirkungsansatz aussieht, hat in der Forschung jedoch zur Konvergenz vom 'Uses and Gratifications'-Ansatz und Agenda-Setting-Hypothese geführt: Zur Ermittlung der konkreten Medienwirkung ist im Rahmen der Gratifikationsforschung Agenda-Setting als intervenierendes Teilkonzpt eingeführt worden (vgl. Uekermann/Weiss, S.74); zum anderen ist das individuelle Bedürfnis nach politischer Orientierung, das eine Aufnahme der Medienagenda nach sich ziehen kann (vgl. Schenk, S. 386), als Motiv und Teilkonzept des "need for orientation" in die Agenda-Setting-Forschung aufgenommen worden.
3.2.2) Das Konzept vom "need for orientation" und der transaktionale Ansatz
Ausgehend vom 'Uses and Gratifications'- Ansatz liefert das Konzept vom Orientierungsbedürfnis, das Weaver und McCombs entwickelt haben, einen publikumsorientierten, psychologischen Erklärungsansatz für die Art und Weise und Intensität der Mediennutzung (vgl. Ehlers 1983 a, 5.178).
Drei Faktoren bestimmen danach die Medienzuwendung der Rezipienten: 1. Interesse an der Aussage, 2. Unsicherheit über das Thema und 3. der erforderliche Aufwand (effort required), um die Aussage zu empfangen. Da bezogen auf die amerikanische Gesellschaft dieser Aufwand, um sich zu informieren, als geringfügig unterstellt wird, bestimmt sich nach Weaver der Grad des Orientierungsbedürfnisses durch die Bedeutsamkeit (relevance) der Information und den Grad der Unsicherheit über den Gegenstand. Hypothese ist, daß hohes Orientierungsbedürfnis zu verstärkter Mediennutzung und zu einem ausgeprägteren Agenda-Setting-Effekt führe. Diese Hypothese ist vor allem von politischem - fast schon manipulatorischem - Interesse, speziell bezogen auf das Wählerverhalten: bei einem starken Orientierungsbedürfnis gehen die Medieneffekte laut Weaver über ein bloßes Verstärken von bereits vorhandenen Präferenzen hinaus. Die Medien "bringen den Wählern Themen und Gegenstände bei", die sie nicht nur zu Wahlkampfzeiten zur Bewertung der Kandidaten und Parteien benutzen (vgl. Schenk, S.224).
Neuere Überlegungen lassen McCombs auch ein "transaktionales" Modell als eine denkbare theoretische Weiterentwicklung sehen. Damit wäre eine endgültige Trennung vom "priorities"-Modell der spiegelbildlichen Medienwirkungen vollzogen (vgl. Ehlers 1983 a, S.171). Die Massenkommunikation und Medienwirkung werden im transaktionalen Modell als Prozeß der Wechselwirkung zwischen den Interessen des Kommunikators und des Rezipienten interpretiert; wie bei einem Geschäftsabschluss wird im Rahmen eines "fairen Handels" der für beide Seiten optimale Nutzen ausgehandelt (vgl. Schulz 1982, 5.55). Bei dieser Sichtweise handelt es sich gleichsam um die Einbeziehung verschiedener "Rückkoppelungsschleifen" (Schenk, S.385) in den Uses and Gratifications-Ansatz: beide Parteien erwarten, annähernd gleiche Werte auszutauschen.
Mit der Annahme, das Medienangebot bestimme bereits in einer früheren Phase im gewissen Umfang die spätere Mediennachfrage und umgekehrt, d.h. Medienangebote, die sich nicht an den Bedürfnissen des Publikums orientieren, können kaum mit Rezeption bzw. Wirkung rechnen, erhält man das "dynamisch-transaktionale" Modell (vgl. Schulz 1982, 5.55). Hier wird die Marketingorientierung der Gratifikationsforschung deutlich, die aber zugleich eine Modifikation der frühen Agenda-Setting-Hypothese herausfordert. Sobald das Bedürfnis des Publikums - oder was man dafür hält - ein Faktor des Medienangebots wird, kann einerseits nicht mehr von einseitigen Medienwirkungen ausgegangen werden, andererseits wird bei näherem Blick auf das Publikum deutlich, daß Thematisierung und Themenstrukturierung nicht nur durch Medien beeinflußt wird. Die große Bedeutung der interpersonalen Kommunikation für die Meinungsbildung veranlaßte Erbring/Goldenberg/Miller dazu, die "Themensensibilität" der Mediennutzer und deren Bedingungen in den Mittelpunkt der Agenda-Setting-Forschung zu rücken.
3.2.3) Themensensibilisierung und Umweltvariablen: Die Studie von Erbring/Goldenberg/Miller
Uekermann und Weiss bewerten die von Erbring/Goldenberg/Miller aufgestellte Forderung, das "Spiegelbildmodell" des Agenda-Setting generell durch ein "Modell publikumsgesteuerter Medieneffekte" zu ersetzen, als Reformulierung der ursprünglichen Agenda-Setting-Hypothese (vgl. Uekermann/Weiss, S.75).
In dem von Erbring u.a. entwickelten Modell sollen die Zuwendungsmotive der Rezipienten zum Themenangebot der Medien ("issue-specific-sensitivities") und deren interpersonales Kommunikationsverhalten in den Mittelpunkt der Analyse gestellt werden.
Die Forschung soll dabei reale Umweltvariablen ("real world cues") als Erklärung für unterschiedliche Wirkungschancen der Medien einbeziehen, die unterschiedlichen Zeit- und Wirkungsfaktoren jeweiliger Themenkarrieren berücksichtigen und die inhaltsanalytischen Daten der jeweils genutzten Medien den befragten Personen direkt zuordnen (vgl. Uekermann/ Weiss, S.74).
Erbring u.a. basieren ihre Untersuchungen auf Publikumsdaten aus einer nationalen Wahlanalyse von 1974. Diese beinhaltete ausführliche Befragungen über Zeitungslektüre- und Fernsehgewohnheiten sowie über politische Einstellungen bis hin zur üblichen Agenda-Setting-Frage nach "the most important Problem(s) facing this country", also nach den Themenprioritäten. Zur Ermittlung der 'Mediendaten wurden Inhaltsanalysen aller Artikel der ersten Seiten von 94 Tageszeitungen im Zeitraum von zehn Tagen bis drei Wochen vor den Publikumsinterviews durchgeführt. Diese Daten wurden den befragten Lesern der jeweiligen Zeitung direkt zugeordnet. Darüber hinaus wurden die lokalen Arbeitslosen- und Kriminalitätsraten von 1972 bis 1974 ermittelt und mit in die individuellen Daten einbezogen (vgl. Erbring u.a., S.20f.). Eine erste Überprüfung der "Spiegelbildwirkung" anhand sieben einzelner Hauptthemen der Zeitungen ergab, daß nur drei Themen "eine Spur" von Wirkung zeigten (vgl. S.23). Ausgehend von der These, Medienwirkungen hingen von Nutzungsgewohnheiten der Rezipienten und Inhalt der Artikel ab, verblieben die Themen Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Vertrauen in die Regierung als Gegenstand weiterer Untersuchungen (vgl. S.25). Gerade bei diesen Themen, bei denen überhaupt ein Medieneinfluß feststellbar war, zeigten sich ebenso reale Faktoren (Kriminalitätsrate und Arbeitslosigkeit am Ort) als intervenierende Variablen, die den Medieneffekt wieder abschwächten (vgl. auch Schenk, S. 222f.).
Mit der "mirror-image-hypothesis" und den üblichen statistischen Verfahren seien die Themenprioritäten nicht zu erklären, so das Ergebnis von Erbring/ Goldenberg/Miller; "we need to refine our conceptualization of the underlying model"(S.27).
Zur Neufassung der Agenda-Setting-Hypothese entwickeln sie vier Auslösungsfaktoren für mögliche Thematisierungseffekte (vgl. Erbring u.a., S.29; Uekermann/Weiss, 5.75):
1. Content effects - 'Medieninhalte -.
Wirkungen durch Medieninhalte werden primär bei Personen auftreten, die bereits für das Thema sensibilisiert sind.
2. Exposure effects - Mediennutzung -.
Die Mediennutzung wird für ein bestimmtes Thema beeinflußt:
a) bei vorhandener Themensensibilisierung, wenn das Thema in der Berichterstattung neu auftaucht,
b) bei nicht vorhandener Themensensibilisierung, wenn das Thema schon seit längerem Gegenstand der Berichterstattung ist,
c) gar nicht, wenn keine Änderung der Berichterstattung erfolgt.
3. Dependance on the media - Medienabhängigkeit -.
Die Medienwirkung (content- und exposure-effect) wird verstärkt bei ausschließlicher Abhängigkeit von der Medienberichterstattung als Informationsquelle; sie wird geschwächt bei Einbindung der Individuen in interpersonale Kommunikationszusammenhänge.
Sowohl die These der Bedeutung bereits vorhandener Themensensibilität als auch diejenige zur interpersonalen Kommunikation bestätigten sich in den Untersuchungen Erbrings u.a.. Beim Thema Arbeitslosigkeit waren die Medieneffekte bei subjektiver Betroffenheit (Arbeitslosigkeit in der Familie) deutlich signifikanter als bei nicht sensibilisierten Befragten (vgl. Erbring u.a., S. 36ff.). Es konnten auch Nutzungswirkungen bei nicht Betroffenen festgestellt werden (vgl. S.38). Bei informeller Kommunikation über das Thema waren dagegen Medieneffekte zu den Themen Kriminalität und Arbeitslosigkeit kaum noch feststellbar (vgl. S.41).
Erbring u.a. fordern daher dazu auf, von publikumsgesteuerten Medieneffekten auszugehen und verstärkt die Zusammenhänge zwischen Medien und Publikumssensibilisierung zu beachten (vgl. S.45).
Diese Studie verdeutlicht, daß die Unterstellung eines ausschließlich medienbedingten, generalisierbaren Thematisierungs- bzw. Themenstrukturierungseffekts konzeptionell nicht mehr sinnvoll und empirisch auch nicht mehr zu halten ist."(Uekermann/ Weiss, S.75).
4) Zur Integration der Agenda-Setting-Hypothese in die Theorie der Schweigespirale
Die von Elisabeth Noelle-Neumann entwickelte Theorie der Schweigespirale sowie die Diskussion darüber in der Kommunikationswissenschaft wären ein eigenes Thema und können daher hier nur andeutungsweise behandelt werden. Da jedoch für die Rezeption der Agenda-Setting-Forschung generell gilt, daß die Ausgangshypothese als Grundlage für weiterführende Überlegungen dient (vgl. Uekermann/Weiss, S.76) - obwohl die empirischen Ergebnisse kein einheitliches Bild abgeben -, soll ein solches Beispiel aufgegriffen werden.
Noelle-Neumann hat ausgehend von Luhmanns allgemeinen Gedanken eine vielbeachtete Theorie der öffentlichen Meinung entwickelt, in der "der Verweis auf die Thematisierungsfunktion der Massenmedien das entscheidende Bindeglied - sozusagen die Überbrückungstheorie (darstellt)." (Uekermann/Weiss, S.77). Ausgangspunkt der Theorie ist der Öffentlichkeitseffekt der Massenkommunikation, der die Wirkung der Medien im Zusammenhang mit der Annahme erklärt, daß Meinungsbildungsprozesse entscheidend durch Umweltbeobachtung bestimmt werden (vgl. Schulz 1982, S.64). Aus Furcht vor Isolierung in ihrer sozialen Umgebung orientieren sich Menschen an der Meinungsverteilung ihres Umfeldes und stützen sich dabei u.a., in politischen Fragen hauptsächlich, auf die in den Massenmedien dargestellten Meinungsverteilungen, die zum Anhaltspunkt für das allgemeine Meinungsklima werden. Zu der so präsentierten öffentlichen Meinung kann man sich öffentlich bekennen, ohne das Risiko sozialer Isolierung einzugehen, auch wenn die in den Medien verbreiteten Standpunkte von der tatsächlichen Meinungsverteilung in der Bevölkerung abweichen. Die Medien setzen einen sich selbst verstärkenden Prozeß in Gang„ einen Spiralprozeß, in dem sich im Laufe der Zeit die tatsächliche Meinungsverteilung der von den Massenmedien vorgegebenen anpaßt:
"Wer sieht, daß seine Meinung zunimmt, ist gestärkt, redet öffentlich, Iäßt die Vorsicht fallen. Wer sieht, daß seine Meinung an Boden verliert, verfällt in Schweigen. Indem die einen laut reden, öffentlich zu sehen sind, wirken sie stärker, als sie wirklich sind, die anderen schwächer, als sie wirklich sind. Es ergibt sich eine optische oder akustische Täuschung für die wirklichen Mehrheits-, die wirklichen Stärkeverhältnisse, und so stecken die einen zum Reden an, die anderen zum Schweigen, bis schließlich die eine Auffassung ganz untergehen kann." (Noelle-Neumann, S.142).
Die Agenda-Setting-Hypothese wird dabei zu jener Überbrückung zwischen den medienimmanenten und publikumsbezogenen Theorieteilen, "durch die die spiralförmige Ausbreitung eines Meinungsklimas von den Journalisten und Massenmedien zum Medienpublikum überhaupt erst erklärbar wird."(Uekermann/Weiss, S.77). Auch die Schweigespiralen-Theorie hat wesentlich das Anfang der siebziger Jahre propagierte neue medienzentrierte Paradigma der Medienwirkungsforschung mitgeprägt - Noelle-Neumanns programmatischer Aufsatz von 1973 hatte den Titel "Return to the Concept of Powerful Mass Media" (vgl. Schenk, S.335 und Fn.32).
Angesichts der Entwicklung und auch Diffusion in der Agenda-Setting-Forschung stellen Uekermann und Weiss die Geltung der Hypothese als Theorieteil oder gar -grundlage in Frage. Die detaillierte Diskussion innerhalb der Agenda-Setting-Forschung sei auch eine Kritik eines so umfassenden Entwurfs wie der Schweigespiralen-Theorie (vgl. Uekermann/Weiss, S.77).
Allgemein läßt sich zum Diskussionsstand der Medienwirkungsforschung festhalten, daß "die Komplexität des Gegenstands, den die Kommunikationsforschung untersucht, eine Konkurrenz verschiedener Theorien um die zu erklärende Varianz geradezu erwarten (läßt)." (Schenk, S.335). Bezogen auf die Agenda-Setting-Forschung bleibt als Ergebnis, daß Medienwirkungen einer Reihe von "kontingenten Bedingungen" unterliegen: Medien- und Publikumsvariablen, unterschiedlichen Zeitrahmen und Realitätsfaktoren der Umwelt (vgl. Schenk, S.228). Unter bestimmten Bedingungen - nur in dieser allgemeinen Formulierung läßt sich die Agenda-Setting-Hypothese überhaupt halten - beeinflussen die Medien den Themenstrukturierungsprozeß der öffentlichen Meinung.
Literaturverzeichnis
Becker, Lee B. 1981
The Mass Media and Citizen Assessment of Issue Importance: A Reflection on Agenda-Setting Research, in: Saxer, Ulrich (Hrsg.), Politik und Kommunikation, München 1983, S. 53-68
Ehlers, Renate 1983 a
Themenstrukturierung durch Massenmedien
Zum Stand der empirischen Agenda-Setting-Forschung in: Publizistik, Jahrgang 28, H.2 1983, S.167-186
Dies., 1983 b
Thematisierung durch Medien?
Zum Verhältnis von Agenda-Setting-Forschung und praktischer Politik, in: Rundfunk und Fernsehen, 31. Jahrgang 1983 3-4, S. 319-325
Erbring, Lutz/Goldenberg, Edie N./Miller, Arthur H. 1980
Front Page News and Real World Cues: A New Look at Agenda-Setting by the Media
in: American Journal of Political Science, Vol.24, No I 1980, S. 16-49
Habermas, Jürgen 1962
Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt am Main 1990
Luhmann, Niklas 1970
Öffentliche Meinung in: Politische Vierteljahresschrift, Nr.11 1970, 5.2-28
McCombs, Maxwell E. /Shaw, Donald E. 1972
The Agenda-Setting-Function of Mass Media
in: Public Opinion Quarterly, Vol. 36 (1972) No.2, S.176-187
Noelle-Neumann, Elisabeth 1981
Neue Forschungen im Zusammenhang mit der Schweigespiralen-Theorie in: Saxer, Ulrich (Hrsg.), Politik und Kommunikation, München 1983, 5.133-144
Schenk, Michael 1987
Medienwirkungsforschung, Tübingen
Schulz, Winfried 1982
Ausblick am Ende des Holzwegs
Eine Übersicht über die Ans ätze zur neuen Medienwirkungsforschung in: Publizistik, Jahrgang 27 1982, H.1-2, S. 49-73
Ders. , 1987
Wirkungsmodelle der Medienwirkungsforschung
in: Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.), Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik Deutschland, Weinheim 1987, 5.83-100
Uekermann, Heinz R./Weiss, Hans-Jürgen 1981
Agenda-Setting: Zurück zu einem medienzentrierten Wirkungskonzept?
in: Saxer, Ulrich (Hrsg.), Politik und Kommunikation, München 1983, S.69-79
Weaver, David H. 1982
Media Agenda-Setting and Media-Manipulation
in: Mass Communication Review Yearbook, Vol.3 (1932), Beverly Hills, London, S. 537-554
Winter, James P./Eyal, Chaim H. 1981
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus dieser Veröffentlichung?
Der Hauptfokus dieser Veröffentlichung liegt auf der Untersuchung der Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik, insbesondere im Hinblick auf die öffentliche Meinung und den Agenda-Setting-Effekt.
Was wird im ersten Abschnitt besprochen?
Der erste Abschnitt behandelt die öffentliche Meinung und den theoretischen Bezugsrahmen der Medienwirkungsforschung in der Bundesrepublik, unter Bezugnahme auf Jürgen Habermas' "Strukturwandel der Öffentlichkeit" und Niklas Luhmanns Perspektive.
Was ist das Konzept des Agenda-Setting-Effekts und wie wird es in der Veröffentlichung behandelt?
Das Konzept des Agenda-Setting-Effekts wird als der Einfluss der Medien auf die Wahrnehmung der Wichtigkeit politischer Themen durch die Bevölkerung beschrieben. Die Veröffentlichung behandelt die Pilotstudie von McCombs und Shaw, verschiedene Wirkungs- und Forschungsmodelle, und die Weiterentwicklung der Agenda-Setting-Forschung.
Welche methodischen Fragen werden in Bezug auf die Agenda-Setting-Forschung aufgeworfen?
Es werden methodische Fragen wie die Validierung der Kausalhypothese, die Verwendung von Panel-Designs zur Bestimmung der Kausalbeziehung und die Bedeutung der Inhaltsanalyse der Medien diskutiert.
Was sind publikumsorientierte Ansätze in der Agenda-Setting-Forschung?
Publikumsorientierte Ansätze betrachten die Bedingungen, die Mediennutzer selbst setzen, und beziehen rezipientenorientierte Wirkungsansätze wie den "Uses and Gratifications-Approach" und das Konzept vom "need for orientation" mit ein.
Was ist die Bedeutung der Studie von Erbring/Goldenberg/Miller?
Die Studie von Erbring/Goldenberg/Miller betont die Bedeutung der Themensensibilisierung der Mediennutzer und die Einbeziehung von Umweltvariablen in die Agenda-Setting-Forschung, und fordert publikumsgesteuerte Medieneffekte.
Wie wird die Agenda-Setting-Hypothese in die Theorie der Schweigespirale integriert?
Die Agenda-Setting-Hypothese wird als Bindeglied in Elisabeth Noelle-Neumanns Theorie der Schweigespirale betrachtet, die erklärt, wie die Massenmedien die Meinungsverteilung beeinflussen und zur Anpassung der tatsächlichen Meinungsverteilung an die von den Medien vorgegebenen Meinungen führen.
Welche Schlussfolgerungen werden in Bezug auf die Medienwirkungsforschung gezogen?
Es wird festgestellt, dass Medienwirkungen einer Reihe von kontingenten Bedingungen unterliegen, wie z.B. Medien- und Publikumsvariablen, unterschiedlichen Zeitrahmen und Realitätsfaktoren der Umwelt. Unter bestimmten Bedingungen beeinflussen die Medien den Themenstrukturierungsprozess der öffentlichen Meinung.
Welche Literatur wird in der Veröffentlichung zitiert?
Die Veröffentlichung zitiert eine Reihe von Werken, darunter Arbeiten von Becker, Ehlers, Erbring/Goldenberg/Miller, Habermas, Luhmann, McCombs/Shaw, Noelle-Neumann, Schenk, Schulz, Uekermann/Weiss, Weaver und Winter/Eyal.
- Quote paper
- Heike Obermanns (Author), 2004, Die Entwicklung der Agenda-Setting-Hypothese in der Medienwirkungsforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108878