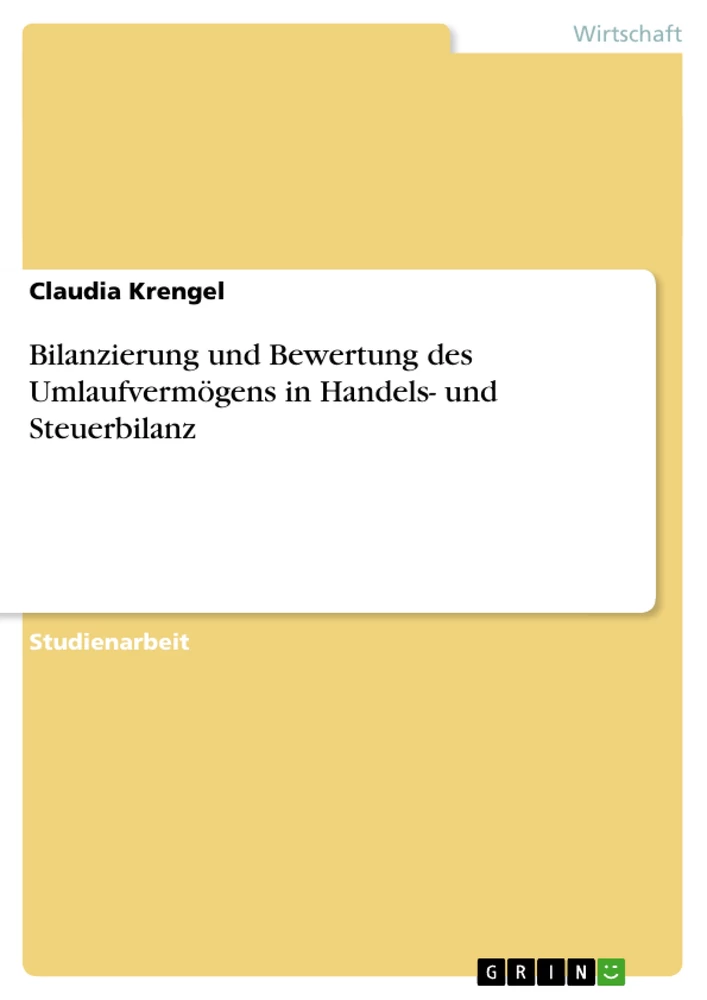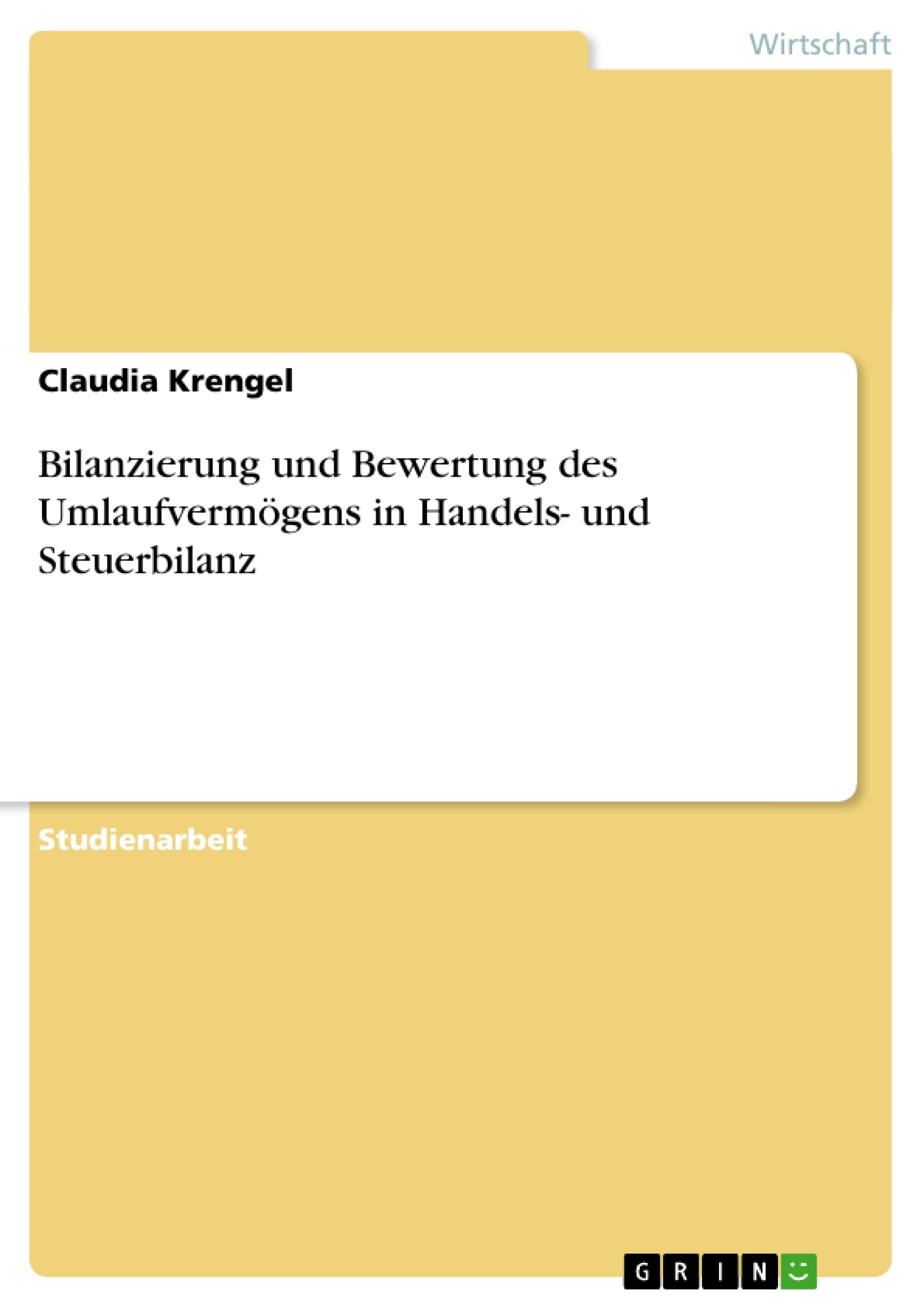Gemäß § 238 HGB sind Kaufleute1 „verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ersichtlich zu machen (...).“2 Diese Buchführung stellt die Grundlage für die Erstellung einer Bilanz3, die innerhalb dieser Seminararbeit in ihren Ausprägungen ‚Handelsbilanz‘4 und ‚Steuerbilanz‘5 behandelt wird. Im Hinblick auf die Umfangsbeschränkung dieser Arbeit werden diese Grundlagen – genauer: die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (insbes. strenges Niederstwertprinzip), die Grundlagen der Bilanzierung sowie die Prinzipien der Bilanzierung – als bekannt vorausgesetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verzahnung von Handels- und Steuerbilanz
- Das Maßgeblichkeitsprinzip
- Umgekehrte Maßgeblichkeit
- Das Umlaufvermögen
- Definition des Umlaufvermögens
- Gliederung des Umlaufvermögens
- Bilanzierung des Umlaufvermögens
- Bilanzierungsfähigkeit
- Bilanzierungsgebote
- Bilanzierungsverbote
- Bilanzierungswahlrechte und -hilfen
- Bewertung des Umlaufvermögens
- Bewertungsgrundsätze
- Identitätsprinzip
- Fortführungsprinzip
- Stichtagsprinzip
- Einzelbewertungsprinzip
- Vorsichtsprinzip
- Abgrenzungsprinzip
- Stetigkeitsprinzip
- Bewertungsvereinfachungsverfahren
- Festwertverfahren
- Gruppenbewertung
- Verbrauchsfolgeverfahren
- Wertkategorien
- Anschaffungs- und Herstellungskosten
- Anschaffungskosten
- Herstellungskosten
- Stichtagswert
- Teilwert
- Anschaffungs- und Herstellungskosten
- Wertkorrekturen
- Abschreibungen
- Teilwertabschreibungen
- Wertaufholung
- Bewertungsgrundsätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bilanzierung und Bewertung des Umlaufvermögens in Handels- und Steuerbilanzen. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen beiden Bilanzformen aufzuzeigen und die relevanten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu erläutern.
- Verzahnung von Handels- und Steuerbilanz (Maßgeblichkeitsprinzip und umgekehrte Maßgeblichkeit)
- Definition und Gliederung des Umlaufvermögens
- Bilanzierungsgrundsätze des Umlaufvermögens
- Bewertungsgrundsätze und -verfahren des Umlaufvermögens
- Wertkorrekturen (Abschreibungen, Teilwertabschreibungen, Wertaufholung)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Bilanzierung und Bewertung des Umlaufvermögens ein und stellt den Zusammenhang zwischen Buchführung, Handelsbilanz und Steuerbilanz her. Sie betont die Bedeutung ordnungsgemäßer Buchführung gemäß HGB und skizziert den Rahmen der Arbeit, wobei grundlegende Kenntnisse der GoB vorausgesetzt werden.
Verzahnung von Handels- und Steuerbilanz: Dieses Kapitel analysiert das Verhältnis zwischen Handels- und Steuerbilanz, insbesondere das Maßgeblichkeitsprinzip (§ 5 Abs. 1 Satz 1 HGB). Es erläutert die formelle Maßgeblichkeit, bei der die in der Handelsbilanz gewählten Ansätze grundsätzlich in die Steuerbilanz übernommen werden, sowie Ausnahmen von diesem Prinzip aufgrund zwingender steuerrechtlicher Vorschriften. Der Begriff der umgekehrten Maßgeblichkeit wird ebenfalls eingeführt, wobei die Gewinnermittlungswahlrechte in der Steuerbilanz an die in der Handelsbilanz getroffenen Entscheidungen gebunden sind.
Das Umlaufvermögen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und der Gliederung des Umlaufvermögens. Es legt die Grundlage für die folgenden Kapitel zur Bilanzierung und Bewertung, indem es die verschiedenen Bestandteile des Umlaufvermögens beschreibt und systematisiert. Dies beinhaltet eine klare Abgrenzung zu anderen Vermögenspositionen und schafft somit ein Verständnis für die Spezifika des Umlaufvermögens.
Bilanzierung des Umlaufvermögens: Dieses Kapitel beschreibt die Regeln der Bilanzierung des Umlaufvermögens, inklusive der Bilanzierungsfähigkeit, -gebote, -verbote und -wahlrechte. Es analysiert die rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Möglichkeiten der Bilanzierung, um ein umfassendes Bild der zulässigen Vorgehensweisen zu geben und die jeweiligen Konsequenzen zu beleuchten. Die Komplexität der Bilanzierung wird verdeutlicht und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Anwendung der gesetzlichen Regelungen hervorgehoben.
Bewertung des Umlaufvermögens: Dieses Kapitel behandelt die Bewertung des Umlaufvermögens, beginnend mit den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen wie dem Identitäts-, Fortführungs-, Stichtags-, Einzelbewertungs-, Vorsichts-, Abgrenzungs- und Stetigkeitsprinzip. Es analysiert im Detail verschiedene Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren, Gruppenbewertung, Verbrauchsfolgeverfahren) und Wertkategorien (Anschaffungs- und Herstellungskosten, Stichtagswert, Teilwert). Schließlich beleuchtet es Wertkorrekturen wie Abschreibungen, Teilwertabschreibungen und Wertaufholung.
Schlüsselwörter
Handelsbilanz, Steuerbilanz, Maßgeblichkeitsprinzip, Umgekehrte Maßgeblichkeit, Umlaufvermögen, Bilanzierung, Bewertung, Bewertungsgrundsätze, Bewertungsverfahren, Wertkorrekturen, Abschreibungen, HGB, EStG.
FAQ: Bilanzierung und Bewertung des Umlaufvermögens
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit der Bilanzierung und Bewertung des Umlaufvermögens in Handels- und Steuerbilanzen. Sie erläutert die Zusammenhänge zwischen beiden Bilanzformen und beschreibt die relevanten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze. Der Inhalt umfasst eine Einleitung, Kapitel zur Verzahnung von Handels- und Steuerbilanz, zum Umlaufvermögen selbst, zu dessen Bilanzierung und schließlich zu dessen Bewertung inklusive Wertkorrekturen. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter erleichtern den Zugriff auf die Informationen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert das Maßgeblichkeitsprinzip und die umgekehrte Maßgeblichkeit im Verhältnis zwischen Handels- und Steuerbilanz. Die Definition und Gliederung des Umlaufvermögens werden ebenso erklärt wie die Bilanzierungsgrundsätze (Bilanzierungsfähigkeit, -gebote, -verbote und -wahlrechte). Ein Schwerpunkt liegt auf den Bewertungsgrundsätzen (Identitätsprinzip, Fortführungsprinzip etc.) und -verfahren (Festwertverfahren, Gruppenbewertung, Verbrauchsfolgeverfahren) sowie den Wertkategorien (Anschaffungs- und Herstellungskosten, Stichtagswert, Teilwert) und Wertkorrekturen (Abschreibungen, Teilwertabschreibungen, Wertaufholung).
Welche Bewertungsgrundsätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Reihe von wichtigen Bewertungsgrundsätzen, darunter das Identitätsprinzip, das Fortführungsprinzip, das Stichtagsprinzip, das Einzelbewertungsprinzip, das Vorsichtsprinzip, das Abgrenzungsprinzip und das Stetigkeitsprinzip. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für die korrekte Bewertung des Umlaufvermögens.
Welche Bewertungsverfahren werden erläutert?
Die Arbeit erläutert verschiedene Bewertungsvereinfachungsverfahren, um die Bewertung des Umlaufvermögens zu erleichtern. Hierzu gehören das Festwertverfahren, die Gruppenbewertung und das Verbrauchsfolgeverfahren. Die Wahl des passenden Verfahrens hängt von den spezifischen Umständen ab.
Wie werden Wertkorrekturen im Zusammenhang mit dem Umlaufvermögen behandelt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Arten von Wertkorrekturen, die im Zusammenhang mit dem Umlaufvermögen notwendig sein können. Dies umfasst Abschreibungen, Teilwertabschreibungen und Wertaufholung. Diese Korrekturen stellen sicher, dass das Umlaufvermögen zu seinem tatsächlichen Wert in der Bilanz ausgewiesen wird.
Welches Verhältnis besteht zwischen Handels- und Steuerbilanz?
Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis zwischen Handels- und Steuerbilanz im Detail, insbesondere das Maßgeblichkeitsprinzip (§ 5 Abs. 1 Satz 1 HGB) und die umgekehrte Maßgeblichkeit. Es wird erklärt, wie die Ansätze aus der Handelsbilanz in die Steuerbilanz übernommen werden und welche Ausnahmen aufgrund zwingender steuerrechtlicher Vorschriften bestehen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Handelsbilanz, Steuerbilanz, Maßgeblichkeitsprinzip, Umgekehrte Maßgeblichkeit, Umlaufvermögen, Bilanzierung, Bewertung, Bewertungsgrundsätze, Bewertungsverfahren, Wertkorrekturen, Abschreibungen, HGB, EStG.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Personen, die sich mit der Bilanzierung und Bewertung des Umlaufvermögens auseinandersetzen müssen, beispielsweise Studierende der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter. Grundlegende Kenntnisse der GoB (Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung) werden vorausgesetzt.
- Quote paper
- Claudia Krengel (Author), 1999, Bilanzierung und Bewertung des Umlaufvermögens in Handels- und Steuerbilanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10885