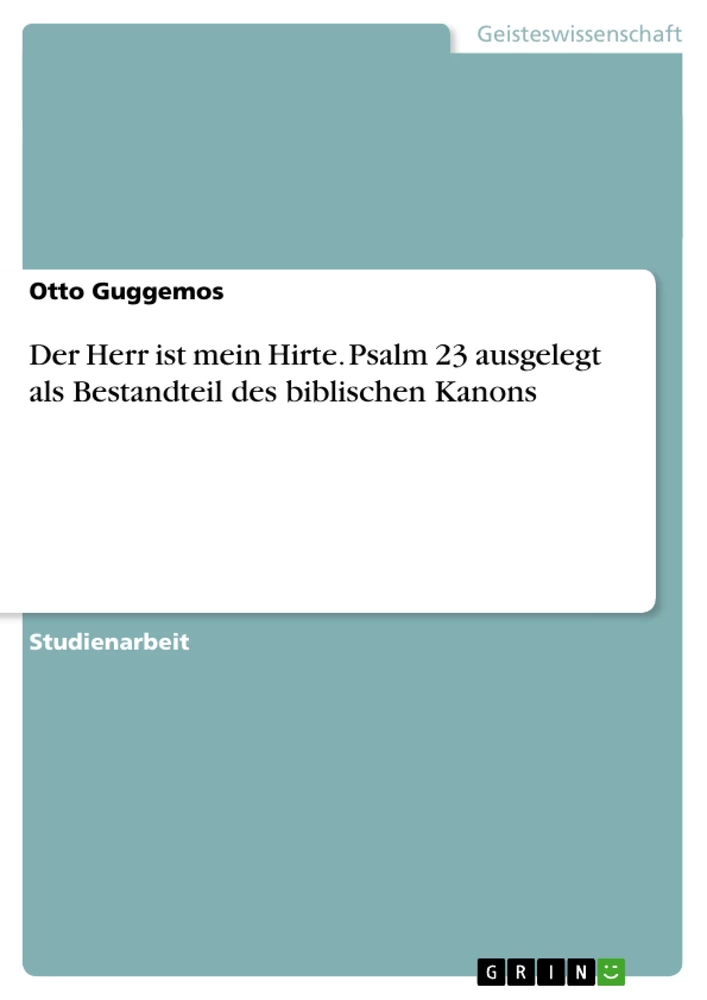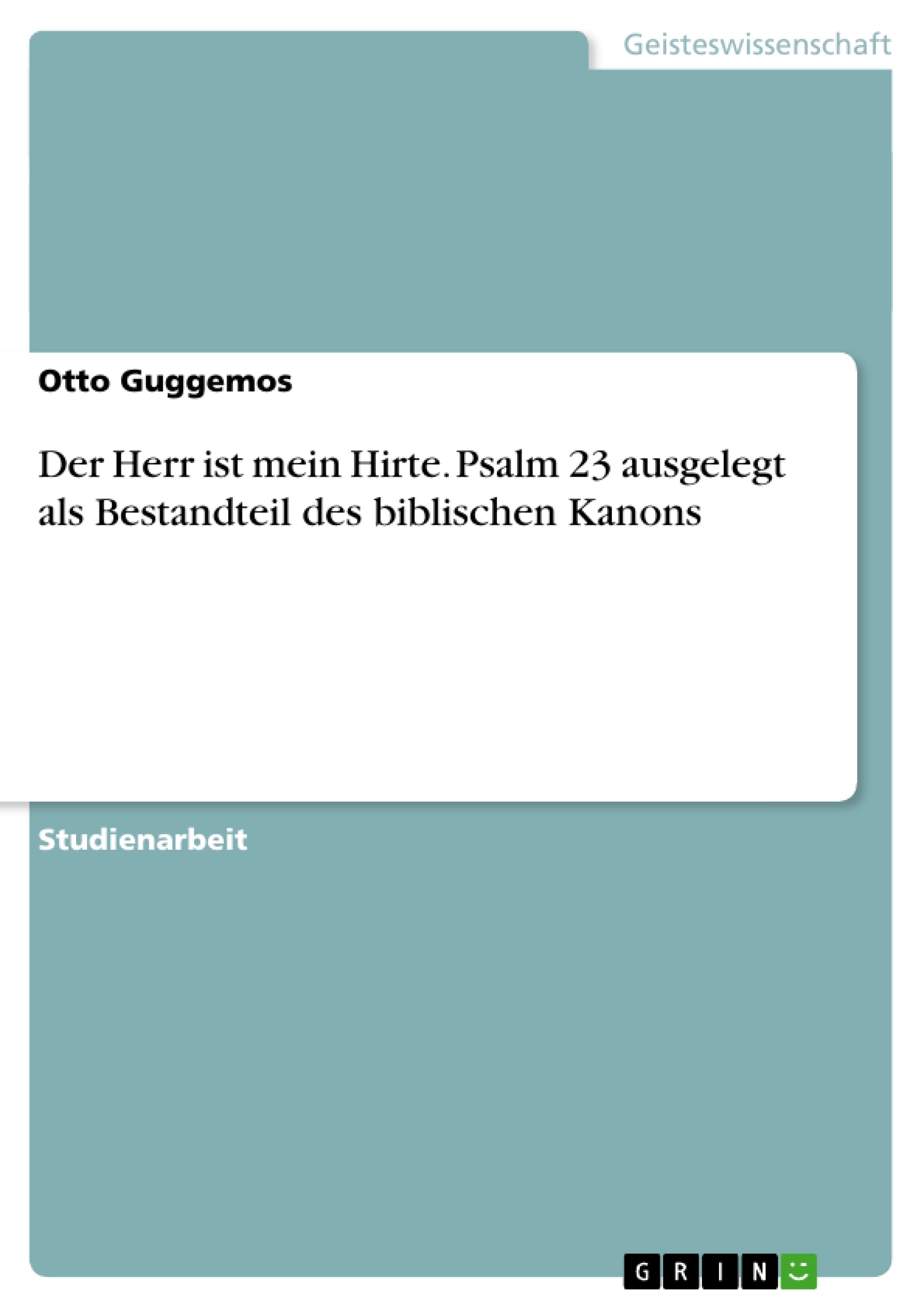"Immer wieder wird die Praxis- und Lebensferne der theologischen Ausbildung beklagt. Weite
Kreise von Gemeindegliedern bestätigen diesen Eindruck. Ein tiefes Mißtrauen gegenüber der
Universitätstheologie ist keine Seltenheit in unseren Gemeinden. Das Unbehagen konzentriert sich
dabei besonders auf die historisch-kritische Methode. Für viele Gemeindeglieder ist sie der
Inbegriff akademischen Hochmuts gegenüber der Autorität der Heiligen Schrift, während sie an den
Universitäten hierzulande die Standardmethode ist. Nachdem die Bibel in der Hand des Laien einst
mitverantwortlich für die Schlagkraft der Reformation war, entsteht durch moderne
wissenschaftliche Exegese vielfach wieder eine faktische Ausgrenzung des Laien vom
Schriftgebrauch. Vom Religionsuntericht bis hinauf in die Methodenseminare der
Bibelwissenschaften wird darüber gestritten. Zwischen der historisch-kritischen Methode und
sowohl der persönlichen Frömmigkeit als auch der systematischen Theologie wird eine Spannung
empfunden."
In dem Aufsatz "Scriptura sui Interpres" habe ich mich auf die Suche nach einer exegetischen
Methode gemacht, die die Gräben überbrücken soll, indem sie von einer dezidiert christlichen Lehre
von der Heiligen Schrift ausgeht, anstatt die Schriften bloß als historische Dialogpartner
aufzufassen. Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, diese Methode am Beispiel von Psalm 23
durchzuführen. Es geht mir darum, zu zeigen, dass synchrone Auslegung im Kontext des Kanons,
wie sie meist in Bibelkreisen betrieben wird, in klare methodische Schritte zergliedern lässt, so dass
sie dem Anspruch der Wissenschaftlichkeit genügt.
Einiges wurde in der praktischen Anwendung neu überdacht. Folgende Aspekte sind methodisch
besonders wichtig: Die Endgestalt des Textes ist verbindlich; Er kann nur im Horizont des
biblischen Gesamtzeugnisses richtig verstanden werden. Das führte zu einer Schwerpunktsetzung
zugunsten synchroner Auslegung. Diachrone Auslegung hat ihren Stellenwert, ist aber dem
Verstehen untergeordnet. Sie wird umso wichtiger, je mehr Bedeutung historische Daten für den
Text haben. Ein weiterer Arbeitsschritt behandelt die Rolle des Textes im Gesamtbild der
biblischen Theologie. Dies ist auch ein Brückenschlag zur systematischen Theologie. Die
Schlusszusammenfassung erfolgt in Form eines Ausblicks auf die praktische Theologie, denn in
dem Text will der lebendige Gott ja nicht nur Verstehen, sondern auch Glauben wecken. [..]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Textanalyse
- Einbettung in den Textzusammenhang
- Abgrenzung
- Übersetzung und Textkritik
- Übersetzung
- Semantische und textkritische Anmerkungen
- Poetische Analyse
- Erklärung der Begriffe und Bilder
- Jhwh als Hirte
- Jhwh als Gastgeber
- Metrum und Komposition
- Gattung und Sitz im Leben
- Historische Rekonstruktion
- Literarkritik
- Zeit, Verfasser und Redaktion
- Psalm 23 im Gesamtkontext der Heiligen Schrift
- Altes Testament (Motiv- und Traditionsanalyse)
- Rückblick auf das Grunddatum von Israels Erwählung und Errettung
- Psalm 23 im Rahmen der Gottesbeziehung Israels
- Bezüge zur David-Überlieferung
- Profetie und eschatologischer Ausblick
- Neues Testament: Jesus der gute Hirte und endzeitliche Gastgeber
- Die Bedeutung von Psalm 23 für zeitgenössischen christlichen Glauben
- Literatur
- Anhang: Scriptura sui Interpres
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Psalm 23 im Kontext des biblischen Kanons, indem sie eine exegetische Methode anwendet, die synchrone Auslegung mit dem Gesamtverständnis der Heiligen Schrift verbindet. Ziel ist es, zu demonstrieren, dass eine solche Auslegungsweise wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und die Kluft zwischen akademischer Theologie und Gemeindeverständnis überbrücken kann.
- Synchrone Auslegung von Psalm 23 im kanonischen Kontext
- Vergleichende Analyse verschiedener Auslegungsmethoden (historisch-kritisch vs. kanonisch)
- Die Rolle von Psalm 23 in der biblischen Theologie
- Bedeutung des Psalms für den christlichen Glauben
- Die Beziehung zwischen Gott und Israel im Alten Testament
Zusammenfassung der Kapitel
Vorwort: Das Vorwort beschreibt die Diskrepanz zwischen akademischer Theologie und Gemeindeverständnis, insbesondere bezüglich der historisch-kritischen Methode. Der Autor präsentiert seinen Aufsatz "Scriptura sui Interpres" als Grundlage für eine alternative, kanonisch orientierte Exegese, die die Brücke zwischen beiden Perspektiven schlagen soll. Die vorliegende Arbeit am Beispiel von Psalm 23 soll diese Methode exemplarisch verdeutlichen und ihre wissenschaftliche Fundiertheit aufzeigen. Besondere methodische Schwerpunkte liegen auf der Verbindlichkeit der Endgestalt des Textes, der Bedeutung des biblischen Gesamtzeugnisses und der Priorisierung synchroner Auslegung gegenüber diachroner Interpretation.
1. Textanalyse: Dieses Kapitel beginnt mit der Einbettung von Psalm 23 in den Kontext des Psalters, der als Gebetsbuch Israels verstanden wird. Die Nähe zu Psalm 22 und 24 wird hervorgehoben, wobei Psalm 22 als eine Art Vorrede zu Psalm 23 interpretiert wird. Die Abgrenzung des Psalms wird durch seine Überschriften und seine inhaltliche Geschlossenheit definiert. Es folgt eine detaillierte Übersetzung und textkritische Analyse, die verschiedene semantische und textkritische Fragen beleuchtet, wie z.B. die Bedeutung der Überschrift, einzelner Wörter und Satzstrukturen. Die Poetische Analyse befasst sich mit Begriffen, Bildern, Metrum, Komposition sowie der Gattung und dem Sitz im Leben des Psalms.
2. Historische Rekonstruktion: Dieses Kapitel widmet sich der literarkritischen Analyse von Psalm 23, untersucht die Fragen nach Entstehungszeit, Verfasser und Redaktion. Durch die Berücksichtigung literaturwissenschaftlicher Methoden und den Vergleich mit anderen Texten sollen so Aufschlüsse über die Entstehung und Entwicklung des Psalms gewonnen werden. Der Fokus liegt auf den historischen und literarischen Hintergründen des Psalms und seiner Entwicklung über die Zeit.
3. Psalm 23 im Gesamtkontext der Heiligen Schrift: Dieser Abschnitt untersucht Psalm 23 im Kontext des Alten und Neuen Testaments. Im Alten Testament wird der Psalm in Bezug zu Israels Erwählung, Gottesbeziehung und der David-Tradition gesetzt. Die Analyse konzentriert sich auf Motive und Traditionen, die im Psalm auftauchen und in anderen alttestamentlichen Texten wiederkehren. Die Betrachtung des Neuen Testaments fokussiert auf die Figur des "guten Hirten" Jesus und deren Bezug zu Psalm 23, sowie die eschatologische Perspektive des Gastmahles.
Schlüsselwörter
Psalm 23, Kanon, Exegese, synchrone Auslegung, historisch-kritische Methode, biblische Theologie, Gottesbeziehung, Hirtenmetapher, David, Altes Testament, Neues Testament, Gemeindeverständnis, wissenschaftliche Exegese.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Psalm 23 im kanonischen Kontext
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Psalm 23 im Kontext des gesamten biblischen Kanons. Sie verwendet eine exegetische Methode, die synchrone Auslegung mit dem Gesamtverständnis der Heiligen Schrift verbindet, um die Bedeutung des Psalms für den christlichen Glauben zu untersuchen und die Kluft zwischen akademischer Theologie und Gemeindeverständnis zu überbrücken.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine kanonisch orientierte Exegese, die die Endgestalt des Textes, das biblische Gesamtzeugnis und die synchrone Auslegung priorisiert. Sie vergleicht diese Methode mit der historisch-kritischen Methode und analysiert Psalm 23 synchron im kanonischen Kontext. Die Analyse beinhaltet Textkritik, poetische Analyse (Begriffe, Bilder, Metrum, Komposition, Gattung und Sitz im Leben), literarkritische Analyse (Entstehungszeit, Verfasser, Redaktion) sowie Motiv- und Traditionsanalysen im Alten und Neuen Testament.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die synchrone Auslegung von Psalm 23, vergleicht verschiedene Auslegungsmethoden, analysiert die Rolle von Psalm 23 in der biblischen Theologie und seine Bedeutung für den christlichen Glauben. Weitere Schwerpunkte sind die Beziehung zwischen Gott und Israel im Alten Testament, die Hirtenmetapher, die David-Tradition und die eschatologische Perspektive des Gastmahles im Neuen Testament.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Textanalyse (Einbettung, Abgrenzung, Übersetzung, Textkritik, poetische Analyse), historischen Rekonstruktion (Literarkritik, Zeit, Verfasser, Redaktion), Psalm 23 im Gesamtkontext der Heiligen Schrift (Altes Testament: Motiv- und Traditionsanalyse, Rückblick auf Israels Erwählung, Psalm 23 im Rahmen der Gottesbeziehung Israels, Bezüge zur David-Überlieferung, Prophetie und eschatologischer Ausblick; Neues Testament: Jesus der gute Hirte und endzeitliche Gastgeber), sowie die Bedeutung von Psalm 23 für den zeitgenössischen christlichen Glauben. Ein Vorwort und ein Anhang ("Scriptura sui Interpres") runden die Arbeit ab.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es zu zeigen, dass eine kanonisch orientierte Exegese wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und die Brücke zwischen akademischer Theologie und Gemeindeverständnis schlagen kann. Psalm 23 dient als Beispiel für die Anwendung dieser Methode.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Psalm 23, Kanon, Exegese, synchrone Auslegung, historisch-kritische Methode, biblische Theologie, Gottesbeziehung, Hirtenmetapher, David, Altes Testament, Neues Testament, Gemeindeverständnis, wissenschaftliche Exegese.
Wie wird Psalm 23 im Alten Testament interpretiert?
Im Alten Testament wird Psalm 23 in Bezug auf Israels Erwählung und Errettung, die Gottesbeziehung Israels, die David-Tradition, sowie prophetische und eschatologische Aspekte analysiert. Die Arbeit untersucht Motive und Traditionen, die im Psalm auftauchen und in anderen alttestamentlichen Texten wiederkehren.
Wie wird Psalm 23 im Neuen Testament interpretiert?
Im Neuen Testament wird der Fokus auf Jesus als den "guten Hirten" und den Bezug zu Psalm 23 gelegt, sowie auf die eschatologische Perspektive des Gastmahles.
- Quote paper
- Otto Guggemos (Author), 1999, Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 ausgelegt als Bestandteil des biblischen Kanons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108851