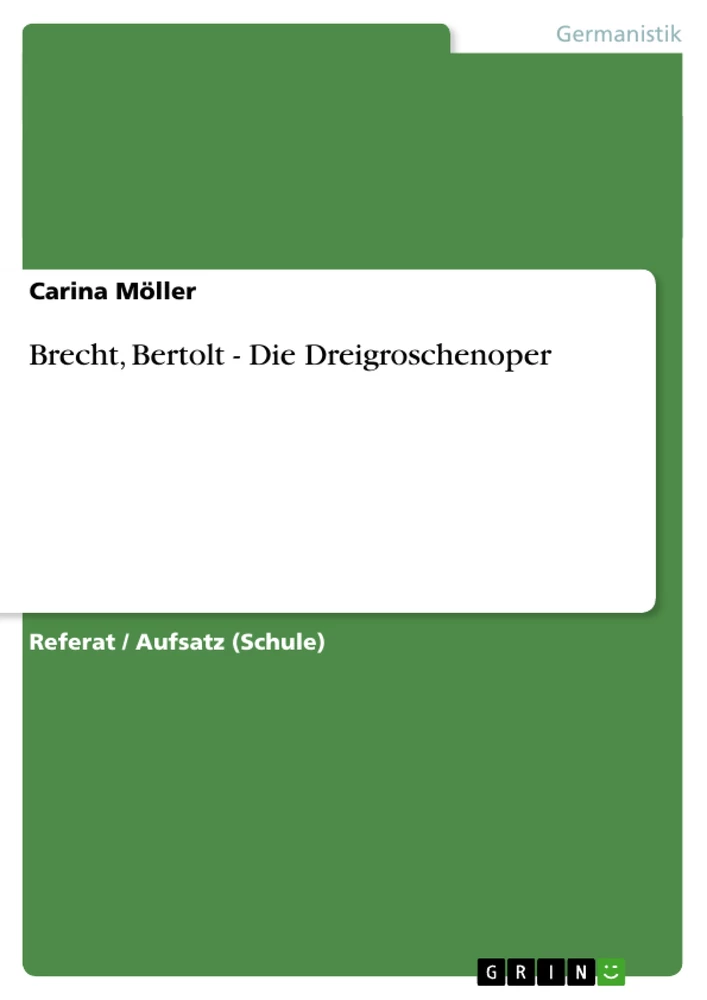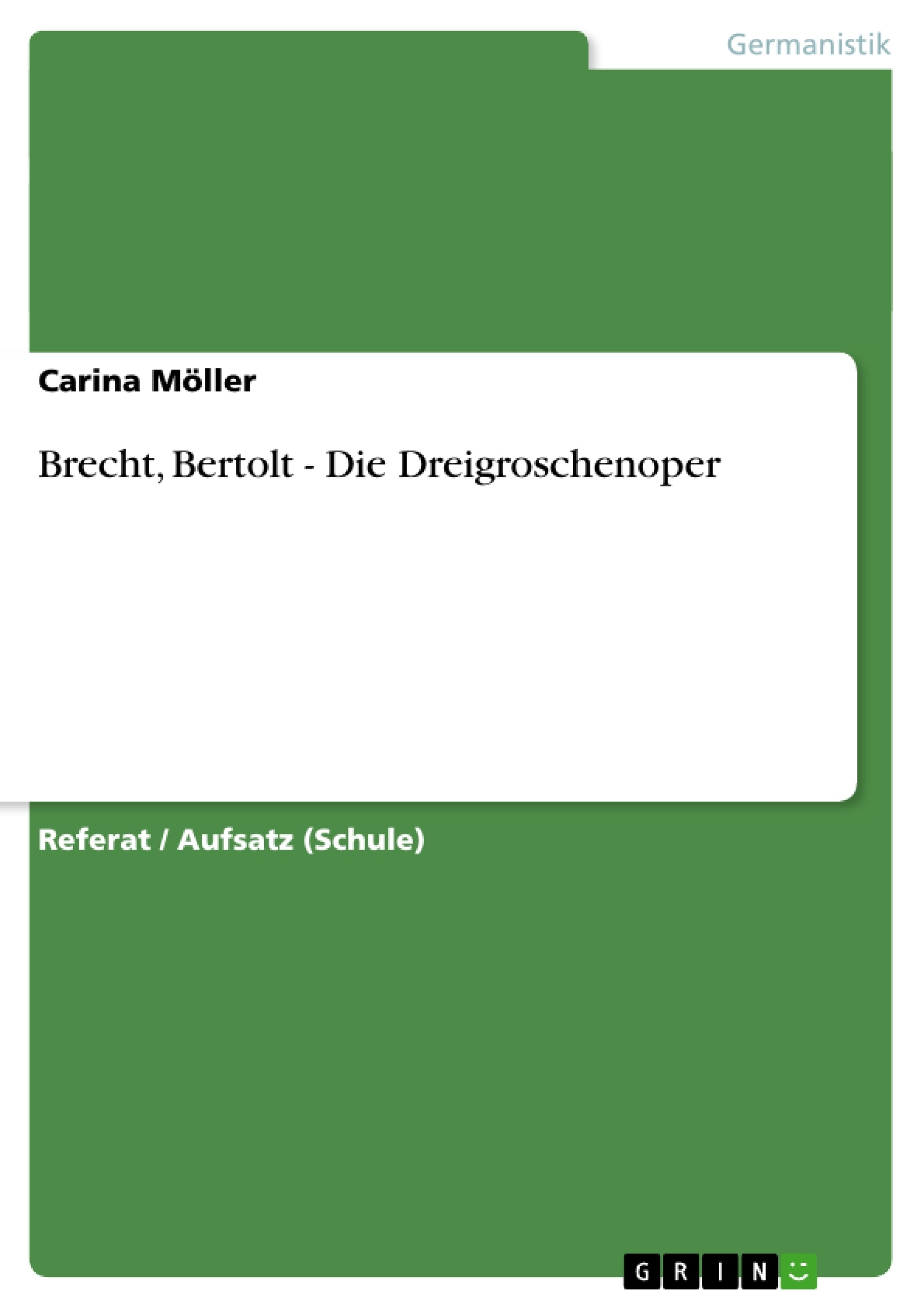In den schmutzigen Gassen des viktorianischen Londons, wo Armut und Verbrechen Hand in Hand gehen, entfaltet sich eine Geschichte von Liebe, Verrat und Überleben, die bis heute nichts von ihrer Brisanz verloren hat: Willkommen zur "Dreigroschenoper" von Bertolt Brecht und Kurt Weill, einem Meisterwerk des epischen Theaters! Tauchen Sie ein in das düstere Milieu rund um Mackie Messer, dem charmanten Gangsterboss, und Jonathan Peachum, dem König der Bettler, deren erbitterter Konkurrenzkampf die moralischen Abgründe der Gesellschaft offenbart. Zwischen Huren, Dieben und korrupten Polizisten entspinnt sich ein Netz aus Intrigen und Machtspielen, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Erleben Sie, wie Mackie Messer die schöne Polly Peachum heiratet, was zu einem Krieg zwischen ihm und Peachum führt. Dieser Konflikt droht, die Krönungsfeierlichkeiten zu stören. Die Dreigroschenoper ist eine brillante Satire auf die bürgerliche Moral und den Kapitalismus, die mit bissigem Humor und unvergesslichen Melodien wie der "Moritat von Mackie Messer" und dem "Seeräuberjenny-Song" das Publikum in ihren Bann zieht. Entdecken Sie die revolutionäre Kraft von Brechts Theaterkonzept, das den Zuschauer zur kritischen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen anregt. Diese Oper ist mehr als nur ein Theaterstück; sie ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft, der uns mit schonungsloser Ehrlichkeit unsere eigenen Schwächen vor Augen führt. Eine zeitlose Geschichte über die Verbrechen der Reichen, die Armut der Ausgebeuteten und die allgegenwärtige Korruption, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Oper, Jazz und sozialkritischer Botschaft bis heute begeistert und zum Nachdenken anregt. Erkunden Sie die Biografien von Brecht und Weill, die dieses bahnbrechende Werk geschaffen haben, und erfahren Sie mehr über die Entstehung und die Hintergründe der "Dreigroschenoper", einem der meistgespielten deutschsprachigen Stücke des 20. Jahrhunderts. Lassen Sie sich von der Musik und der Handlung dieser zeitlosen Oper fesseln und tauchen Sie ein in eine Welt voller Intrigen, Leidenschaft und sozialer Ungerechtigkeit. Die "Dreigroschenoper" – ein Muss für jeden Theaterliebhaber und ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Brecht / Weill - Die Dreigroschenoper
1. Allgemeines:
Die Dreigroschenoper wurde 1928 von Berthold Brecht geschrieben, die Musik stammt von Kurt Weill. A m 31. August 1928 wurde die Dreigroschenoper im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin uraufgeführt, in den Hauptrollen Harald Paulsen (Mackie Messer), Erich Ponto (Bettler Peachum) und Roma Bahn (Polly Peachum). Das Bühnenbild wurde von Caspar Neher gestaltet und Regie führte Erich Engel. Die Oper wurde zum größten Theatererfolg der zwanziger Jahre,[1] darüber hinaus ist sie eines der meistgespielten deutschsprachigen Stücke im 20. Jahrhundert.[2] Bereits ein Jahr nach der Uraufführung hatten mehr als fünfzig Theater das Stück gespielt, das danach bis 1932 ganz Europa eroberte.[3]
Später wurde die Dreigroschenoper noch mehrmals verfilmt: Die erste Verfilmung erschien im Jahre 1931 unter der Regie von Georg Wilhelm Pabst, die jedoch aus politischen Gründen von den Nationalsozialisten 1933 verboten wurde.[4] Eine weitere Verfilmung entstand 1962. [5]
Das Stück, in dem Bettler, Huren und Räuber auftreten, stellt die dunkle, kriminelle Seite der großstädtischen Welt dar. Trotz ihrer Ansiedlung im viktorianischen England kritisiert die "Dreigroschenoper" mit Satire und Spott die bürgerlich-kapitalistische Welt der Weimarer Republik.¹
2. Biographien
2.1 Biographie von Kurt Weill:
Am 2. März 1900 wird Kurt Julian Weill in Dessau in Sachsen-Anhalt geboren. Er entstammt einem jüdischen Elternhaus, sein Vater Albert Weill ist Kantor der dort ansässigen jüdischen Gemeinde, spielt jedoch auch Klavier und komponiert selber, daher unterrichtet er seinen Sohn schon in sehr jungen Jahren. [6] Ab 1912 bekommt er richtigen Klavierunterricht und beginnt nur wenige Zeit später mit seinen ersten Kompositionen. 1916 arbeitet er neben der Schule als Klavierlehrer, als er 1918 schließlich mit dem Studium an der Hochschule für Musik in Berlin beginnt. Nach nur einem Jahr muss er das Studium allerdings wegen familiären Problemen (Entlassung des Vaters[7] ) aufgeben, die sich aber schnell wieder lösen, und er 1920 Kapellmeister am Stadttheater in Lüdenscheid wird.[8]
Von 1921 bis 1923 studiert er als Meisterschüler Ferruccio Busonis an der preußischen Akademie der Künste in Berlin. Weills wichtigste Komposition während der Lehrjahre bei Busoni ist die Sinfonie Nr. 1, auch als die "Berliner Sinfonie" bekannt. Außerdem wird er Mitglied der Musikabteilung der "Novembergruppe", einem Zusammenschluss oppositionell gesinnter Künstler, deren Ziel die Demokratisierung des Kunstgeschehens ist.
Von 1924 bis 1929 schreibt Weill Vorschauen und Rezensionen zum Radioprogramm für die überregionale Programmzeitschrift "Der deutsche Rundfunk", außerdem heiratet er am 28.01.1926 die Schauspielerin Lotte Lenya, mit der er schon zuvor zwei Jahre zusammen gewohnt hat. 1926 ist zusätzlich die Uraufführung seiner ersten Oper „Der Protagonist“ in der Dresdner Staatsoper.[9]
1927, also mit 27 Jahren, hat Weill bereits zwei Streicherquartette, mindestens fünf Orchesterwerke, ein Violinkonzert, verschiedene Chorwerke, zwei Liederzyklen, eine Kantate, eine Ballett-Pantomime und drei Opern geschrieben. Weills Stil hat sich im Laufe der Jahre geändert: Anfangs waren seine Werke meist religiös geprägt und kompliziert im Aufbau, jetzt lässt er viel populäre Musik in seine Kompositionen einfließen, was zu einer Vereinfachung seiner Musik führt, die jedoch keinen qualitativen Verlust darstellt. Immerhin zählt Weill zu den viel versprechenden jungen Komponisten seiner Zeit. Bei seiner Zusammenarbeit mit Georg Kaiser an dem "Protagonisten" hat er bereits einige epische Elemente einfließen lassen. Um diese Erneuerung des Musiktheaters weiterführen zu können sucht Weill einen Dichter der ähnliche Ziele verfolgt wie er selbst. Weill findet diesen Dichter in Brecht, der schon einige Zeit an seiner Vorstellung von dem Epischen Theater arbeitete.[10]
1927 beginnt also die Zusammenarbeit mit Berthold Brecht, woraus als erstes das „Mahagonny-Songspiel“ resultiert. 1928 dann wird zuerst die Opera buffa „Der Zar lässt sich photographieren" in Leipzig uraufgeführt, im August folgt die Premiere der „Dreigroschenoper“ in Berlin, die ihn weltberühmt macht. Weills Ehefrau Lenya selbst spielt auch bei den meisten seiner Opern oder sonstigen Stücke mit, bei der Dreigroschenoper beispielsweise die Spelunken-Jenny.
In Leipzig, in 1930 ist die Uraufführung Weill und Brechts zweiter gemeinsamen Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, die aus dem vorhergehenden Songspiel geschrieben wurde. Allerdings provoziert das Stück aufgrund seiner Kapitalismuskritik rechtsradikale Krawalle und wird zu einem der größten Theaterskandale der Weimarer Republik.[11] Von nun an wird jedes Werk Weills von der Nazipresse mit unsachlichen Argumenten verrissen. Seine Musik wird als undeutsch, jüdisch und künstlerisch wertlos bezeichnet. Einen Höhenpunkt des Konflikts stellt die Oper „Der Silbersee“ dar, in der ein Lied („Ballade von Cesars Tod“) direkt auf Hitlers Größenwahn anspielt. An der Premiere jedoch folgt auf einen Moment betreten Schweigens stürmischer Applaus bei der Großzahl des Publikums.[12]
Nachdem 1933 aber Notenpapiere Weills bei der Bücherverbrennung zerstört und viele seiner Stücke verboten werden, flieht Weill zusammen mit Lenya nach Paris um von den Nationalsozialisten nicht verhaftet zu werden. Dort lässt er sich noch im selben Jahr von Lotta Lenya scheiden[13] und erschafft das vorerst letzte gemeinsame Werk mit Brecht: „Die sieben Todsünden“, ein Ballett mit Gesang. Da Weill jedoch nicht, wie Brecht es tat, seine Arbeit mehr und mehr politisieren will, entwickelt sich ihre Arbeitsbeziehung auseinander.[14]
1935 emigriert er schließlich in die USA, genauer nach New York; und zwar auf Wunsch von Max Reinhardt,[15] der das Libretto zu der noch größtenteils in Paris entstandenen Oper „Der Weg der Verheißung“, die auf dem alten Testament basiert, schrieb. Nach anfänglichen Schwierigkeiten am Broadway, gelingen ihm jedoch mit „The Eternal Road“ (englischer Titel von „Der Weg der Verheißung“) in 1937 und „Knickerbocker Holiday" in 1938 wieder größere Erfolge, spätestens aber mit „Lady in the Dark“ in 1941 verzeichnet er einen erneuten Durchbruch.[16]
Außerdem heiratet er 1937 zum zweiten Mal Lotta Lenya und erhält 1943 die amerikanische Staatsbürgerschaft.[17] Im selben Jahr trifft er wieder auf Brecht, die beiden haben sich allerdings zu sehr auseinander gearbeitet, sodass Weill lediglich einige Gedichte Brechts vertont.[18]
In den nächsten Jahren folgen weitere Musicals, Film-Musiken und Opern,[19] außerdem besucht er 1947 Europa und Palästina und bearbeitet die israelische Nationalhymne "Hatikvah" für ein großes Orchester.[20] Sein letztes vollendetes Stück ist die Musical-Tragödie „Lost in the Stars“ von 1948; er arbeitet bis zuletzt am dem Musical „Huckleberry Finn“, welches er aber nicht mehr zu Ende bringen kann, da der am 3. April 1950 an den Folgen eines Herzinfarkts in New York stirbt.[21]
Noch heute findet alljährlich in seinem Geburtsort Dessau eine Kurt-Weill-Festwoche statt.[22]
Weills wichtigste Werke im Überblick:
- 1921 "Symphonie Nr. 1 'Berliner Symphonie'"
- 1924/25 "Der Protagonist", Oper - Libretto von Georg Kaiser
- 1928 "Der Zar lässt sich photographieren", Opera Buffa - Libretto von Georg Kaiser
- 1928 "Dreigroschenoper" - Libretto von Bertolt Brecht
- 1930 "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", Oper - Libretto von Bertolt Brecht
- 1931 "Mann ist Mann", Oper - Libretto von Bertolt Brecht
- 1931 "Die Bürgschaft", Oper - Libretto von Caspar Neher
- 1932/33 "Der Silbersee. Ein Wintermärchen", Musikspiel - Text von Georg Kaiser
- 1933 "Die sieben Todsünden", Ballett mit Gesang - Text von Bertolt Brecht
- 1934 "Symphonie Nr. 2"
- 1934/35 "Der Weg der Verheißung", Biblisches Drama - Text von Franz Werfel
- 1936 "Johnny Johnson", Musikspiel - Texte von Paul Green
- 1938 "Knickerbocker Holiday", Musical-Komödie - Songtexte von Maxwell Anderson
- 1941 "Lady in the Dark", Musical - Libretto von Moss Hart, Songtexte von Ira Gershwin
- 1943 "One Touch of Venus", Musical-Komödie - Libretto von S. J. Perelman / Ogden Nash
- 1948 "Down in the Valley", Oper - Libretto von Arnold Sundgaard
- 1949 "Lost in the Stars", Musical-Tragödie - Libretto und Songtexte von Maxwell Anderson[23]
2.2 Biographie von Berthold Brecht
Am 10. Februar 1898 wird Eugen Berthold Friedrich Brecht als Sohn des Direktors einer Papierfabrik in Augsburg geboren. Nach der Volksschule besucht er ab 1908 das Realgymnasium in Augsburg, wo er in 1917 das Notabitur wegen eines pazifistischen Schulaufsatzes bekommt. 1915 waren unter dem Pseudonym Berthold Eugen bereits erste Gedichte und Kurzprosatexte in den „Augsburger Neuesten Nachrichten“ erschienen. Danach studiert er, unterbrochen von einem Kriegsdienst im Seuchenlazarett, Medizin, sowie Naturwissenschaften und vor allem Literatur an der Universität München.[24] Zu dieser Zeit lernt er Paula Banholzer kennen, die 1919 einen Sohn, Frank, von ihm zur Welt bringt. Frank jedoch fällt 1943 als deutscher Soldat in Russland.[25]
1918 schreibt er sein erstes Drama "Baal", dem neben Theaterkritiken und Kurzgeschichten weitere Theaterstücke folgen. Ab 1920 reist Brecht oft nach Berlin, da er dort Beziehungen zu Personen aus dem Theater und zur literarischen Szene aufbaut.[26]
Im Jahr 1922, dem Jahr, in dem er den Kleist-Preises für „Trommeln in der Nacht“ verliehen bekommt, heiratet er die Schauspielerin und Opernsängerin Marianne Zoff. Ein Jahr später bekommen sie eine gemeinsame Tochter mit Namen Hanne. 1924 wird sein zweiter Sohn Stefan geboren.[27]
1923, dem Jahr der Erstaufführung von „Im Dickicht der Städte“, erhält Brecht einen Dramaturgenvertrag an den Münchner Kammerspielen.[28] 1924 zieht er jedoch ganz nach Berlin. Hier arbeitet er zunächst zwei Jahre lang zusammen mit Carl Zuckmayer als Dramaturg an Max Reinhardts Deutschem Theater und studiert gleichzeitig intensiv den Marxismus. 1927 wird "Mann ist Mann" uraufgeführt und seine erste Gedichtsammlung "Hauspostille" herausgegeben, beide Werke sind stark durch den Marxismus beeinflusst.[29]
Außerdem lässt er sich von Marianne Zoff scheiden, nur ein Jahr später heiratet er Helene Weigel.
1928 schließlich bearbeitet er gemeinsam mit Kurt Weill die "Beggar's Opera", woraus die "Dreigroschenoper" resultiert und im August im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin mit großem Erfolg uraufgeführt wird. Die "Dreigroschenoper" kann als erstes Stück des sogenannten epischen Theaters angesehen werden, wobei Brecht nicht mehr die Identifikation der Zuschauer mit seinen Heldinnen und Helden anstrebt, sondern eine kritische Distanz, die er durch Verfremdung erzielen will; darüber hinaus sollen den Zuschauern keine illusionär-geschlossenen Bühnenwelten mehr geboten werden, sondern Konflikte, die sie aktiv mit durchdenken und mit entscheiden sollen.[30]
1929 kommt die mit Helene Weigel gemeinsame Tochter Barbara auf die Welt.
Als 1930 die mit Weill zusammen erarbeitete Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ als Theaterskandal endet, weitere Werke von ihm verboten oder nur durch Einschränkungen erlaubt werden[31] und Anfang 1933 sogar die Aufführung seines Stückes „Maßnahme“ von der Polizei unterbrochen und die Veranstalter des Hochverrats angeklagt werden,[32] verlässt Brecht einen Tag nach dem Reichtagsbrand Berlin und flüchtet über Prag, Wien und Zürich bis nach Skovsbostrand bei Svendborg auf Fünen in Dänemark, wo er sich schließlich fünf Jahre aufhält.
Im Mai desselben Jahres werden seine Bücher von den Nationalsozialisten verbrannt und 1935 wird ihm die Staatsbürgerschaft aberkannt.[33]
In seiner schwierigen finanziellen Situation im Exil muss er nach London und Paris, zum Teil sogar bis nach New York reisen, um seine Theaterstücke überhaupt aufführen zu dürfen und somit Einfluss auf Gesellschaft und Politik ausüben zu können, trotzdem verfasst er in dieser Zeit einige seiner größten Werke, darunter „Das Leben des Galilei“ oder „Mutter Courage und ihre Kinder“, welches 1941 in Zürich uraufgeführt wird. Außer Dramen schreibt er auch Beiträge für mehrere Emigrantenzeitschriften in Prag, Paris und Amsterdam.
Im Jahre 1939 verlässt Brecht Dänemark, lebt ein Jahr in einem Bauernhaus in der Nähe Stockholms, aber im April 1940 muss er nach Finnland übersiedeln, da die deutschen Truppen in Dänemark und Norwegen einmarschiert sind.
1941 schließlich emigriert er über die UdSSR in die USA, wo er mit seiner Ehefrau in Santa Monica bei Hollywood lebt. Allerdings hat er dort kaum Erfolg im Film-, aber auch Theatergeschäft und kann auch kaum politisch wirken, sodass er sich auf seine „großen Stücke“ konzentriert. So kommt es beispielsweise zur Uraufführung von „Das Leben des Galilei“ 1943 in Zürich.
Da ihm die USA allerdings eine kommunistische Einstellung unterstellen, flieht er nach nur 6 Jahren in 1947 in die Schweiz,[34] bis er Anfang 1949 die Erlaubnis bekommt, in Ost-Deutschland einzureisen. Dort lässt er sich in Ost-Berlin nieder und gründet noch im selben Jahr zusammen mit Helene Weigel das „Berliner Ensemble“, das mit einem weiteren Stück Brechts namens „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ eröffnet wird.
1950 nimmt Brecht an der Gründungsveranstaltung der Deutschen Akademie der Künste teil, deren Vizeprä-sident er 1954 wird, des weiteren bekommt er 1951 den Nationalpreis der DDR, sowie 1954 den „Stalin-Preis für Frieden und Verständigung zwischen den Völkern“.[35] Ab 1953 kritisiert er das restriktive Vorgehen der Sozialist-ischen Einheitspartei Deutschlands (SED) gegen die Demonstranten, was zu Spannungen führt und somit einigen Ablehnungen seiner Stücke.[36] 1955 setzt er sich noch weiter für den Frieden ein, bis er jedoch am 14. August des Jahres 1956 in Berlin an den Folgen eines Herzinfarktes stirbt.[37]
Wichtige Werke von Berthold Brecht:
- Mann ist Mann (1926)
- Die Dreigroschenoper (1928)
- Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930)
- Die Mutter (1932)
- Furcht und Elend des Dritten Reiches (1935)
- Leben des Galilei (1938/39)
- Mutter Courage (1939)
- Der unaufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui (1941)
- Der gute Mensch von Sezuan (1942)
- Der kaukasische Kreidekreis (1945)
- Herr Puntila und sein Knecht Matti (1948)
- Die Verurteilung des Lukullus (1951)[38]
3. Die Dreigroschenoper
3.1 Die Entstehung der Dreigroschenoper
1927 war in London die alte "Beggar’s Opera" neu aufgeführt worden und das mit überragendem Erfolg. Elisabeth Hauptmann, Brechts Dramaturgin, wurde darauf neugierig und übersetzte das Manuskript ins Deutsche. Brecht nahm sich des Projektes an, billigte ihm aber keine besondere Bedeutung zu. Als er das Projekt zufällig im Gespräch mit einem Theaterdirektor erwähnte, war dieser sofort begeistert und gab Brecht den Auftrag in Zusammenarbeit mit Weill, das war Brechts Bedingung, eine Oper auf Basis der "Beggar’s Opera" zu schreiben. Da die Zeit bis zur geplanten Premiere knapp war, mussten Weill und Brecht unter extremen Zeitdruck arbeiten. Nach zwei Monaten [drei Wochen[39] ] im Frühsommer des Jahres 1928 an der Französischen Riviera hatten sie die Oper, die zunächst "Gesindel" heißen sollte und dann in "Die Dreigroschenoper" umbenannt wurde, fast abgeschlossen und die Proben konnten beginnen.[40]
3.1.1 Die Urfassung der Dreigroschenoper „Beggar's Opera“
Die „Beggar's Opera“ (auf deutsch „Bettleroper“) wurde 1728 auf Anregung Jonathan Swifts von John Gay (Text) und Johann Christophe Pepusch (Musik) entwickelt und im selben Jahr am Lincoln's Inn Fields Theatre in London uraufgeführt.[41] Die Bettleroper war Begründer der Ballad Opera (ein mit Volksliedern durchsetztes englisches Singspiel (seit dem 17. Jahrhundert), mit dem häufig tragische Werke der hohen Literatur verspottet wurden) und wandte sich in satirischer Weise gegen die Regierung, die englische Gesellschaftsordnung und die etablierte italienische Oper. Statt Helden oder mythischer Figuren waren die Protagonisten Verbrecher und Prostituierte. Durch den großen Erfolg der „Beggar's Opera“ wurden sogar Händels Opernunternehmen bedroht.
Bei John Gays Bettleroper bediente sich nicht nur Brecht, sondern sie wurde über die Jahre etliche Male neu verfasst. Allerdings erreichte nur die fast genau 200 Jahre spätere Bearbeitung von Brecht und Weill einen ähnlich großen Erfolg.[42]
John Gay lebte von 1685 bis 1732 in England und war Schriftsteller. Neben seinem berühmtesten Werk „Beggar’s Opera“ schrieb er Gedichte, Fabeln und viele weitere Theaterstücke, außerdem arbeitete er zeitweise auch als Journalist (u. a. bei der Wochenschrift „The Guardian“).[43]
3.1.2 weitere Vorlagen Brechts
In die Dreigroschenoper übernimmt Brecht, neben der „story“, zusätzlich auch noch Teile verschiedener Balladen des französischen Dichters François Villon, den er als sein Vorbild ansieht. Villon lebte von ca. 1431 bis 1463 und gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der Vagantendichtung des Mittelalters.[44]
3.2 die Musik zur Dreigroschenoper
Die epische Form des Musiktheaters gab Kurt Weill die Möglichkeit, in die sonst vor kompositorischen Experimenten so verschlossenen Opernelemente auch Jazzelemente und Elemente der Unterhaltungsmusik mit einfließen zu lassen. Daraus resultierte eine wesentlich größere Einfachheit und Verständlichkeit der Musik, die deshalb auch Zugang zu einer größeren Publikumsgruppe fand. Er hob das starre System der üblichen Musikübung auf und machte eine freiere, ungebundenere Form des Musizierens bis hin zur freien Improvisation möglich, nahm allen künstlichen Schmuck der Melodien heraus und wirkte in der Reduziertheit, und nicht in einer Überfülle an Tönen, bereichernd.
Die Musik der „Dreigroschenoper“ wurde von drei durchgreifenden Innovationen bestimmt: Eine neue Zusammensetzung des Orchesters aus nur zehn (Jazz-) Musikern, die nicht, wie in der Oper sonst üblich, im Orchestergraben saßen, sondern auf der Bühne in das Stück integriert waren; ein neuartiger Gesangsstil, der sich aus Elementen der populären Musik ableitete und hier zum ersten Mal als Weillscher Songstil die Bühne betrat, sowie die in sich geschlossenen Nummern.
Bereits die Ouvertüre mit ihren bewusst falschen, „schäbigen“ Akkorden, kündigte an, dass hier etwas Neues die Bühne betrat. Die Tatsache, dass Kurt Weill eine aus zehn Jazzmusikern bestehende Band einsetzte, die alle mindestens drei Instrumente spielen konnten, machte es dazu möglich, seine komponierten Opernelemente mit Jazzelementen zu verbinden.
Die Gesangsweise ist vorwiegend Sprechgesang, melodiös sind allenfalls die Refrains, außerdem sind die Songs und Balladen dramaturgisch aus der Handlung herausgehoben, was sich z. B. durch besonderes Licht ausdrückt. Des weiterem stehen sie in einem inhaltlich gebrochenen Verhältnis zur Handlung (Einschübe und Zwischenspiel[45]
Vor allem die eingestreuten Balladen wie das "Lied der Seeräuber-Jenny" oder die "Moritat von Mackie Messer", die den sofortigen Triumph des Stücks sicherstellten, gehören noch heute zu bekannten und sofort mit der "Dreigroschenoper" assoziierten Melodien.[46]
3.3 Inhalt und Aufbau der Dreigroschenoper
3.3.1 Die Hauptpersonen
-Macheath (genannt Mackie Messer)
-Jonathan Jeremiah Peachum
-Celia Peachum (seine Frau)
-Polly Peachum (seine Tochter)
-Brown (Polizeichef von London, genannt Tiger Brown)
-Lucy (seine Tochter)
-Spelunken-Jenny[47]
3.3.2 kurze Inhaltsangabe
Die Dreigroschenoper ist in Soho, einem Londoner Stadtteil, angesiedelt, der zum Zeitpunkt der Handlung, dem 18. Jahrhundert, von zwielichtigen Gestalten beherrscht wird. Es geht um den Konkurrenz- und Existenzkampf zwischen zwei "Geschäftsleuten", einem Bettler und einem Verbrecher.[48]
Im viktorianischen London verliebt sich der Gangster Mackie Messer (Macheath) in Polly, die Tochter von Bettlerkönig Peachum. Mackie verlässt seine Geliebte, die Spelunken-Jenny, und heiratet Polly. Peachum ist über die Verbindung entsetzt und erpresst den Polizeichef Tiger Brown: Entweder wird Mackie gefangen und gehängt oder ein Protestzug der Bettler stört die Krönungsfeierlichkeiten und Brown verliert seinen Posten. Mackie wird verhaftet, kann fliehen und wird erneut festgenommen. Verzweifelt versucht Mackie Geld für eine erneute Bestechung aufzutreiben, aber die Straßen sind wegen der Feierlichkeiten verstopft. Er steht schon unterm Galgen, da trifft Tiger Brown als reitender Bote ein: Die Königin hat ihn begnadigt und in den Adelsstand erhoben.[49]
3.3.3 Aufbau mit detailliertem Inhalt
Vorspiel:
Inmitten einer Menge von Bettlern, Huren und Dieben in Soho, London, singt ein Moritatensänger „Die Moritat von Mackie Messer“. Selbiger befindet sich unter den Zuhörern; er wird erkannt und verschwindet.[50]
1. Akt:
Der Geschäftsmann Peachum, Bettlerkönig genannt, organisiert die Bettler der Stadt. Sie liefern fünfzig Prozent ihrer Einnahmen ab und als Gegenleistung erhält jeder notwendige Hilfsmittel und Unterstützung. Auch Filch, der selbständig gebettelt hat, musste die Macht seines Chefs erfahren und wurde verprügelt. Allerdings wird er nach Bezahlung „wie ein Bettler ausgestattet“ und einem Bezirk zugeteilt, sodass er wie alle anderen auch für Peachum arbeiten muss. Zusätzlich hat Peachum noch anderen Ärger, denn er und seine Frau müssen feststellen, dass ihre Tochter Polly mit einem Mann, auf den Mackie Messers Beschreibung passt, fort gegangen und diese Nacht nicht heimgekommen ist.[51]
In einem Pferdestall in Soho wird Mackies Hochzeit mit Polly vorbereitet. Zuerst ist Polly unglücklich über die unromantischen Umstände, doch nach und nach bringen Mackies Männer allerlei gestohlenes Mobiliar und ein Festmahl heran. Mackie protzt und versucht seinen grobschlächtigen Gesellen Manieren und Kultur beizubringen, schließlich will er jetzt vom Straßenräuber zum Geschäftsmann aufsteigen. Neben den Räubern sind ein Pfarrer und auch Tiger Brown, der Polizeichef von London, anwesend, da letzterer ein alter Freund und Kriegskamerad von Mackie ist.
Zuhause wird Polly zur Rede gestellt. Ihr Vater nennt sie eine "Verbrecherschlampe" und die Mutter fällt in Ohnmacht, was Polly jedoch nicht viel auszumachen scheint.
Polly verteidigt sich, indem sie ihren Gatten als großen Räuber anpreist, aber Peachum und seine Frau wollen ihn an die Polizei verraten, daher will auch Frau Peachum zu den Huren gehen, wo sie den Aufenthaltsort Mackies vermutet.[52]
2. Akt:
Polly eilt davon, um ihren Mann zu warnen. Ihr Vater habe derart auf Tiger Brown Druck ausgeübt, dass dieser Mackie nicht mehr schützen könne. So übernimmt Polly während Mackies Flucht sein Geschäft.
Zwischenspiel: Frau Peachum besticht Spelunken-Jenny, damit diese Mackie ausliefert, wenn er ins Bordell kommt. Trotz der Verfolgung werde dieser seine Gewohnheiten ja nicht aufgeben.
Tatsächlich taucht Mackie auch wenig später dort auf, allerdings kommt wegen Jennys Verrat sogleich ein Polizist. Obwohl Mackie aus dem Fenster springend flüchten will, wird er dort geschnappt, da Frau Peachum schon draußen gewartet hat und so wird er verhaftet und kommt ins Gefängnis Old Bailey. Dort trifft er zuerst auf Tiger Brown, welcher sehr betrübt über die Verhaftung ist, jedoch nichts dagegen tun kann. Danach kommt Browns Tochter Lucy, mit der er ein Verhältnis hat, später stößt Polly noch dazu und die beiden betrogenen Rivalinnen geraten aneinander. In diesem Augenblick leugnet Mackie die Beziehung zu Polly, noch dazu behauptet Lucy schwanger zu sein. Frau Peachum erscheint, sieht ihre Tochter, gibt ihr eine Ohrfeige und schleppt sie ab. Mackie kann schließlich mit Lucys Hilfe fliehen.
Brown und Peachum, der Bettlerkönig, treffen ein weiteres Mal aufeinander, wobei letzterer nun mit einer massiven Störung des Krönungszuges der Königin durch die „untersten Schichten der Bevölkerung“ droht, wenn er den Gangster Macheath nicht verhaften lasse.[53]
3. Akt:
Peachum bereitet die "Demonstration des Elends" vor, da erscheint Jenny und will die Belohnung haben. Sie wird ihr verweigert, da Macheath auf freiem Fuß ist, Peachum erfährt aber von ihr Mackies neues Versteck. Brown kommt herbei und will die Bettler-Demonstranten verhaften lassen, allerdings bleibt ihm wegen Peachums Drohung nichts anderes übrig als zuerst Mackie zu verhaften.
Polly sucht Lucy im Old Bailey auf, wo diese wohnt. Sie gibt Reue und Zerknirschtheit wegen ihres Auftretens vor, möchte aber eigentlich erfahren, wo Mackie sich aufhält. Lucy weiß es nicht, aber die beiden scheinen sich in ihrem Unglück zu versöhnen und Lucy gibt zu, ihre Schwangerschaft nur vorgetäuscht zu haben. Da wird Mackie ins Gefängnis eingeliefert und seine Hinrichtung steht bevor.
Eine Stunde vor der geplanten Hinrichtung versucht Mackie seine Wächter noch einmal zu bestechen, doch er hat nur 400 von den verlangten 1000 ₤. Polly kommt und da sie auch nicht genug Geld hat muss sie - unter Tränen - Abschied nehmen,[54] außerdem macht er seinen Geschäftsabschluss mit Tiger Brown.[55]
Mackie hält vor allen eine Abschiedsrede: Er sieht sich als Opfer der neuen Zeit, in der der kleine Verbrecher ("Handwerker") durch die großen Geschäftsleute verdrängt wird.[56] Zum Schluss leistet er noch jedermann Abbitte und wird mit Trauermusik zum Galgen geführt. Im letzten Moment kommt jedoch Brown als „reitender Bote der Königin“ mit einem königlichen Schreiben, das Macheath begnadigt und in den Adelsstand erhebt.[57]
3.4 Interpretation der Oper
Bei genauerer Betrachtung der Songs und Balladen der Dreigroschenoper kann man feststellen, dass die allesamt nur ein Thema bedienen – und zwar was oder wie der Mensch ist. Es geht hervor, dass er unmoralisch ist, materialistisch und abhängig von seinen sexuellen Trieben, er hat keine Ideale und wenn es denn so sei, dann macht es ihn nichts aus, diese zu verraten oder aufzugeben. Nach der Dreigroschenoper ist der Mensch also unverbesserlich schlecht, egoistisch und hat keine Moralvorstellung sowie ein Gewissen.
Auch die Charaktere verdeutlichen dies, tatsächlich gibt es in der gesamten Oper nicht eine Figur, die sich menschlich, moralisch, vorbildhaft oder nur annähernd positiv verhält.
Angefangen bei Peachum, dem Bettlerkönig, der ein unvergleichlicher Geizkragen ist, aus dem Mitleid anderer Leute Kapital schlägt und nicht vor Erpressung zurückschreckt bis hin zu seinem Gegner Mackie, der seine Braut mit anderen betrügt und sogar verrät, ohne auch nur einmal darüber nachzudenken, genauso wie er seine „schwangere“ Freundin verlässt, weil er nur an sich selbst denkt. Auch die Frauen machen da keinen Unterschied, Polly übernimmt ohne Bedenken Mackies Gangster-Bande, Jenny verrät ihn mehrmals für ein bisschen Geld an die Polizei und Lucy täuscht ihm ihre Schwangerschaft vor um ihn alleine für sich zu haben. Selbst die Polizei ist nicht viel besser, Brown hat genauso wie alle anderen nur seinen Vorteil im Sinn und macht Geschäfte mit der Unterwelt. Die Figuren sind also ganz wie in den Songs und Balladen geschildert und treffen auch genau auf Brechts Sichtweise zu.
Die Oper spielt in einem zwielichtigen Viertel Londons, in der Unterwelt und im Rotlichtmilieu, dies alles deutet wieder auf den kriminellen und besonders unmoralischen Aspekt der Menschen, der ganzen Welt hin, trotzdem geht es aber vordergründig um Geschäfte, die ja eigentlich eine gutbürgerliche Tätigkeit sind. Außerdem werden normalerweise gute Werte wie Sparsamkeit, Fleiß, Ordnungsliebe, Kultur und Umgangsformen von der Unterwelt für sich in Anspruch genommen und somit entwertet. Die Charaktere verwenden die eigentlich vorbildlichen Werte für sich in einem ganz anderen Zusammenhang und wandeln sie somit ins Gegenteil, somit werden die gutbürgerlichen Wertvorstellungen in Frage gestellt. Man nicht mehr wirklich zwischen Gut und Schlecht unterscheiden kann; der Polizist, der eigentlich das Gute, die Gerechtigkeit darstellt, verhält sich beispielsweise gegen das Gesetz. Außerdem kritisiert Brecht den Kapitalismus, da der das Geschäft mit dem Verbrechen gleichsetzt.
Abschließend wollen Brecht und Weill bzw. Gay also mit der Oper aussagen, dass es weder eine gute noch eine schlechte Gesellschaft gibt, sondern nur ein Mix daraus. Die Kontrahenten (die männlichen wie die weiblichen) dieses Stückes liegen zwar im Streit miteinander, unterscheiden sich aber wenig voneinander. Sie alle treiben Geschäfte, sind aber vollkommen unmoralisch. Außerdem sagt das Stück noch aus, dass sich bürgerliches und kriminelles Geschäftsverhalten immer einander bedienen und sozusagen zueinander gehören, für einen Geschäftserfolg bedarf es bei beiden denselben Grundprinzipien, wie z.B. Disziplin, kein Aus-der-Reihe-Tanzen, Unterordnung und eine gute Organisation.[58]
Hand-out:
Berthold Brecht / Kurt Weill:
Die Dreigroschenoper
Musik: Kurt Weill
Text: Berthold Brecht
Text-Vorlage: John Gays „Beggar’s Opera“ („Bettleroper“) von 1728
Uraufführung: 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin
1. Verfilmung: 1931 (eine weitere in 1962)
Brechts und Weills Dreigroschenoper ist eines der meistgespielten deutschsprachigen Stücke des 20.Jahrhunderts!
Aufbau der Dreigroschenoper: ein Vorspiel und 3 Akte
Inhalt der Oper: Im viktorianischen London verliebt sich der Gangster Mackie Messer (Macheath) in Polly, die Tochter von Bettlerkönig Peachum. Mackie verlässt seine Geliebte, die Spelunken-Jenny, und heiratet Polly. Peachum ist über die Verbindung entsetzt und erpresst den Polizeichef Tiger Brown: Entweder wird Mackie gefangen und gehängt oder ein Protestzug der Bettler stört die Krönungsfeierlichkeiten und Brown verliert seinen Posten. Mackie wird verhaftet, kann fliehen und wird erneut festgenommen. Verzweifelt versucht Mackie Geld für eine erneute Bestechung aufzutreiben, aber die Straßen sind wegen der Feierlichkeiten verstopft. Er steht schon unterm Galgen, da trifft Tiger Brown als reitender Bote ein: Die Königin hat ihn begnadigt und in den Adelsstand erhoben.[59]
Musik: Die Musik Kurt Weills enthält Elemente des Jazz, der Unterhaltungsmusik sowie Kirchen- und Opernmelodien. Vor allem die eingestreuten Balladen wie das "Lied der Seeräuber-Jenny" oder die "Moritat von Mackie Messer", die den sofortigen Triumph des Stücks sicherstellten, gehören noch heute zu bekannten und sofort mit der "Dreigroschen-oper" assoziierten Melodien.[60]
Lebensläufe von Brecht und Weill: [61]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
[1] http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/kunst/dreigroschen/
[2] http://www.burghofbuehne-dinslaken.de/Archiv/Die_Dreigroschenoper/die_dreigroschenoper
[3] http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/kul/15249.html [unter 4.3]
[4] Microsoft® Encarta® Enzyklopädie Professional 2003 [Pabst, Georg Wilhelm]
[5] http://www.filmevona-z.de/filmsuche.cfm [Dreigroschenoper]
[6], 7, 10 http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/mus/598.html
[8], 9, http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WeillKurt/
[11], 13, 17 und 20 http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/WeillKurt/
[12], 14, 16, 18 und 21 http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/mus/598.html
[15] und 23 http://www.dafkurse.de/lernwelt/menschen/weill/weill.htm
[19] Microsoft® Encarta® Enzyklopädie Professional 2003 [Weill, Kurt] bzw. [Brecht, Berthold]
[22] http://de.wikipedia.org/wiki/Kurt_Weill
[25] http://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
[26], 29 http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/del/20568.html
[27] http://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
[28], 32 Microsoft® Encarta® Enzyklopädie Professional 2003 [Brecht, Berthold]
[30], 31 und 33 http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/BrechtBertolt/
[34] und 36 http://de.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
[35] und 37 http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/BrechtBertolt/
[38] http://www.sewanee.edu/german/Literatur/brecht.html
[39] http://www.staatstheater-hannover.de/sstuecke04/dreigroschen.shtml
[40] http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/mus/598.html
[41] http://www.apron.de/apron/stuecke/bo/stueck.html
[42] http://www.musikerchat.de/cgi-bin/ultimus/fachbegriffe/musik.pl?id=213
[43] und 44 Microsoft® Encarta® Enzyklopädie Professional 2003 [Gay, John] bzw. [Villon, François]
[45] http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/kul/15249.html [4.2 und 4.3]
[46] http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/kunst/dreigroschen/
[47] http://www.operone.de/opern/dreigros.html
[48] http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Dreigroschenoper
[49] http://www.deutsches-filmhaus.de/filme_einzeln/st_einzeln/staudte_wolfgang/dreigroschenoper.htm
[50] und 52 http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/del/20568.html
[51] http://www.impresario.ch/synopsis/synweidre.htm
[53], 54 und 56 http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/del/20568.html
[55] http://www.krref.krefeld.schulen.net/referate/deutsch/r0239t00.htm
[57] http://www.impresario.ch/synopsis/synweidre.htm
[58] http://www.hausarbeiten.de/rd/faecher/hausarbeit/del/20568.html
[59] http://www.deutsches-filmhaus.de/filme_einzeln/st_einzeln/staudte_wolfgang/dreigroschenoper.htm
[60] http://www.dhm.de/lemo/html/weimar/kunst/dreigroschen/
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Dreigroschenoper?
Die Dreigroschenoper ist ein Stück von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weill. Es wurde 1928 uraufgeführt und ist eines der meistgespielten deutschsprachigen Stücke des 20. Jahrhunderts.
Wer hat die Dreigroschenoper geschrieben?
Der Text der Dreigroschenoper stammt von Bertolt Brecht, die Musik von Kurt Weill.
Wann wurde die Dreigroschenoper uraufgeführt?
Die Dreigroschenoper wurde am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin uraufgeführt.
Wer waren die Hauptdarsteller der Uraufführung?
Die Hauptrollen bei der Uraufführung spielten Harald Paulsen (Mackie Messer), Erich Ponto (Bettler Peachum) und Roma Bahn (Polly Peachum).
Worum geht es in der Dreigroschenoper?
Die Dreigroschenoper spielt im viktorianischen London und handelt von der Konkurrenz zwischen dem Gangster Mackie Messer und dem Bettlerkönig Peachum. Es geht um Liebe, Verrat, Macht und die Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.
Welche Vorlagen hatte Brecht für die Dreigroschenoper?
Brecht nutzte als Vorlage John Gays "Beggar's Opera" (Bettleroper) aus dem Jahr 1728. Zusätzlich flossen Teile von Balladen des französischen Dichters François Villon ein.
Wer war Kurt Weill?
Kurt Weill war ein deutsch-amerikanischer Komponist, der am 2. März 1900 geboren wurde und am 3. April 1950 starb. Er komponierte die Musik zur Dreigroschenoper und zu vielen weiteren bekannten Stücken.
Wer war Berthold Brecht?
Berthold Brecht war ein deutscher Dramatiker und Lyriker, der am 10. Februar 1898 geboren wurde und am 14. August 1956 starb. Er schrieb den Text zur Dreigroschenoper und gilt als einer der wichtigsten deutschen Dichter des 20. Jahrhunderts.
Was ist das Besondere an der Musik der Dreigroschenoper?
Die Musik von Kurt Weill verbindet Elemente der Oper, des Jazz und der Unterhaltungsmusik. Sie ist einfach verständlich und zugänglich und wird von einem kleinen Orchester mit Jazzmusikern gespielt.
Welche bekannten Lieder stammen aus der Dreigroschenoper?
Zu den bekanntesten Liedern aus der Dreigroschenoper gehören die "Moritat von Mackie Messer" und das "Lied der Seeräuber-Jenny".
Wie wird die Dreigroschenoper interpretiert?
Die Dreigroschenoper wird oft als Kritik an der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und der Doppelmoral der Menschen interpretiert. Sie zeigt eine Welt, in der Verbrechen und Geschäft eng miteinander verbunden sind.
Welche Charaktere gibt es in der Dreigroschenoper?
Zu den Hauptcharakteren gehören Macheath (Mackie Messer), Jonathan Jeremiah Peachum, Celia Peachum, Polly Peachum, Brown (Tiger Brown), Lucy und Spelunken-Jenny.
Wurde die Dreigroschenoper verfilmt?
Ja, die Dreigroschenoper wurde mehrmals verfilmt. Die erste Verfilmung erschien 1931 unter der Regie von Georg Wilhelm Pabst. Eine weitere Verfilmung entstand 1962.
Was ist das Epische Theater?
Das Epische Theater ist eine von Brecht entwickelte Theaterform, die darauf abzielt, den Zuschauer zu kritischem Denken anzuregen, anstatt sich mit den Figuren zu identifizieren. Dies wird durch Verfremdungseffekte erreicht.
- Quote paper
- Carina Möller (Author), 2004, Brecht, Bertolt - Die Dreigroschenoper, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108791