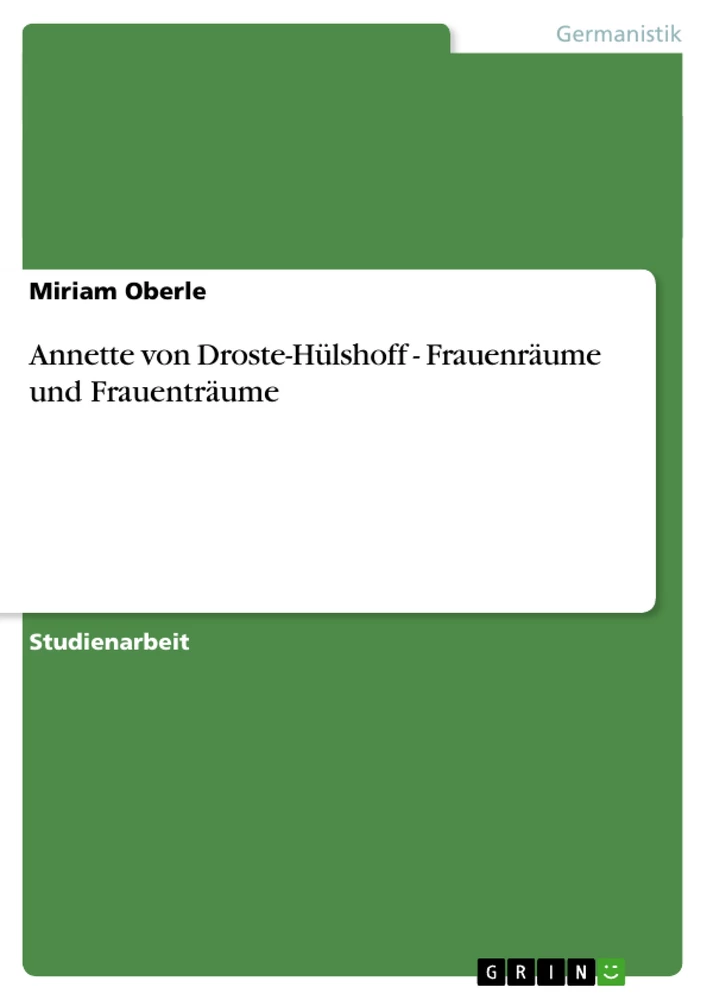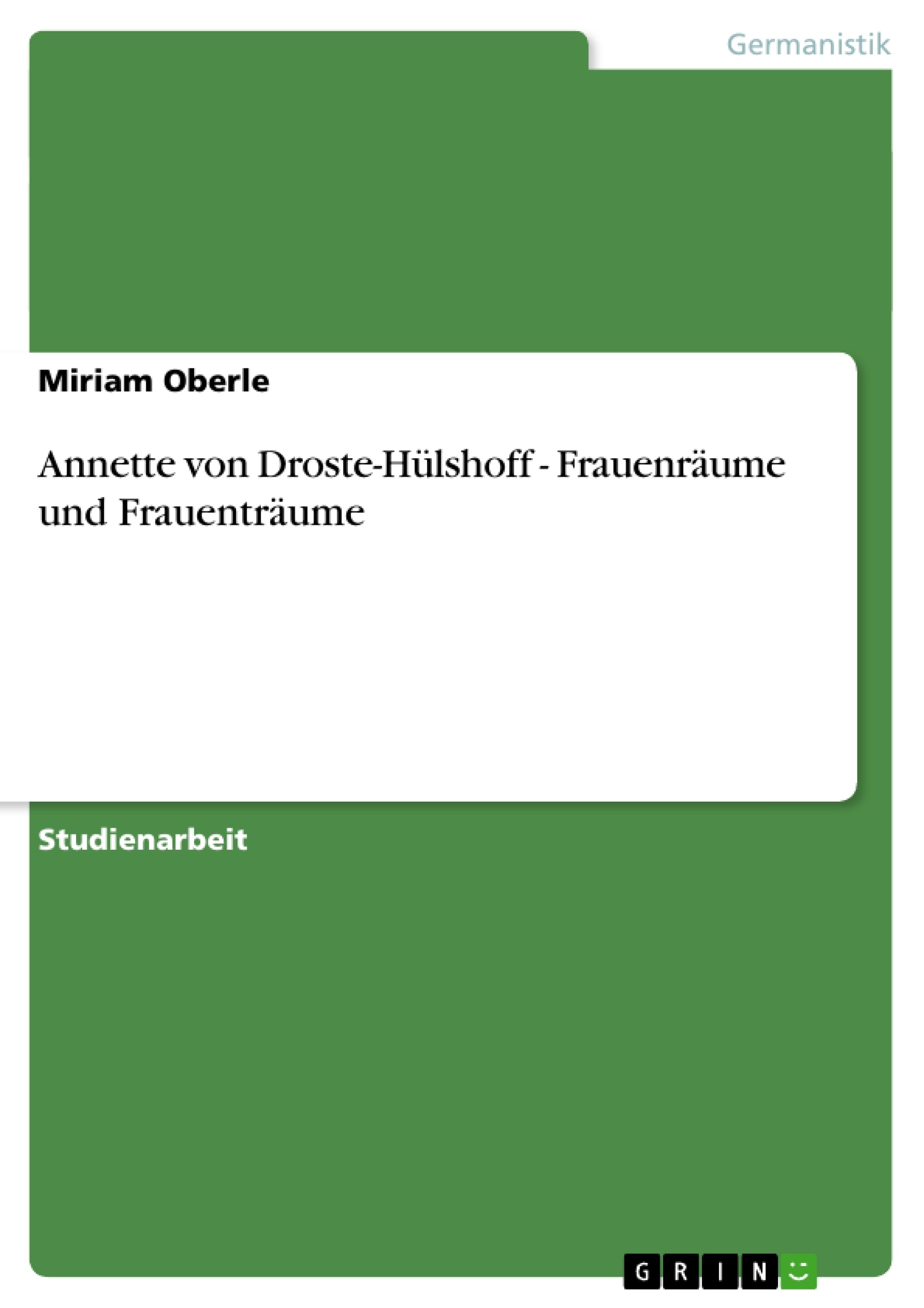Was bedeutet es, als Frau in einer Welt der Konventionen gefangen zu sein? Diese Frage durchdringt die Analyse der Werke Annette von Droste-Hülshoffs und offenbart eine faszinierende Auseinandersetzung mit dem Frauenbild im Biedermeier. Anhand von Gedichten wie "Am Turme" ergründet diese tiefschürfende Betrachtung die Sehnsüchte, Träume und den inneren Konflikt einer außergewöhnlichen Dichterin. Entdecken Sie, wie Droste-Hülshoff die Grenzen ihrer Zeit sprengte, indem sie in ihren Versen eine Welt der Freiheit, der Selbstbestimmung und der weiblichen Emanzipation entwarf. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der adeligen Frau zwischen Tradition und Aufbruch, zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und persönlicher Entfaltung. Es wird untersucht, wie sich die politischen und sozialen Umbrüche der Epoche in Drostes Lyrik widerspiegeln und welche Bedeutung Symbole wie der Turm und das offene Haar in ihrem Werk einnehmen. Tauchen Sie ein in die verborgenen Botschaften ihrer Verse und erleben Sie, wie Droste-Hülshoff die weibliche Identität ihrer Zeit hinterfragte und neu definierte. Erfahren Sie mehr über die Frauenräume und Frauenträume im Spiegel der Biedermeierzeit, über Lebenslust und Lebensfrust und über die Frage, inwiefern Annette von Droste-Hülshoff als emanzipierte Frau betrachtet werden kann. Diese Analyse bietet einen neuen Blick auf das Werk einer der bedeutendsten deutschen Dichterinnen und regt dazu an, über die Rolle der Frau in Geschichte und Gegenwart nachzudenken. Lassen Sie sich entführen in die Welt der Droste und entdecken Sie die zeitlose Relevanz ihrer Gedichte über Weiblichkeit, Freiheit und Selbstverwirklichung. Werfen Sie einen Blick auf das Gedicht "Am Turme", welches als Ausgangspunkt dient, um das damalige Rollenverständnis zu untersuchen. Welche Auswirkungen hatte dies auf die Frauen jener Zeit? War ein Ausbruch aus dem adeligen Frauenbild möglich? Wie wurden schreibende Frauen betrachtet und wie sahen sie sich selbst? Welche Entfaltungsmöglichkeiten gab es für sie wirklich?
Inhaltsverzeichnis
1 Frauenbild in Drostes Lyrik und Zeit
1.1 Biographisches und zeitliche Einteilung
1.2 Stellung der adeligen Frau im Biedermeier
2 Frauenräme und Frauenträume
2.1,,Am Turme”
2.2 Weitere Räume und Lebenswelten
2.3 Themen und Symbole - Lebenslust und Lebensfrust
2.4 Annette von Droste-Hülshoff - Eine emanzipierte Frau?
3 Schlußbetrachtungen
4 Literaturverzeichnis
4.1 Primärliteratur
4.2 Sekundärliteratur
1 Frauenbild in Drostes Lyrik und Zeit
1.1 Biographisches und zeitliche Einteilung
Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) wird in einer sehr widersprüchlichen Zeit geboren. Wie viele ihrer Generation steht sie zwischen Revolution und Restauration. Es ist die Epoche des Biedermeier, die sich politisch, sozial,
ökonomisch und kulturell durch etliche Gegensätze auszeichnet. Eigentlich als Anna Elisabeth Freiin von Droste zu Hülshoff geboren, genießt sie die Privi- legien einer adeligen Frau - muß sich allerdings auch deren Zwängen und Ver- haltensregeln unterwerfen. Diese Arbeit will, anhand von ausgewählten Ge- dichten der Droste und zeitgenössischen wie geschichtlichen Zitaten und Hin- tergründen, den damaligen Fraunbildern und dem damaligen Rollenverständ- nis auf die Spur kommen.
Ausgehend von dem Gedicht ,,Am Turme”, soll untersucht werden, welches Rollenverständnis innerhalb der Epoche anzutreffen ist und welche Auswir- kungen dies auf die Frauen jener Zeit hatte. War ein Ausbruch aus dem ade- ligen Frauenbild möglich? Wie wurden schreibende Frauen betrachtet und wie sahen sie sich selbst? Welche Möglichkeiten der Entfaltung gab es?
1.2 Stellung der adeligen Frau im Biedermeier
Im allgemeinen unterscheidet man zwischen zwei Frauenbildern dieser Zeit. Auf der einen Seite steht die Landedelfrau, deren Aufgaben klar umrissen sind. Sie ist für die hauswirtschaftliche Verwaltung des Landsitzes zuständig, wozu die Aufsicht über das Gesinde und die Verwaltung der Vorräte gehört. Des weiteren kümmert sie sich um die Anleitung der Kindererziehung und
bemüht sich um Caritas gegenüber den Gutsbewohnern. Sie lebt in einer pa- triarchalischen Familien - und Gesellschaftsstruktur, die von ihr Tugenden wie Fleiß und Sparsamkeit erwartet. ,,Innerhalb der patriarchalischen Fami- lien - und Gesellschaftsstruktur unterstand die Gutsfrau der Herrschaft ihres Gatten, des Hausvaters.”1
Auf der anderen Seite steht die höfische Dame von der vielfältige Fähigkeiten und Tugenden erwartet werden. Neben geistigen und ästhetischen Fähigkei- ten, ist die genaue Kenntnis und Umsetzung der Etikette unerlässlich. Sie ist auch für die geistige und gesellschaftliche Unterhaltung zuständig und
ein perfektes Französch ist obligatorisch. Ihr Ä ußeres soll sich durch Anmut,
Schönheit, richtiges Benehmen und Geschmack bezüglich Frisur, Kleidung und Schmuck auszeichnen. Natürlich gibt es in der Zeit keine klare Abgren- zung zwischen beiden Frauenbildern, zumal das Bild auch zusätzlich noch immer wieder durch Ideale des aufstrebenden Bürgertums beeinflußt wird.
2 Frauenräme und Frauenträume
2.1 ,,Am Turme”
Das Gedicht ,,Am Turme” entstand im Jahre 1842. Geschrieben wurde es in Meersburg am Bodensee. Nicht immer kann man das lyrische Ich gleichsetzen mit der Verfasserin, doch hier, wie noch in einigen anderen Gedichten ist es sehr naheliegend. Zumindest spiegelt es sehr anschaulich die Gefühlswelt einer adeligen Frau wider, die sich der Dichtkunst verschrieben hat. Noch nicht allzu lange davor hatten die Romantiker versucht die traditionellen Geschlechterrollen zu hinterfragen und aufzubrechen. Das Ideal von einer
gleichberechtigten Beziehung, von einer Beziehung von Liebe, Freundschaft und intellektueller Verbundenheit kam auf. Doch die Zeit der Restauration besinnt sich wieder auf alte ,,Tugenden” und auf die patriarchale Ordnung, was das Leben zumindest einem gewissen Teil der Frauen wieder enger werden läßt.
So ist der Turm alleine schon ein Symbol für die Gefangenschaft und drückt die Distanz der Frau zur Außenwelt und zum aktiven Leben aus. Das Ge- dicht ,,Am Turme” ist nicht nur eine Sehnsucht, es ist eine Phantasie, ein konkreter Wunsch des Ausbruchs. Innerhalb der 4 Strophen vollzieht sich eine Bewegung vom ,,hohem Balkone am Turm”, hinab zum Strand und den Wellen über die Wellen hinweg, in ein Meer und bis am Ende wieder, recht re- signativ, die Person ,,gleich einem artigen Kinde” dasitzt. Eine geschlossener Kreis, der nur für einen Moment aufgebrochen wird, vom Turm ausgehend und wieder zurück.
Doch auch die Haare bilden in den ersten und letzten Strophen des Gedichtes einen Rahmen und eine zentrale Rolle. Gerade Haare, Frauenhaare zeigen an, welchem Stand die Frau angehört. An den Frisuren und der Kleidung von Frauen sieht man schon seit jeher, wie das Frauenbild und deren Rolle gera- de zu sein hat. Während durch die französische Revolution die einengenden Korsette wegfielen und abgelöst wurden von locker fallender Kleidung, so lebt Droste-Hülshoff schon wieder in einer Zeit, in der alte Ideale wieder auf- leben.,,In den folgenden Jahren versuchte man in allen europäischen Staaten
- insbesondere in Frankreich, wo das Königtum zurückgekehrt war - die alten politischen Verhältnisse vor der Revolution wiederherzustellen, zu ,,restau- rieren”, ohne die neuen liberalen Ideen des Bürgertums zu berücksichtigen. Die Mode spiegelte genau diese Entwicklung wider.Schon am Ende der na-
poleonischen Zeit war die Frauenkleidung steifer geworden.”2
Im Gegensatz zum Turm sind die ,,flatternden Haare” hier Symbol für Frei- heit. Betrachtet man sich Bilder der Droste-Hülshoff, mit deren aufwendig gelockten und hochdrapierten Frisuren, so bildet die Vorstellung des offenen Haares eine klare Abgrenzung von den adeligen Konventionen. Gerade mit offenem Haar verbinden sich zu jener Zeit nur negative Assoziationen, denn offene Haare trugen nur Nicht-bürgerliche, Wahnsinnige oder Frauen, die als sexuell ausschweifend galten. So stehen hier die offenen Haare auch für eine lustvolle, freie sexuelle Phantasie. ,,Haare unterliegen in hohem Maße nicht nur der Mode, sondern auch der Sitte. Sie bedeuten Freiheit oder Unterwer- fung, je nachdem, Haare unter der Haube für die Matrone, geschorene Haare für die Nonne oder als Strafe für die Hure, geknotet Haare als Zeichen für Zurückhaltung,[...].”3
Doch sie betont auch ,,gleich einer Mänade”, die im krassen Gegensatz steht zu dem ,,artigen Kinde” in den Schlußversen. Denn Mänaden bezeichen wil- de Frauen aus der griechischen Mythologie,,,ekstatisch-orgiastische Frauen im Kult des Weingottes Dionysos”4 Frauen jener Zeit hatten alles andere, als ein Recht auf Wildheit und Freiheit, ihr Ziel sollte die Selbstbeherrschung sein, während ein aktives und auch abenteuerliches Leben nur den Männern zugestanden wurde. Um so prägnanter ist die aktive Wortwahl in den fol- genden Versen. Noch steht sie am Turm und träumt von einem ,,wilde(m) Gesellen(n)”, der nicht sie umarmt, sondern den sie selbst umschlingt. Das lyrische Ich setzt sich über sämtliche Rollenklischees hinweg und übernimmt den männlichen Part der Eroberung, der Verführung. Sie unterstreicht in die- sem Gedicht immer wieder die ,,männlichen” Anteile einer Frau und äußert sie selbstbewußt. Doch auch das Metrum wird nicht konsequent durchgehal- ten, sondern immer wieder gesprengt, um doch mehr Rhythmus als Versmaß klingen zu lassen. Mehr Wunsch und Ausbruch, als Konequenz. Jedoch der Kreuzreim wird durch alle Strophen durchgehalten, so wie auch die reinen Reime.
Der kleine behütete Raum, der hier Rückzugsmöglichkeit und Gefangenschaft in einem bedeutet, verzerrt sich in der zweiten Strophe - weg vom Turm, hin zum See, der vor ihr liegt, an dem das Leben pulsiert. ,,Oh springen möcht’ ich hinein alsbald,”5 heißt es hier. Man mag vermuten, daß es ein hoffnungs- loser Wunsch war, da es sich in diesen Zeiten nicht geziemte in einem See zu schwimmen. Doch auch der See verwandelt sich schließlich in etwas viel gewaltigeres, wird gleichsam zum Weltmeer mit Korallen und Walrossen. Die auf das Häusliche begrenzte Welt des lyrischen Ichs weitet sich in eine freie Welt, umgeben von wilder Natur und Aktivität. Der beschleunigte Rhyth- mus trägt den Leser gleichsam mitfort, hinaus auf die See. Und Worte wie Mänaden, Walrosse und Korallen verweisen auf eine andere fremdländische Welt, weitab der behüteten, aber auch begrenzten Welt einer Frau im Turme.
In den nächsten beiden Strophen steigern sich die Vorstellungen und es ist vermehrt von männlichen Domänen die Rede. So sieht sich das lyrische Ich als Steuermann, Jäger und Soldat - es sieht sich ,,[...] zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen.”6, bis es schließlich gipfelt in dem Satz:,,Wär ich ein Mann doch mindestens nur,/ so würde der Himmel mir raten”7 ,,Drostes Aufbruchsphantasien rebellieren gegen die Begrenzungen des weiblichen Elfenbeinturms.”8
[...]
1 Adelige Frauen im bürgerlichen Jahrhundert, Christa Diemel, S. 15
2 Kleine Kostümkunde, Krause/Lenning, S.179-180
3 Frankfurter Anthologie, Band 18, Ruth Klüger, S.61
4 Das Fremdwörterbuch, DUDEN
5 Annette von Droste-Hülshoff, Sämtliche Werke, Am Turme, Strophe 2, V 5
6 Ebenda, Strophe 3, V 7-8
7 Ebenda, Strophe 4, V 3-4
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Frauenbild in Drostes Lyrik und Zeit"?
Der Text untersucht das Frauenbild in den Gedichten von Annette von Droste-Hülshoff im Kontext ihrer Zeit, insbesondere der Biedermeierzeit. Er analysiert die Stellung der adeligen Frau, ihre Lebenswelten, Träume und die Frage, inwieweit Droste-Hülshoff als emanzipierte Frau betrachtet werden kann.
Welche biografischen Aspekte von Annette von Droste-Hülshoff werden behandelt?
Der Text geht auf die widersprüchliche Zeit ein, in der Droste-Hülshoff (1797-1848) lebte, zwischen Revolution und Restauration. Er erwähnt ihre Privilegien als adelige Frau, aber auch die Zwänge und Verhaltensregeln, denen sie unterworfen war.
Welche Frauenbilder werden im Biedermeier unterschieden?
Es werden zwei Hauptfrauenbilder unterschieden: die Landedelfrau, die für die Hauswirtschaft und Caritas zuständig war, und die höfische Dame, von der geistige, ästhetische Fähigkeiten und Kenntnis der Etikette erwartet wurden.
Welche Rolle spielt das Gedicht "Am Turme" in der Analyse?
Das Gedicht "Am Turme" dient als Ausgangspunkt, um das Rollenverständnis der Frau in der Epoche zu untersuchen. Der Turm wird als Symbol für Gefangenschaft und Distanz zur Außenwelt interpretiert, während die Sehnsucht nach Ausbruch thematisiert wird.
Welche Symbole werden im Gedicht "Am Turme" analysiert?
Neben dem Turm werden auch die Haare als Symbol für Freiheit im Gegensatz zu den adeligen Konventionen betrachtet. Sie stehen für lustvolle, freie sexuelle Phantasien. Die Verwendung von Begriffen wie "Mänade" wird ebenfalls analysiert, um die Rebellion gegen die Begrenzungen des weiblichen Daseins zu verdeutlichen.
Welche literarischen Mittel werden im Gedicht "Am Turme" hervorgehoben?
Der Text betont die aktive Wortwahl, die die "männlichen" Anteile einer Frau selbstbewusst äußert. Es wird auch auf das Metrum und den Rhythmus des Gedichts eingegangen, der mehr Wunsch und Ausbruch als Konsequenz vermittelt.
Welche Bedeutung hat die Beschreibung von Räumen im Text?
Die Räume, insbesondere der Turm und der See, werden als Symbole für Gefangenschaft bzw. Freiheit und Ausbruch interpretiert. Die Erweiterung des Raumes vom Turm zum Weltmeer verdeutlicht die Sehnsucht nach einer unbegrenzten Welt.
Was sind die Schlussfolgerungen des Textes über Droste-Hülshoff und das Frauenbild ihrer Zeit?
Der Text zeigt, dass Droste-Hülshoff in ihren Gedichten die Begrenzungen des weiblichen Daseins in Frage stellt und eine Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung zum Ausdruck bringt. Sie rebelliert gegen die traditionellen Geschlechterrollen und äußert selbstbewusst ihre "männlichen" Anteile.
- Quote paper
- Miriam Oberle (Author), 2003, Annette von Droste-Hülshoff - Frauenräume und Frauenträume, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108787