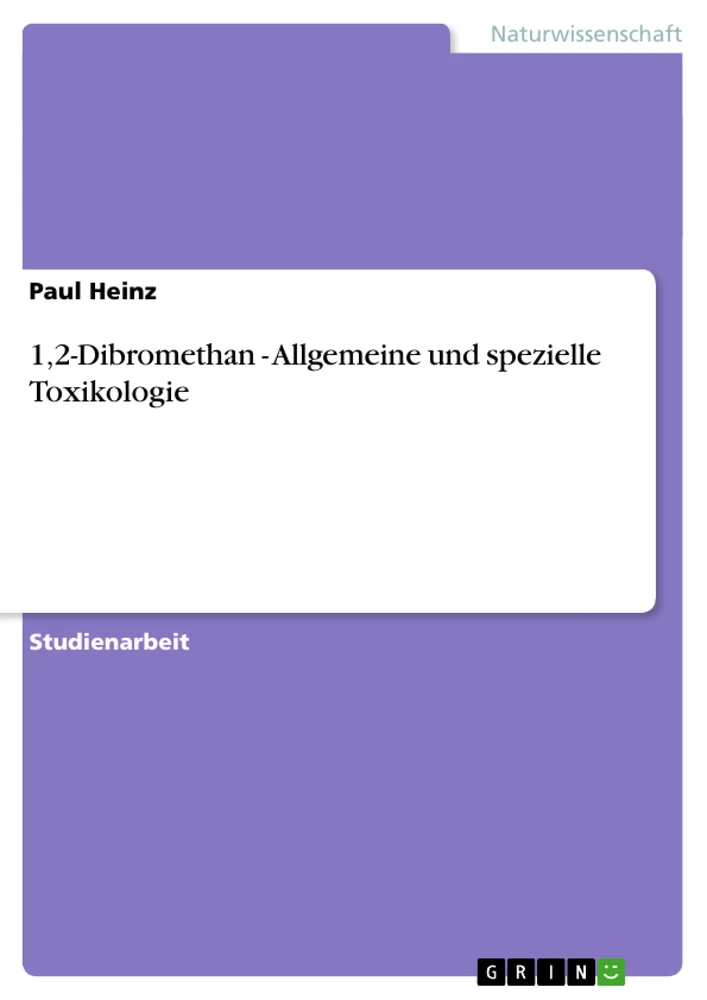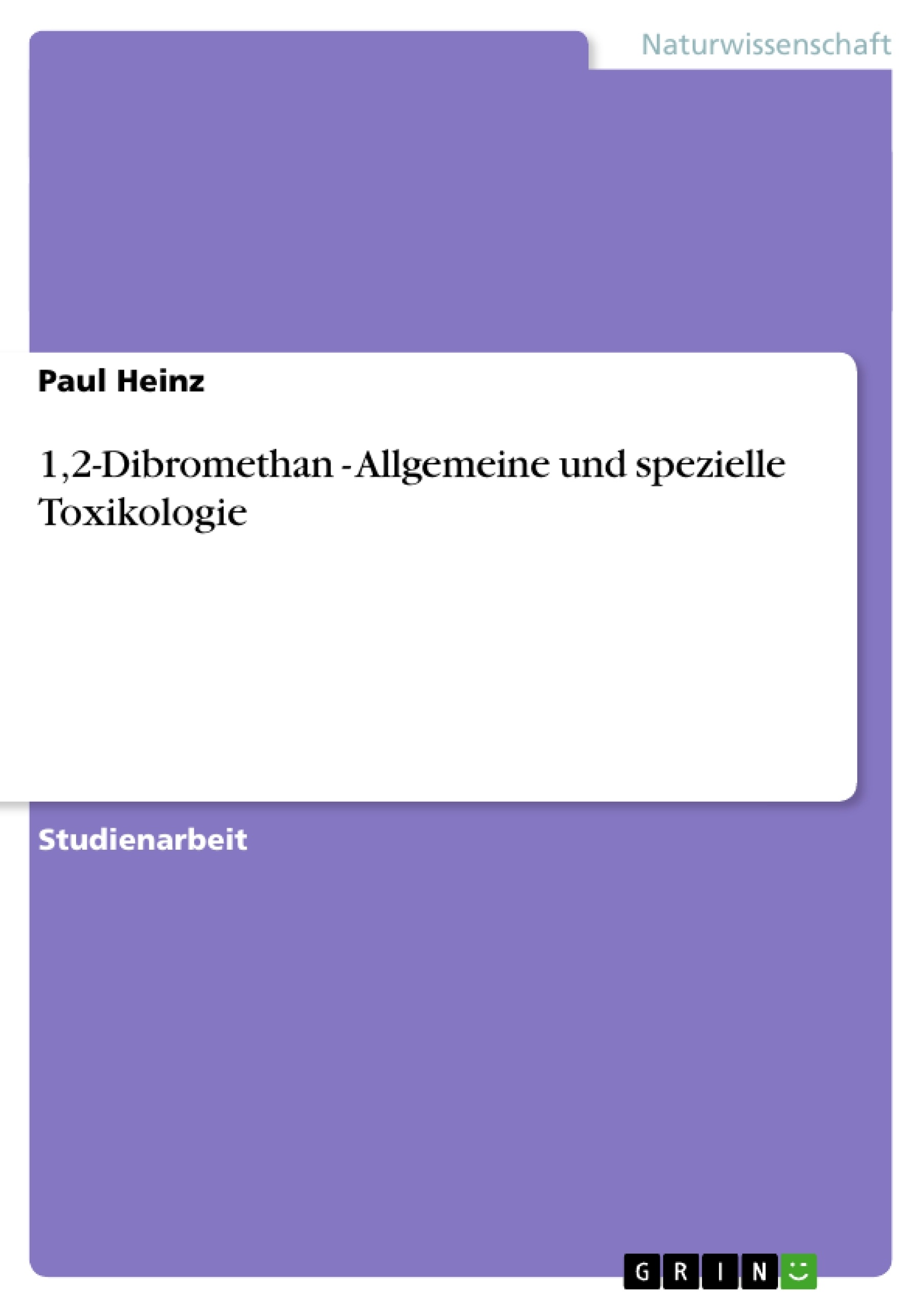Stellen Sie sich eine Welt vor, in der scheinbar harmlose Substanzen im Stillen unsere Gesundheit und Umwelt bedrohen. Dieses Buch enthüllt die vielschichtige Geschichte von 1,2-Dibromethan (EDB), einer chemischen Verbindung, die einst als Wundermittel in der Landwirtschaft und als wichtiger Bestandteil von Treibstoffen galt. Tauchen Sie ein in eine detaillierte Analyse der physikalischen und chemischen Eigenschaften von EDB, von seiner Synthese und vielfältigen Anwendungen bis hin zu den komplexen analytischen Methoden, die für seinen Nachweis erforderlich sind. Erfahren Sie mehr über die toxikologischen Eigenschaften dieser Substanz, die von akuten Vergiftungserscheinungen bis hin zu chronischen Gesundheitsschäden und sogar Krebs reichen. Die umfassende Untersuchung der Wirkungsmechanismen und Schadwirkungen von EDB wirft ein beunruhigendes Licht auf die potenziellen Gefahren für Mensch und Umwelt. Das Buch beleuchtet auch die therapeutischen Maßnahmen, die bei Vergiftungen mit EDB ergriffen werden können, sowie die gesetzlichen Bestimmungen, die den Umgang mit dieser gefährlichen Substanz regeln. Von der Gefahrstoffverordnung über das Abfallgesetz bis hin zu Transportvorschriften und Gewässerschutzbestimmungen – ein vollständiger Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Leitfaden für Wissenschaftler, Umweltbeauftragte, Sicherheitsfachkräfte und alle, die sich für die Risiken und regulatorischen Aspekte von Chemikalien interessieren. Es bietet nicht nur einen tiefen Einblick in die spezifischen Eigenschaften von EDB, sondern sensibilisiert auch für die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit chemischen Substanzen im Allgemeinen. Die detaillierten Informationen zu Grenzwerten, Giftklassifizierungen, R- und S-Sätzen sowie Gefahrensymbolen machen dieses Buch zu einem wertvollen Nachschlagewerk für den sicheren Umgang mit EDB im Labor, in der Industrie und im Umweltschutz. Entdecken Sie die verborgenen Gefahren und lernen Sie, wie wir uns und unsere Umwelt schützen können.
Inhaltsverzeichnis:
1. Substanzbezeichnung
2. Strukturformel, Summenformel
3. Kenn-Nummern und Codes
4. Physikalische und chemische Eigenschaften
5. Vorkommen und Synthese
6. Verwendung
7. Analytik
8. Toxikologische Eigenschaften
9. Therapeutische Maßnahmen
10. Gesetzliche Bestimmungen
11. Kennzeichnungen
12. Literaturangaben
1. Substanzbezeichnung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Struktur-, Summenformel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Kenn-Nummern und Codes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4. Physikalische und chemische Eigenschaften
4.1 Physikalische Eigenschaften
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Chemische Eigenschaften
Unter Lichteinwirkung langsame, autokatalytische Zersetzung von EDB unter Freisetzung von Brom.
Ab 340 °C wird, unter Bildung von Vinylbromid, HBr frei.
EDB ist eine alkylierende Verbindung, welche leicht nucleophile Substitutionsreaktionen vom Typ SN2 eingeht.
Sie reagiert heftig mit Leichtmetallen wie Na, K, Mg, Al, sowie mit starken Basen und Oxidationsmitteln.
Unter Wassereinwirkung entsteht Ethylendiglycol, unter Säureeinwirkung Acetaldehyd.
5. Vorkommen und Synthese
5.1 Vorkommen
Natürliche Quellen:
Natürliche Quellen sind nicht bekannt. EDB gehört nicht zu den Bromverbindungen, welche von marinen Mikroalgen gebildet werden können.
(z.B.: CH2Br2, CHBr3, CHBr2Cl, CHBrCl2; [5])
Vorkommen in der Atmosphäre:
In der Atmosphäre kam EDB in der Vergangenheit gehäuft in der Nähe von automobiler Infrastruktur wie Tankstellen, Autobahnen oder großen Parkhäusern vor.
Seit der Reduzierung (ab den 70er Jahren), und schließlich des Verbots Bleihaltiger Zusatzstoffe in Automobiltreibstoffen [7,8], sanken die Werte drastisch.
Heutzutage werden erhöhte Werte für EDB in der Nähe von Militärflughäfen gemessen.
5.2 Synthese
Großtechnische Verfahren:
Das am häufigsten angewandte Verfahren ist die Bromierung von Ethen in der Gasphase[12]. Dabei werden die Reaktionspartner in einer gepackten Kolonne im Gegenstrom zusammengebracht; aufgrund des stark exothermen Charakters der Reaktion wird die entstandene Wärme mithilfe eines Wärmetauschers abgeführt.
Das entstandene EDB wird kontinuierlich der Reaktion entzogen und Reste der Reaktionspartner werden durch UV-Bestrahlung zerstört.
Ein anderes Verfahren ist die Reaktion von Brom und Ethen in Wasser und etwas EDB als Lösungsmittel.
In der Bundesrepublik Deutschland wird 1,2-Dibromethan derzeit industriell nicht hergestellt, jedoch werden mehrere t/a eingeführt und verarbeitet (VCI 1999).
Synthese im Labormaßstab:
Im Labormaßstab gibt’s es unzählige Wege EDB herzustellen. Die gebräuchlichsten sind:
- Nucleophile Substitution
- Bromierung von Acetylen mit HBr
- Katalytische Bromierung von 1-Bromethan
6. Verwendung
In der Vergangenheit wurde das EDB hauptsächlich als Zusatz zu Antiklopfmitteln für Automobiltreibstoffe (Scavenger), verwendet.
Zusammen mit 1,2-Dichlorethan hatte es die Aufgabe, das aus den Antiklopfmitteln Tetraethyl- und Tetramethylblei entstandene Verbrennungsprodukt Bleioxid in die leicht flüchtigen Verbindungen Bleibromid und Bleichlorid zu überführen.
Im laufe der 70er und 80er Jahre wurde der Bleigehalt der Treibstoffe stark herabgesetzt, und am Ende der 90er Jahre schließlich verboten [7,8]. Somit befindet sich in den heutigen Bleifreien Kraftstoffen auch kein EDB mehr.
In den USA wurde EDB in großem Maßstab als Pflanzenschutzmittel auf Obstbäumen und Böden eingesetzt. Dabei zeichnete es sich durch seine insektizide und nematozide Wirkungsweise aus.
Außerdem fand es Anwendung als Vorratsschutzmittel bei Getreide und lagernden Früchten und Gemüse.
In europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder dem Vereinigten Königreich wurde EDB ebenfalls als Insektizid eingesetzt.
Die Verwendung als Pflanzenschutzmittel wurde in den USA 1983 stark eingeschränkt, und in Europa 1987 verboten [11].
In Deutschland wurde diese Verwendungsart nie freigegeben.
Heute ist der wichtigste Verwendungszweck von EDB die organische Synthese, wo es bei C-C-Kupplungsreaktionen (u.a. bei der Kautschukherstellung) eine große Rolle spielt. Es wird auch über Einsatzmöglichkeiten als nicht brennbares Lösungsmittel berichtet [12].
Es wird vermutet, dass dem in den USA hergestelltem, universell verwendbarem NATO-Treibstoff Jet Propellant (JP) 8, ungeachtet seiner extrem gesundheitheitsschädlichen Wirkung, EDB immer noch als Scavenger beigemischt wird [13].
7. Analytik
7.1 Allgemeine Analytik
Da EDB eine leichtflüchtige und nahezu unpolare Verbindung ist, ist als Trennungsmethode die Gaschromatographie vorteilhaft. Nach DIN-Entwurf 38 407 Teil 4, ist der Einsatz von mindestens zwei Chromatographiesäulen mit unterschiedlichen stationären Phasen unterschiedlicher Polaritäten vorgeschrieben.
Wegen seiner hohen Empfindlichkeit gegenüber Organo-Halogenverbindungen wird zur Detektion vorzugsweise ein ECD (elctron-capture-detector) verwendet. Eine Andere Detektionsart wäre die Mikrowellenplasma-Methode, oder bei hohen Konzentrationen der FID (flame-ionisation-detector).
Zur Verifizierung der Ergebnisse wird meistens eine Gaschromatograph-Massenspektrometer-Kombination (GC/MS) angewandt.
Massenspektrum EDB:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1, Lit.: [14]
7.2 Probennahme in Wasser und Luft
Wasserproben müssen aufgrund der Photochemischen Aktivität des EDB in Braunglasflaschen abgefüllt und innerhalb von 24 h extrahiert werden. Als Extraktionsmittel kann z.B. Pentan verwendet werden.
Luftproben können durch Einpumpen in Probegefäße, Belüftung vorher evakuierter Behälter oder durch Adsorption/Desorption auf geeigneten Trägermaterialien entnommen werden.
Sowohl Wasser- als auch Luftproben können anschließend mit einer der oben genannten Techniken aufgetrennt und analysiert werden.
7.3 Probennahme im Boden, Sediment und biologischem Material
Die Extraktion von Boden- und Sedimentmaterial ist meist schwierig und die Identifikation mit niedrigen Wiederfindungsraten behaftet. Die wirkungsvollste Methode ist die Extraktion über 24 h bei 75 °C in Methanol, und die anschließende Überführung des EDB in Hexan. [15]
Die Extraktion von biologischem Material wie z.B. Früchte, Gemüse oder Getreide ist meist mithilfe einer Wasserdampfdestillation zu bewerkstelligen.
7.4 Bestimmung im Labor
Neben den oben genannten Methoden sind in Laboratorien auch noch die NMR-Spektroskopie oder die IR-Spektroskopie relevante Analysemethoden.
1H-NMR-Spektrum EDB:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2, Lit.: [14]
13C-NMR-Spektrum EDB:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenAbb. 3, Lit.: [14]
IR-Spektrum EDB:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4, Lit.: [14]
8. Toxikologische Eigenschaften
8.1 Toxikokinetik
8.1.1 Aufnahme
EDB wird schnell über Lunge, Haut und Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Hauptzielorgane im menschlichen Körper sind Leber und Nieren.
Im Versuch mit Ratten und Hühnern wurden nach oraler Aufnahme nach 5 bis 30 min maximale Blutspiegel festgestellt [16]. Nach inhalativer Aufnahme wurde bei Ratten nach 10 bis 20 min ein Maximum beobachtet [17]. Nach dermaler Applikation wurden bei narkotisierten Meerschweinchen nach ca. 1h Maxima festgestellt [18].
8.1.2 Verteilung
Wie oben schon erwähnt sind Leber und Niere die Hauptziele im Organismus. Aber auch in den Epithelien und Schleimhäuten des oberen Verdauungstraktes und der Atemwege, sowie in den Hoden und im Fettgewebe, wurden bei Versuchen mit radioaktiv markiertem EDB, bei verschiedenen Spezies hohe Konzentrationen des Stoffes gefunden.
8.1.3 Metabolismus
Der Metabolismus von EDB kann beim Menschen durch zwei verschiedene Reaktionswege beschrieben werden (Abb. 5).
Der sog. Konjugationsweg läuft über die direkte Konjugation von Glutathion (GSH) mittels GSH-Transferase an EDB unter Bildung von S-(2-Bromethyl)glutathion, welches durch eine Umlagerung einen reaktiven Metaboliten, das Thiiranium-Ion-Intermediat, hervorbringen kann [20]. Dieses Intermediat kann nun zu Ethen zerfallen, oder - was die eigentliche Gefährdung darstellt - zelluläre Makromoleküle (z.B. DNA) angreifen.
Bei dem anderen Weg - dem sog Oxidationsweg - wird EDB mittels mikrosomalen Enzymen (Cytochrom P-450 - System) zu 2-Bromacetaldehyd oxidiert, und anschließend mittels zytosolischen GSH-Transferasen an Glutathion konjugiert, wobei ebenfalls S-2-Hydroxyethylglutathion entsteht [19].
Der Angriff auf die zelluläre DNA durch das Thiiranium-ion erfolgt über das Guanin [21]. Das entstandene Addukt behindert die Quervernetzung der DNA-Bestandteile [22].
Anders als bei der Ratte, wo nur über den Konjugationsweg entstandene reaktive GSH-Dibromethanverbindungen an die DNA binden können [23], wurden bei in-vitro-Versuchen an menschlichen Lebermikrosomen Hinweise
gefunden, dass auch über den Oxidationsweg entstandene reaktive Verbindungen an die DNA binden können [24].
Dies ist insofern von Bedeutung, weil der Oxidationsweg bei der Ratte, möglicherweise auch beim Menschen mit 4:1 gegenüber dem Konjugationsweg überwiegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5; Lit.: [19]
8.1.4 Ausscheidung
Die Ausscheidung von EDB erfolgt hauptsächlich in Form des wasserlöslichen Metaboliten Mercaptursäure über die Nieren; ein Teil wird auch unverändert über die Lungen abgeatmet [25].
8.2 Wirkungsmechanismus
Als die nicht-gentoxische und nicht-cancerogene Wirkung des EDB ist vor allem die Beeinflussung des GSH-Spiegels anzusehen. So kann eine einmalige kurzfristige Applikation zu einer Erniedrigung des GSH-Spiegels führen. Dies ermöglicht eine verstärkte Lipidperoxidation und folglich eine Schädigung der Zellmembran.
8.3 Symptomatik und Schadwirkungen
8.3.1 Hauptwirkungsweisen beim Menschen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.3.2 Akute Toxizität
Am Kaninchenauge verursachte D. als reine Flüssigkeit oder 10%ige Lösung in Propylenglycol Reizungen der Schleimhäute und oberflächliche, nach 12 Tagen reversible Hornhaut-schädigungen. Auch Dämpfe führen in höheren Konzentrationen zu Reizungen an den Augenschleimhäuten.
Okklusiver Hautkontakt (1 h) mit unverdünnter Flüssigkeit bewirkte am Meerschweinchen histologisch objektivierbare Veränderungen in der Epidermis (Kernpyknose, perinucleäres Ödem, fortschreitende Auflösung des Zellverbandes und verzögert auftretende Infiltration pseudoeosinophiler Zellen.
Bei Ratten wurden, nach einer sechsstündigen Exposition bei 5000 mg/m3, Erbrechen, Zittern und Hyperkinesen festgestellt. Bei höheren Konzentrationen wurden zentrale Depressionen beobachtet [26].
In einer älteren Studie am Menschen wurde eine Hautsensibilisierung beobachtet, jedoch tierexperimentell noch nicht untersucht.
Informationen über inhalative Vergiftungen resultieren aus der irrtümlichen Verwendung von EDB als Narkotikum und aus berufsbedingten Expositionen: Irritationen und Läsionen an den Schleimhäuten, Husten,
Schwindel, Erbrechen, Diarrhoe, Kopfschmerzen, thorakale und abdominelle Schmerzen, sowie Leber- und Nierenschäden.
Als niedrigste tödliche Konzentration für den Menschen wurde eine 30 min-LCLo von 215 mg/m3 angegeben.
Die Ingestion von 4,5 ml D. rief bei einer Frau eine starke Erhöhung der Herzfrequenz, erhebliche Nierenfunktionsstörungen (Anurie), Schüttelkrämpfe und den Tod nach 54 h hervor. Bei der Sektion wurden massive Leber- und Nierenschäden festgestellt.
An verschiedenen Tierarten fand man orale LD50-Werte zwischen 55 und 420 mg/kg KG. Für den Menschen wurden 200 mg/kg KG als letale Dosis abgeschätzt.
8.3.3 Chronische Toxizität
Zur wiederholten Exposition des Menschen liegen nur wenige, schlecht dokumentierte Informationen vor. Als Symptome wurden Konjunktivitis, Schwellungen der Lider, Irritationen im Bereich des Kehlkopfes und der Bronchien referiert.
In mehreren inhalativen Tierexperimenten ergaben sich bei Ratten teilweise reversible Schäden an den Atmungsorganen (Hyperplasien und Nekrosen des Nasen-, Bronchial- und Lungenepithels, bzw. Atrophie und Nekrose des Riechepithels) [27].
Weitere Zielorgane waren Leber und Niere (Gewichtszunahme, Leberverfettung und -zellnekrose, Nephropathien), Nebenniere (Degeneration), Hoden (Degeneration und Atrophie) sowie Milz (Atrophie und Hämosiderose)[28].
In einer Untersuchung zur oralen Applikation mittels Schlundsonde, wurden bei Ratten Läsionen im Vormagen festgestellt Da aber nur der Magen untersucht wurde, dürfen Schädigungen an anderen Organen nicht ausgeschlossen werden [29].
Bei Verabreichung von 500 ppm EDB im Futter wurden an männlichen Albinoratten marginale Effekte (Erhöhung des Proteingehalts im Serum) beobachtet.
Bei einer Dosis von 250 ppm zeigten sich bei pathologischen, histopathologischen oder klinisch-chemischen Untersuchungen keine Veränderungen.
8.3.4 Gentoxizität
Den Beleg für die mutagene Wirkung von EDB gaben mehrere Ames-Tests mit pro- und eukaryontischen Mikroorganismen (z.B. Salmonella typhimurium), sowie in-vitro-Experimente mit verschiedenen Pilzen und Hefen (z. B. Neuropspora crassa oder Saccharomyces cerevisiae).
Außerdem bestätigten in-vivo-Experimente mit Drosophila-Fliegen und verschiedenen Säugern (hauptsächlich Mäuse und Ratten) die mutagene Wirkung von EDB.
Zur Gentoxizität am Menschen wurden nur wenige Versuche durchgeführt, die allerdings ergebnislos blieben [30].
8.3.5 Cancerogenität
Zur Untersuchung der Cancerogenität von EDB wurden Tests an verschiedenen Tieren mit inhalativer, oraler und dermaler Applikation durchgeführt.
Aus den dadurch erhaltenen Daten kann eine stark cancerogene Wirkung beim Menschen Abgeleitet werden.
8.3.6 Reproduktionstoxizität
Langzeitexposition gegenüber EDB über 5 Jahre hat bei Expositions-konzentrationen von 0,68 mg/m3 eine signifikant erniedrigte Spermienzahl und Fertilitätsstörungen bei beruflich exponierten Personen verursacht [33].
Diese reproduktionstoxikologische Wirkung wurde in mehreren Tierversuchen bestätigt [31];[32].
8.3.7 Fruchtschädigende Wirkung
Zur Fruchtschädigenden Wirkung des EDB wurden Experimente an Ratten und Mäusen durchgeführt, wobei embryotoxische und teratogene Wirkungen nur bei maternal toxischen Dosierungen (160 mg/m3, 23 h/d) festgestellt wurden. Dabei erwiesen sich Ratten unempfindlicher als Mäuse.
8.3.8 Immuntoxizität
Spezielle Untersuchungen zu diesem Thema liegen nicht vor.
8.4 Toxikologische Daten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.5 Ökotoxikologische Bedeutung
8.5.1 Wirkungen auf terrestrische Lebewesen und Pflanzen
Bei terrestrischen Mikroorganismen wurden bei Applikation von EDB zum Teil erhebliche Schadwirkungen beobachtet. Das beeinflusste einige wichtige Faktoren der Landwirtschaft wie den mikrobiellen Acetat-Abbau, die Mineralisierung organischen Stickstoffs in Böden, die Nitrifikation oder die CO2-Produktion sehr negativ [35].
Bei Begasung von Pflanzen mit EDB wurden Einflüsse auf die Ethenbildung und die Respiration der Pflanzen festgestellt. Bei Kirschen z.B. verursachte diese Behandlung bereits bei niedrigen Dosierungen nach kurzer Zeit einen Pilzbefall. Bei Karotten bewirkte sie andererseits eine Gewichtszunahme.
Der Einsatz von EDB als Insektizid beruht auf seiner stark toxischen Wirkung gegenüber Invertebraten (Wirbellosen).
8.5.2 Wirkungen auf aquatische Lebewesen und Pflanzen.
Wie bei den terrestrischen Lebewesen bewirkt EDB nachweislich auch bei auquatischen Mikro-Organismen und Pflanzen starke Hemmungen der Zellteilung und somit des Wachstums.
9. Therapeutische Maßnahmen
9.1 Akute Maßnahmen
Nach direktem Augenkontakt mit der Flüssigkeit sollte nach Erstbehandlung (Spülung mit physiol. Kochsalzlösung oder Isogutt, notwendigenfalls Schmerzbekämpfung und Abdecken) sofort eine fachärztliche Weiterbehandlung erfolgen.
Hautkontakt erfordert eine besonders gründliche Dekontamination mit zunächst warmem, dann sehr warmem Wasser. Zur Reextraktion von bereits oberflächlich gebundenem EDB wurde eine Zwischenspülung mit PEG 400 empfohlen.
Eine stationäre Beobachtung hinsichtlich evtl. auftretender Resorptiv-wirkungen wird - zumindest nach intensivem Kontakt – unbedingt empfohlen.
Inhalative Aufnahme von Dämpfen erfordert in jedem Falle die Fortsetzung bzw. den sofortigen Beginn einer Lungenödemprophylaxe mit Gluco-corticoiden.
Ein Kreislaufkollaps, der nach schweren Vergiftungen auftreten kann, darf nicht mit Catecholaminen therapiert werden, da infolge möglicher kardialer Sensibilisierung die Gefahr von Arrhythmien bzw. Kammerflimmern besteht.
Stattdessen sollten Glucose i.v. und Hypertensin verabreicht werden.
Nach Ingestion kann eine Magenspülung (in Intubation) durchgeführt werden. Anschließend besonders reichlich A-Kohle sowie Laxantien applizieren. [34]
9.2 Maßnahmen bei chronischen Vergiftungen
Aufgrund mangelnder Informationen über chronische Vergiftungen bei Menschen, ist auch über deren Behandlungsweisen wenig bekannt.
10. Gesetzliche Bestimmungen
10.1 Gefahrstoffverordnung
EDB und EDB-haltige Zubereitungen dürfen nur an Sachkundige gemäß §12, Abs. 2 GefStoffV abgegeben werden; die Lagerung hat nach Richtlinien gemäß § 24 GefStoffV zu erfolgen. mit Ausnahme von EDB-haltigen Ottokraftstoffen sind EDB und EDB-haltige Zubereitungen unter Verschluss oder so aufzubewahren, dass nur sachkundige Personen oder deren Beauftragte Zugang haben.
10.2 Abfallgesetz
Nach der, auf der Grundlage des § 2, Abs. 2 AbfG und der AbfBestV erlassenen, zweiten allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Abfallgesetz (TA Abfall) vom 10.04.1990 gelten Reststoffe und Abfälle von EDB als besonders überwachungsbedürftiger Abfall und sind somit nach § 11, Abs. 2 AbfG in Verbindung mit den Vorschriften der AbfRestÜberwV automatisch nachweispflichtig.
10.3 Bundesemissionsschutzgesetz
Nach der Technischen Anleitung zu Reinhaltung der Luft (TA Luft, 1986), Nr. 2.3, fällt EDB in die Klasse III der krebserzeugenden Stoffe; für diese gilt ab einem Massestrom von 25 g/h eine Massenkonzentration von 5 mg/m3, die nicht überschritten werden darf.
In der 12. BImschV ist EDB im Anhang II unter der laufenden Nummer 105 aufgeführt. Danach unterliegen emmissionsschutzrechtlich genehmigungs-pflichtige Anlagen, in denen EDB nicht nur in sehr geringfügigen Mengen entsprechend der 1. Verwaltungsvorschrift zur Störfall-VO im bestimmungsmäßigen Betrieb vorhanden sein, oder bei dessen Störung entstehen kann, den besonderen Anforderungen der Störfall-VO.
10.4 Pflanzenschutzmittelgesetz
Die Anwendung von EDB als Pflanzenschutzmittel ist in der Bundesrepublik seit 1988 vollständig verboten (Pflanzenschutzanwendungsverordnung, 1988, § 1). Pflanzgut, das EDB enthält, darf nach der gleichen Verordnung (§ 5) nicht mehr eingeführt werden.
Nach der 2. Verordnung zur Änderung der Pflanzenschutzmittel-Höchstmengenverordnung (1988) ist in der BRD der Gehalt von EDB in allen Pflanzlichen Lebensmitteln auf 0.01 mg/kg begrenzt.
10.5 Transportvorschriften
Nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (GBgG) ist EDB wie folgt klassifiziert:
Gefahrgutverordnung Eisenbahn (GGVE):
Klasse 6.1, Rn 601, Ziffer 15b
Gefahrgutverordnung Straße (GGVS):
Klasse 6.1, Rn 2601, Ziffer 15b
Gefahrgutverordnung Binnenschiffahrt (GGVBiSchi):
Klasse 6.1, Rn 6601, Ziffer 15b
Gefahrgutverordnung See (GGVSee):
Klasse 6.1, D 6249
IATA Dangerous Goods Regulations (ICAO/IATA-DGR):
Klasse 6.1, UN-Nr. 1605
Gefahrzettel: 6.1 Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10.6 Gewässerschutz
EDB gehörte zur Vorschlagsliste der Komission der EG für wasser-gefährdende Stoffe (Kommission der EG, 1982)
EDB ist in der Wassergefärdungsklasse 3 (WGK 3) - stark wassergefährdend eingeordnet (Kenn-Nr. 241).
EDB ist in der Anlage 1 der Hessischen Indirekteinleiterverordnung als gefährlicher Stoff im Sinne des hessischen Wassergesetzes genannt. Als Schwellenwerte sind eine Konzentration von 0.2 mg/l und eine Fracht von 4g/h festgelegt.
10.7 Entsorgung
Abfälle dürfen nur[35] beseitigt werden, wenn eine Verwertung nicht möglich ist. Entsorgung erfolgt durch: Sonderabfallverbrennung – SAV
Sammlung von Kleinmengen: In Sammelbehälter für giftige entzündliche Verbindungen geben. Sammelgefäße sind deutlich mit der systematischen Bezeichnung ihres Inhaltes zu beschriften und mit Gefahrensymbolen und R- und S-Sätzen zu versehen. Gefäße an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Der zuständigen Stelle zur Abfallbeseitigung übergeben.
11. Kennzeichnungen
11.1 Grenzwerte
Abbildung in dieser[36] Leseprobe nicht enthalten
11.2 Giftklassifizierungen
Schweizer Giftklasse: 1* - sehr starke Gifte (cancerogen, mutagen, teratogen)
11.3 R- und S-Sätze
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.4 Gefahrensymbole
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten (Giftig) Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten (Umweltgefährlich)
11.5 Verbotszeichen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.6 Gebotszeichen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
11.7 Warnzeichen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
12. Literaturangaben
[...]
[1] Weast, R.C.; Astle M.J.; Beyer, W.H.;CRC Handbook of Chemistry and Physics,68, (1987-88), C-264
[2] Heston, Jr., W.M.; Hennely, E.J.; Smyth, C.P.; Dielectric constants, viscosities, densities, refractive indices and dipole moment calculations for some organic halides;J. Am. Chem. Soc.,72, (1950), 2071-2075
[3]Merck ChemDAT,2.4.0(2002/1)
[4] Mumford, S.A.; Phillips, J.W.C.; The physical properties of some aliphatic compounds.;J. Chem. Soc.; (1950); 75-84
[5] Class, Th.; Ballschmiter, K.; Chemistry of organic traces in air. VIII. Sources and distribution of bromo- and bromochloromethanes in marine air and surfacewater of the Atlantic Ocean.;J. Atmos.Chem.;6; (1988); 35-46
[6] Stull, D.R.; Vapor pressure of pure substances.;Ind. Eng.Chem.;39; (1974); 517-540
[7] 10. BlmSchV, Verordnung über die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen, 2. Änderung, (22.12.1999)
[8] Mineralölwirtschaftsverband e.V., schriftliche Mitteilung, (03.04.2000)
[9] Gross, P.M.; Saylor, J.H.; The solubilities of certain slightly soluble organic compounds in water.;J. Am. Chem. Soc.;53; (1931); 1744-1751
[10] Stenger, V.A.; Bromine compounds;Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 3. Aufl.;4; (1978); 243-263
[11]Rat der EG, (1987)
[12] Dagani, M.J.; Barda, H.J.; Benya, T.J:; Sanders, D.C.; Bromide compounds;Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th completely rev. ed.;A4; (1985); 405-429
[13] http://www.ig-oekoflughafen.de/Downloads_frei_1/Gefahr_aus_dem_Triebwerk.exe
[14] http://www.aist.go.jp/RIODB/SDBS/sdbs/owa/sdbs_sea.cre_frame_disp?sdbsno=1566
[15] Steinberg, S.M.; Pignatello, J.J.; Sawhney, B.L.; Persistance of 1,2-dibromoethane in soils: entrapment in intraparticle micropores.;Environ.Sci. Technolog.;21; (1987); 1201-1208
Sawhney, B.L.; Pignatello, J.J.; Steinberg, S.M.; Determination of 1,2-dibromoethane in field soils: Implications for volatile organic compounds.;J. Environ. Qual.;17; (1988); 149-152
[16] Nachtomi, E.; Alumot, E.; Bondi, A.; Metabolism of halogen containing fumigants in mammalians and birds.;Pestic. Chem. Prot. Int. Congr. Pestic. Chem. 2nd.;6; (1972); 495-501
[17] Scott, B.R.; Sparrow, A.H.; Schwemmer, S.S.; Schairer, L.A.; Plant metabolic activation of 1,2-dibromoethane to a mutagene of greater potency.;Mutat. Res.;49; (1984); 203-212
[18] Jakobson, I.; Wahlberg, J.E.; Holmberg, G.; Johansson, G.; Uptake via the blood and elimination of 10 organic solvents following epicutaneous exposure to anesthetized guinea-pigs.;Toxicol. Appl. Pharmacol.;63; (1982); 181-187
[19] Van Bladeren, P.J.; Breimer, D.D.; Rotteveel-Smijs, G.M.T.; de Jong, R.A.W.; Buijs, W.; van der Gen, A.; Mohn, G.R.; The role of glutathion conjugation in the mutagenicity of 1,2-dibromoethane.;J. Biochem.Pharmacol.;29; (1980); 2975-2982
[20] Hill, D.L.; Shih, T.W.; Johnston, T.P.; Struck, R.F.; Macromolecular binding and metabolism of the carcinogen 1,2-dibromoethane.,Cancer Res.,38, (1978), 2438-2442;
Banerjee, S.; Van Duuren, B.L.; Binding of carcinogenic halogenated hydrocarbons to cell macromolecules.;J. Natl. Cancer Inst.;63; (1979); 707-711
[21] Ozawa, N.; Guengerich, F.P.; Evidence for formation of an S-[2-(N7-guanyl)ethyl]glutathione adduct in glutathion-mediated binding of the carcinogen 1,2-dibromoethane to DNA.;Proc. Natl. Acad. Sci. USA;80; (1983); 5266-5270
[22] Guengerich, F.P.; Peterson, L.A.; Cmarik, J.L.; Koga, N.; Inskeep, P.B.; Activation of dihaloalkanes by glutathion conjugation and formation of DNA-adducts.;Environ. Health Perspect;76; (1987); 15-18
[23] Sundheimer, D.W.; White, R.D.; Brendel, K.; Sipes, I.G.; The bioactivation of 1,2-dibromoethane in rat hepatocytes: covalent binding to nucleic acids.;Carcinogenesis (London);3; (1982); 1129-1133
[24] Wiersma, D.A.; Schnellmann, R.G.; Spies, I.G.; The in vitro metabolism and bioactivation of 1,2-dibromoethane by human liver;J. Biochem. Toxicol.,1, (1986), 1-11
[25] Plotnik, H.B.; Conner, W.L.; Tissue distribution of 14C-labelled ethylene dibromide in the guinea pig.;Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol.;13; (1976); 251-258
[26] Rowe, V.K.; Spencer, H.C.; McCollister, D.D.; Hollingsworth, R.L.; Adams, E.M.; Toxicity of ethylene dibromide determined on experimental animals.;AMA Arch. Ind. Hyg. Occup. Med.;6; (1952); 158-173
[27] Nitschke, K.D.; Kociba, R.J.; Keyes, D.G.; McKenna, M.J.; A thirteen week repeated inhalation study of ethylene dibromide in rats.;Fund. Appl. Toxicol.;1; (1981); 437-442
[28] NTP: Carcinogenesis bioessay of 1,2-dibromoethane in F344 rats and B6C3F1 mice (inhalation study). Report, TR/SER-210, NTP-80-28; Order No. PB82-181710, 165 pp, Avail. NTIS. From: Gov. Rep. Announce. Index (U.S.) 1982,82(13) (1982); 2542
[29] Ghanayem, B.I.; Maronpot, R.R.; Matthews, H.B.; Association of chemically induced forestomach cell proliferation and carcinogenesis.;Cancer Lett. (Ireland);32; (1986); 271-278
[30] Steenland, K.; Carrano, A.; Clapp, D.; Ratcliffe, J.; Ashworth, L.; Meinhardt, T.; Cytogenic studies in humans after short-term exposure to ethylene dibromide.;J. Occup. Med.;27(1985); 729-732
Steenland, K.; Carrano, A.; Ratcliffe, J.; Clapp, D.; Ashworth, L.; Meinhardt, T.; A cytogenic study of papaya workers exposed to ethylene dibromide.;Mutat. Res.;170; (1986); 151-160
[31] NIOSH: Criteria for a recommended standard. Occupational exposure to ethylene dibromide. DHEW (NIOSH) Publication No. 77-221. Exhibit. 4-4 (1977), PB-276621/0
[32] Alexeeff, G.V.; Kilgore, W.W.; Li, M-Y; Ethylene dibromide: toxicology and risk assessment.;Rev. Environ. Contam. Toxicol.;112; (1990); 49-122
[33] Ratcliffe, J.M.; Schrader, S.M.; Steenland, K.; Clapp, D.; Turner, T.; Hornung, R.W.; Semen study of papaya workers exposed to ethylene dibromide.;National Institute for Occupational Safety and Health.; (1984); PB86-221447
[34] GESTIS, Stoffdatenbank (http://www.hvbg.de/d/bia/fac/stoffdb/index.html)
[35] Dommergues, Y.; Influence des nématicides sur l’activité biologique du sol.;Fruits;14; (1959); 177-181
Häufig gestellte Fragen
Was ist 1,2-Dibromethan (EDB)?
1,2-Dibromethan (EDB) ist eine chemische Verbindung, deren Eigenschaften, Vorkommen, Verwendung, Analytik, toxikologische Eigenschaften, therapeutische Maßnahmen, gesetzliche Bestimmungen und Kennzeichnungen in diesem Dokument detailliert beschrieben werden. Es ist ein Stoff, der früher als Zusatz zu Treibstoffen und als Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurde, heutzutage aber hauptsächlich in der organischen Synthese verwendet wird.
Welche physikalischen und chemischen Eigenschaften hat EDB?
EDB hat spezifische physikalische Eigenschaften, die im Dokument aufgeführt sind. Chemisch ist es eine alkylierende Verbindung, die nucleophile Substitutionsreaktionen eingeht und mit Leichtmetallen, starken Basen und Oxidationsmitteln heftig reagieren kann. Es zersetzt sich langsam unter Lichteinwirkung und setzt Brom frei.
Wo kommt EDB vor und wie wird es synthetisiert?
Natürliche Quellen für EDB sind nicht bekannt. In der Vergangenheit fand es sich in der Nähe von Tankstellen und Autobahnen, aber seit dem Verbot von bleihaltigen Treibstoffen sind die Werte gesunken. Industriell wird EDB durch Bromierung von Ethen in der Gasphase oder durch Reaktion von Brom und Ethen in Wasser synthetisiert. Es gibt auch Labormethoden zur Synthese von EDB.
Wie wurde EDB verwendet und welche Verwendungszwecke hat es heute?
Früher wurde EDB als Zusatz zu Antiklopfmitteln für Treibstoffe und als Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Heutzutage wird es hauptsächlich in der organischen Synthese verwendet, insbesondere bei C-C-Kupplungsreaktionen, und es wird über Einsatzmöglichkeiten als nicht brennbares Lösungsmittel berichtet.
Wie wird EDB analysiert?
EDB wird typischerweise mittels Gaschromatographie (GC) analysiert, wobei ein Electron-Capture-Detektor (ECD) bevorzugt wird. Zur Verifizierung der Ergebnisse kann eine Gaschromatograph-Massenspektrometer-Kombination (GC/MS) verwendet werden. Es gibt auch spezifische Methoden zur Probennahme in Wasser, Luft, Boden, Sediment und biologischem Material.
Welche toxikologischen Eigenschaften hat EDB?
EDB wird schnell über Lunge, Haut und Magen-Darm-Trakt aufgenommen, wobei Leber und Nieren die Hauptzielorgane sind. Der Metabolismus von EDB kann über den Konjugationsweg oder den Oxidationsweg erfolgen, wobei reaktive Metaboliten entstehen können, die DNA schädigen können. Die Ausscheidung erfolgt hauptsächlich in Form von Mercaptursäure über die Nieren.
Welche Symptome und Schadwirkungen kann EDB verursachen?
EDB kann akute und chronische toxische Wirkungen haben. Akute Exposition kann zu Reizungen der Schleimhäute, Übelkeit, Erbrechen und Schäden an Leber und Nieren führen. Chronische Exposition kann zu Konjunktivitis und Reizungen der Atemwege führen. EDB ist auch als mutagen und cancerogen bekannt und kann die Reproduktionsfähigkeit beeinträchtigen.
Welche therapeutischen Maßnahmen sind bei EDB-Vergiftungen erforderlich?
Bei Augenkontakt sollte sofort eine Spülung mit physiologischer Kochsalzlösung erfolgen. Bei Hautkontakt ist eine gründliche Dekontamination erforderlich. Bei inhalativer Aufnahme ist eine Lungenödemprophylaxe mit Glucocorticoiden notwendig. Ein Kreislaufkollaps sollte nicht mit Catecholaminen behandelt werden. Nach Ingestion kann eine Magenspülung durchgeführt werden.
Welche gesetzlichen Bestimmungen gelten für EDB?
Für EDB gelten verschiedene gesetzliche Bestimmungen, die die Abgabe, Lagerung, Entsorgung und den Transport regeln. Dazu gehören die Gefahrstoffverordnung, das Abfallgesetz, das Bundesemissionsschutzgesetz, das Pflanzenschutzmittelgesetz und die Transportvorschriften. EDB ist als stark wassergefährdend eingestuft.
Welche Kennzeichnungen sind für EDB erforderlich?
EDB muss entsprechend seiner Gefährlichkeit gekennzeichnet werden. Dazu gehören Grenzwerte, Giftklassifizierungen, R- und S-Sätze, Gefahrensymbole, Verbotszeichen, Gebotszeichen und Warnzeichen.
- Quote paper
- Paul Heinz (Author), 2004, 1,2-Dibromethan - Allgemeine und spezielle Toxikologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108767