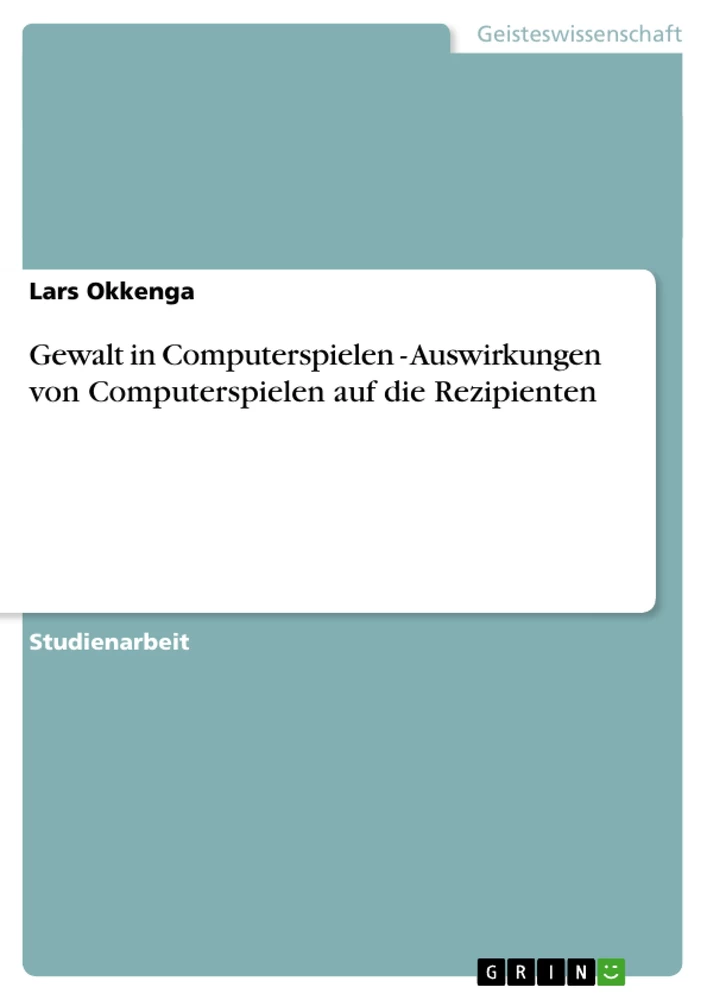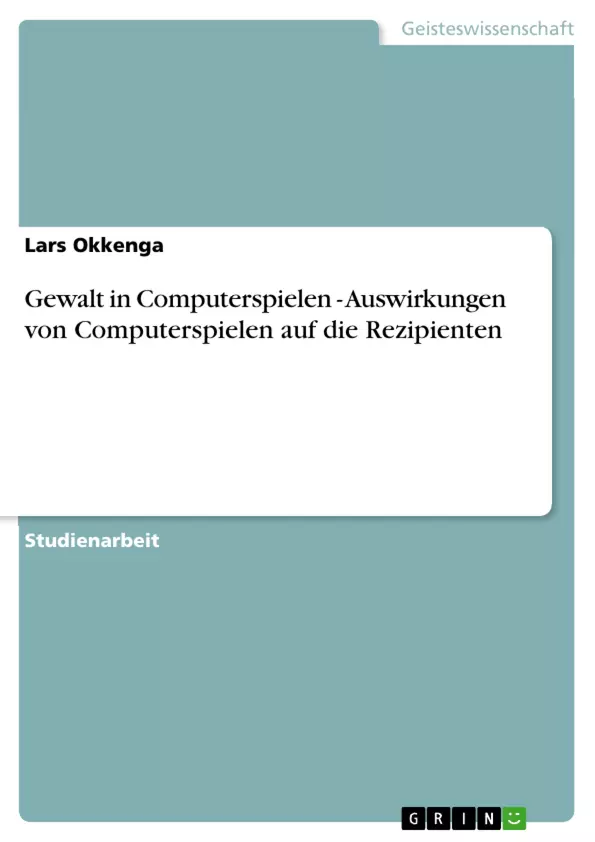Einleitung
In unserer Gesellschaft hat der Computer einen festen Platz eingenommen, an nahezu jedem Arbeitsplatz und ebenso in den Wohnungen. Die klassischen Medien „loben“ die Vorzüge der technischen Entwicklung. So scheinen unsere Schulen, durch eine Internetanbindung und gewisse „Computerkompetenz“ von Seiten der Lehrer, ungeahnte Möglichkeiten der Wissenserweiterung zu bekommen. Die Forderung nach einem „lebenslangen“ Lernen soll durch den Computer ihre praktische Rahmung bekommen. Denn nur dadurch ist es eben möglich, nach unseren Politikern, diese Forderung zu erfüllen. Inwieweit es sich um allenfalls optimistische „Blasen“ handelt und wie überhaupt eine praktische Umsetzung aussehen soll, bleibt die Frage einer anderen Arbeit. Unbestritten ist aber die Tatsache, dass durch die Verbreitung von Computern auch andere Verwendungsmöglichkeiten verstärkt genutzt werden, das Spielen.
Und hier ist es dann auch vorbei mit den optimistischen Einschätzungen. Den Eltern wird versucht zu Suggerieren, dass ihre spielenden Kinder schnell Vereinsamen, gewalttätig werden, in die „virtuelle“ Welt abdriften und sie ihre Kinder bald nicht mehr wieder- erkennen. Dabei scheint eine unausgesprochene Regel zu gelten. Bücher sind als positiv anzusehen, sie fördern die Fantasie, Fernsehen und Filme sind nicht so gut wie Bücher, aber man kann immerhin noch Informationen bekommen, sich bilden. Computerspiele sind einfach nur langweilig, machen aggressiv, lassen die Rezipienten teilnahmslos werden und wenn die Eltern nicht aufpassen, laufen ihre Kinder bald Amok. Manche Autoren und Forscher sehen durch den Konsum von Spielen eine Generation „verblödeter“ Menschen heranwachsen und fordern ein Verbot. Immerhin etwas, dass Computerspiele mit Film und Fernsehen teilen. Um nur einige Vermutungen zu nennen. In dieser Arbeit geht es primär um die Fragen: Kommt es zu einer Verwischung von „virtueller“ Welt und „Realität? Besteht die Gefahr einer Übertragung von Gewalt? Und verlieren die Rezipienten durch Computerspiele ihre empathischen Fähigkeiten?
Ausgehend von den Fragen besteht das erste Kapitel aus einer Darstellung der bekanntesten klassischen Medientheorien, welche oftmals auf Computerspiele übertragen werden. Mit dem Ergebnis, dies sei vorweggenommen, dass sie oftmals schon bei klassischen Medien nicht anwendbar sind und somit auch nicht auf Computerspiele angewendet werden können. Im Hauptteil wird versucht, die genannten Fragen zu beantworten.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Erklärungsansätze zur Wirkungsweise von Computerspielen auf die Rezipienten
- Stimulus- Response- Ansatz
- Uses-and- Gratifications- Ansatz
- Verbreitete Thesen zur Wirkung von „virtueller“ Gewalt
- Transfer von „virtueller“ Gewalt in „reale“ Gewalt
- „Reale“ Welt-„Virtuelle“ Welt
- Transfer zwischen „realer“, „virtueller“ Welt
- Wie wird Gewalt in Computerspielen wahrgenommen?
- Empathie
- „Reale“ Welt-„Virtuelle“ Welt
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Gewalt in Computerspielen auf die Rezipienten. Die zentrale Fragestellung befasst sich mit der möglichen Verwischung von virtueller und realer Welt, der Gefahr eines Gewalttransfers und dem potenziellen Verlust empathischer Fähigkeiten bei Spielern. Die Arbeit analysiert klassische Medientheorien und deren Anwendbarkeit auf den Kontext von Computerspielen.
- Wirkungsweise von Computerspielen
- Transfer von virtueller Gewalt in die Realität
- Wahrnehmung von Gewalt in Computerspielen
- Einfluss von Computerspielen auf Empathie
- Anwendbarkeit klassischer Medientheorien auf Computerspiele
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und skizziert die Forschungsfragen. Kapitel 1 präsentiert klassische Medientheorien, insbesondere den Stimulus-Response-Ansatz und den Uses-and-Gratifications-Ansatz, und bewertet deren Anwendbarkeit auf den Kontext von Computerspielen. Der Stimulus-Response-Ansatz wird als zu vereinfachend kritisiert, während der Uses-and-Gratifications-Ansatz einen aktiveren Mediennutzer postuliert. Kapitel 2 erörtert den Transfer von virtueller Gewalt in die reale Welt, die Wahrnehmung von Gewalt im Spielkontext und den Einfluss auf Empathie.
Schlüsselwörter
Gewalt in Computerspielen, Medientheorien (Stimulus-Response, Uses-and-Gratifications), Virtuelle Realität, Realitätsverlust, Gewalttransfer, Empathie, Rezipienten, Medienwirkung.
- Quote paper
- Lars Okkenga (Author), 2004, Gewalt in Computerspielen - Auswirkungen von Computerspielen auf die Rezipienten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108736