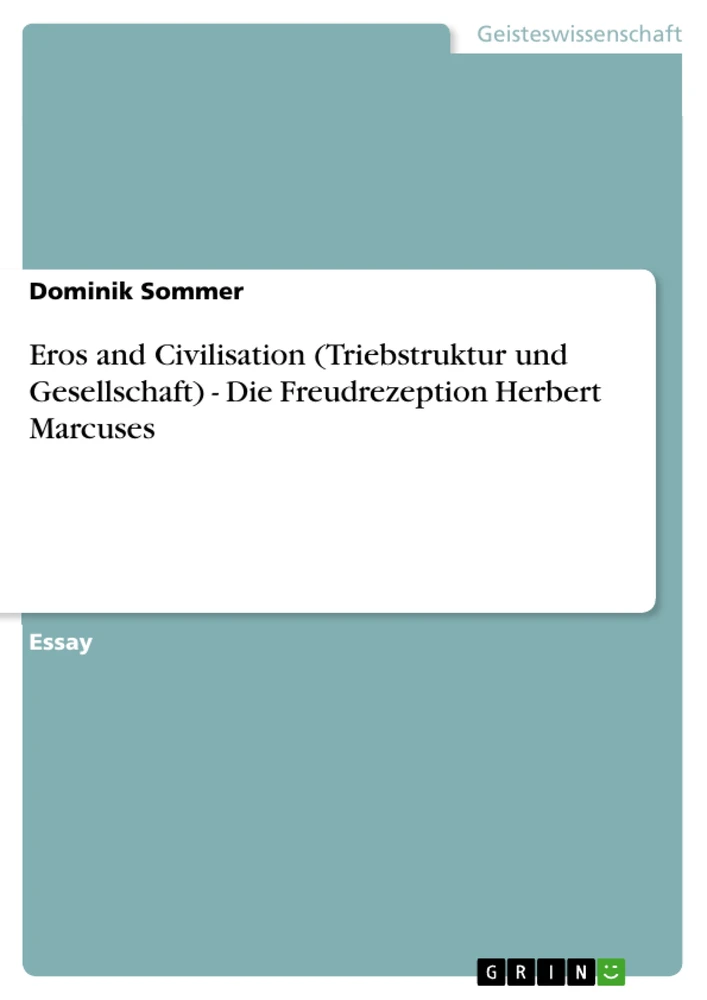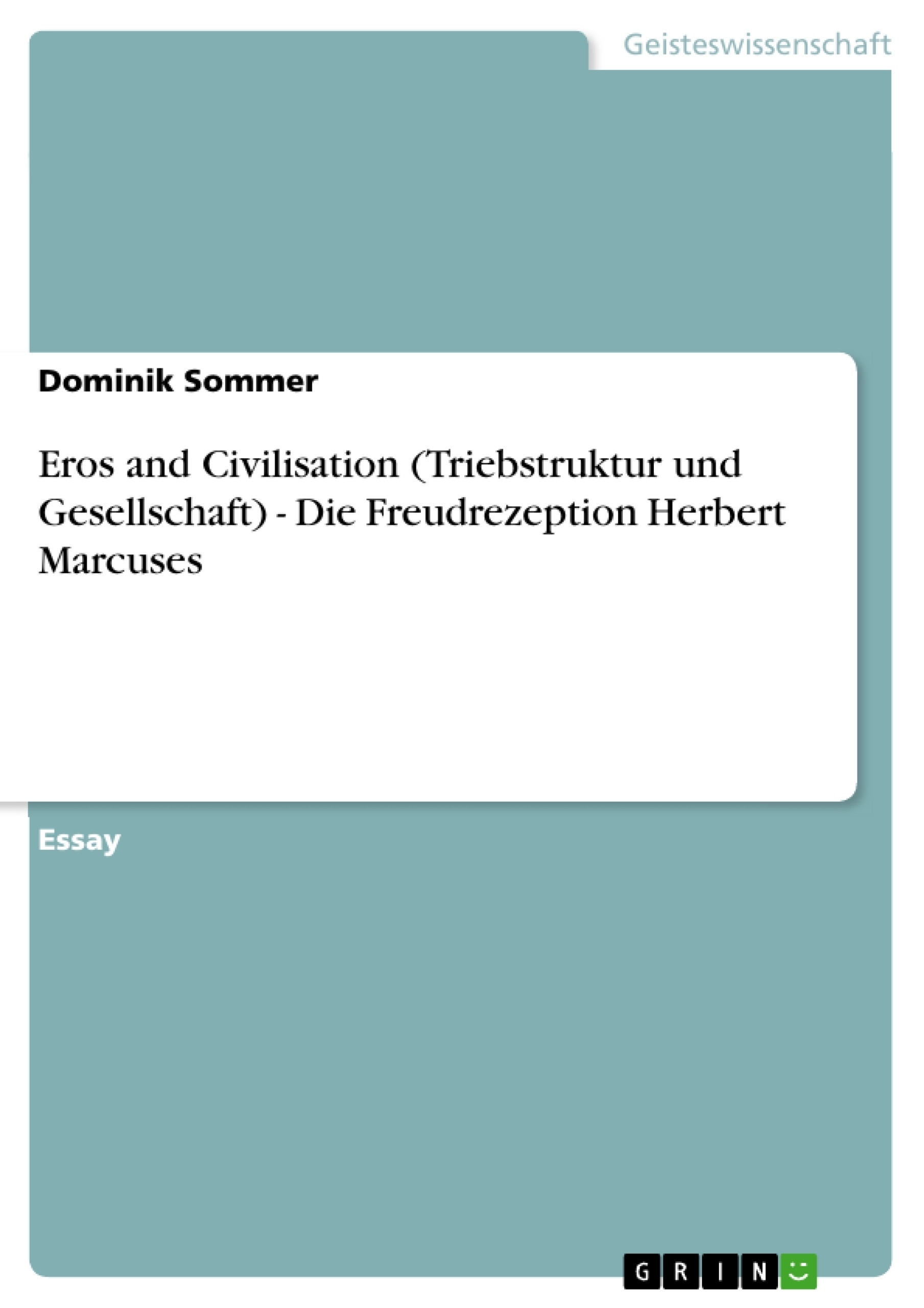Herbert Marcuses 1955 erschienene utopische Kulturkritik „Eros and Civilisation“ hat als Grundlage folgende psychologischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Komponenten:
1. Freuds metapsychologische Triebtheorie („Das Unbehagen in der Kultur“), darauf aufbauend und diese kritisch erweiternd.
2. Die marxistische Ökonomie mit der Hegelianischen Dialektik als Grundlage.
3. Die ästhetische Vernunft der idealistischen Philosophie in Form von Schillers „Ästhetischem Staat“.
Das klassische Programm der Kritischen Theorie, eine Mischung aus Freudscher Metapsychologie und Marxistischer Ökonomie wird um eine ästhetische Vernunft ergänzt, um einen utopischen Ausweg aus der instrumentellen Vernunft der rationalistischen Dialektik der Philosophie westlicher Prägung und der damit verbundenen Lebensweise zu finden. Ausgehend von Zweifeln am Fortschritt der westlichen theoretischen wie praktischen Vernunft und vor dem Hintergrund der negativen Auswirkungen dieses Fortschritts entwickelt Marcuse ein Alternativprogramm zur Konsumgesellschaft, die er nicht als die Krönung der westlichen Zivilisation ansehen kann.
„Eros and Civilisation“ (Triebstruktur und Gesellschaft)
Die Freudrezeption Herbert Marcuses
Dominik Sommer
Herbert Marcuses 1955 erschienene utopische Kulturkritik „Eros and Civilisation“ hat als Grundlage folgende psychologischen, wirtschaftlichen und ästhetischen Komponenten:
1. Freuds metapsychologische Triebtheorie („Das Unbehagen in der Kultur“), darauf aufbauend und diese kritisch erweiternd.
2. Die marxistische Ökonomie mit der Hegelianischen Dialektik als Grundlage.
3. Die ästhetische Vernunft der idealistischen Philosophie in Form von Schillers „Ästhetischem Staat“.
Das klassische Programm der Kritischen Theorie, eine Mischung aus Freudscher Metapsychologie und Marxistischer Ökonomie wird um eine ästhetische Vernunft ergänzt, um einen utopischen Ausweg aus der instrumentellen Vernunft der rationalistischen Dialektik der Philosophie westlicher Prägung und der damit verbundenen Lebensweise zu finden. Ausgehend von Zweifeln am Fortschritt der westlichen theoretischen wie praktischen Vernunft und vor dem Hintergrund der negativen Auswirkungen dieses Fortschritts entwickelt Marcuse ein Alternativprogramm zur Konsumgesellschaft, die er nicht als die Krönung der westlichen Zivilisation ansehen kann.
Um zu den Wurzeln des westlichen Rationalismus zurückzukommen, hinterfragt Marcuse zuerst die Freudsche Triebtheorie. Das Programm dessen Metapsychologie sieht Marcuse als exemplarisch für den Rationalismus westlicher Wissenschaften und in Freuds paradigmatischen Satz - „Wo Es war, soll Ich werden“ kumulieren. Bei dem Rationalisten Freud ist kultureller Fortschritt nur durch eine repressive Unterdrückung des menschlichen Eros- und Todestriebs möglich. Eros und Thanatos haben bei Freud einen selbstzerstörerischen Charakter, weil der Mensch, wenn er diesen Trieben hemmungslos folgen würde, im Kampf ums Dasein (Lebensnot) gegenüber der Natur unterliegt und untergeht. Kultureller Fortschritt ist bei Freud also nur über die repressive Sublemierung der Triebe möglich. Das rationalistische, auf einem Subjekt-Objekt-Charakter beruhende Leistungsprinzip, dessen Grundlage die Transszendenz der Welt durch das Ich ist, obsiegt als Realitätsprinzip gegenüber dem Lust- oder Erosprinzip. Letzeres wird verdrängt (und führt zum neurotischen Charakter des Freudschen Bürgers). Hier liegt der Ursprung einer unterdrückenden Kultur, die der Logik der Herrschaft folgt.
Marcuses Ziel ist die Etablierung einer herrschaftsfreien Ordnung, in der sich der Mensch mit der Natur versöhnt, eins wird. Da die Lebensnot in der Konsumgesellschaft entfällt[I], kann Marcuse die fortgesetzte Unterdrückung des Lustprinzips durch das Leistungsprinzip nur als künstlich verlängerten Kampf ums Dasein aus Herrschaftsgründen betrachten. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Natur wird zum Selbstzweck und ist dem Kapitalismus geschuldet.
Marcuse hinterfragt neben diesen kapitalismuskritischen Aspekten auch die Freudschen Prämissen der Kulturentwicklung und zeigt, dass die menschlichen Triebe historisch und gesellschaftlich bedingt sind. Er wendet sich vom biologisch-ahistorischen Triebkonstrukt Freuds ab, indem er die historische Bedingtheit der Triebe auf zwei Ebenen zeigt: erstens auf der phylo- genetischen-biologischen Ebene (Kampf Mensch-Natur); zweitens auf einer soziologischen (Kampf Mensch-Mensch). Wenn die Triebe historisch und gesellschaftlich bedingt sind, können sie sich vor dem Hintergrund der Zeit und ihrer Gesellschaften auch verändern.
Um sein Ziel zu erreichen, nämlich die Irrationalität der herrschenden Rationalität zu zeigen und gleichzeitig eine Alternative zu entwickeln, muss Marcuse den Menschen in einer neuen Kultur etablieren. Dafür greift er auf das unterdrückte Lustprinzip im Menschen zurück. Die totale Triebentwicklung ist sein Ziel, die Befreiung der inneren Natur von der repressiven Umwandlung des Todestriebs.
An die Stelle des westlichen Rationalismus, dem ständig transszendieren Ich, den damit verbundenen Ich-Spaltungen, Rollentrennungen und Entfremdungen will er mit der Hilfe des Ästhetizimus des deutschen Idealismus den Menschen zur materialen Geschichte zurückführen und so mit der Natur versöhnen. Der Weg dorthin führt über die Phantasie des Menschen und sein ästhetisches Empfinden. U.a. am Beispiel des Narziss, der sich im Anblick seiner selbst genug ist, etabliert er eine libidonöse Moral, die auf dem Lustprinzip als Realitätsprinzip gründet. Vernunft und Sinnlichkeit vereinen sich in einem erfüllten menschlichen Dasein, wenn der Mensch zum Ding wird, d.h. um seiner selbst willen existiert. Die zweckfreie Existenz, die durch die Aufhebung des Reichs der Notwendigkeit möglich wird, findet er im Reich der Ästhetik: dort wo die Schönheit um der Schönheit Willen besteht, die Form um der Form Willen und keine Verdinglichung mehr zur Ausbeutung führt. Das Ego wird selbst zum Ding und beherrscht nicht mehr andere Dinge. Der Konflikt zwischen Mensch und Natur ist aufgehoben und Eros und Thanatos erscheinen nicht mehr als Bedrohung der menschlichen Kultur, sondern als die Stützen einer neuen Kultur. Ein auf Grund des kapitalistischen Leistungsprinzips regide genitalisiertes Geschlechtsleben kann sich ganzheitlich polymorph-pervers innerhalb einer ästhetischen Sinnlichkeit entwickeln. Die Überwindung des Kapitalismus wird möglich durch eine herrschaftsfreie Sexualisierung des Alltags in Form des Lustprinzips als Basis der neuen Kultur.
Einen Anfang stellt jenes Motto der 68er Studentenbewegung dar, auch wenn es in seiner Unmittelbarkeit der Umsetzung, weil systemimmanent gedacht und es die Machtkomponente des genitalisierten Sexes beibehält, zu kurz greift:
„Wer alles weiß über Sexualität, der kann besser lieben, wer besser liebt, hat mehr Lust, wer mehr Lust hat, ist freier, wer freier ist, befreit die Gesellschaft“.
Marcuse avancierte mit den Studentenbewegungen Europas und Amerikas zum Starintellektuellen, nicht zuletzt, weil er der strengen Negation des Frankfurter Teils der Kritischen Theorie positiv-utopistische aber auch realistische Möglichkeiten gesellschaftlichen Wandels, der hauptsächlich auf der Politisierung gesellschaftlicher Randgruppen basieren sollte, gegenüberstellte.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Herbert Marcuses "Eros and Civilisation" (Triebstruktur und Gesellschaft)?
Herbert Marcuses "Eros and Civilisation" ist eine utopische Kulturkritik, die auf Freuds Triebtheorie, der marxistischen Ökonomie und der ästhetischen Vernunft basiert. Sie zielt darauf ab, einen Ausweg aus der instrumentellen Vernunft der westlichen Philosophie und der Konsumgesellschaft zu finden.
Wie kritisiert Marcuse Freuds Triebtheorie?
Marcuse hinterfragt Freuds Annahme, dass kultureller Fortschritt nur durch repressive Unterdrückung der Triebe möglich ist. Er argumentiert, dass die Unterdrückung des Lustprinzips in der Konsumgesellschaft künstlich verlängert wird, um Herrschaftsstrukturen aufrechtzuerhalten.
Wie unterscheidet sich Marcuses Sichtweise von der Freudschen?
Marcuse wendet sich von Freuds biologisch-ahistorischem Triebkonstrukt ab und betont die historische und gesellschaftliche Bedingtheit der Triebe. Er glaubt, dass sich die Triebe im Laufe der Zeit und in verschiedenen Gesellschaften verändern können.
Welches Ziel verfolgt Marcuse mit der Etablierung einer neuen Kultur?
Marcuse strebt eine herrschaftsfreie Ordnung an, in der sich der Mensch mit der Natur versöhnt. Er will die totale Triebentwicklung und die Befreiung der inneren Natur von der repressiven Umwandlung des Todestriebs erreichen.
Wie will Marcuse den Menschen mit der Natur versöhnen?
Marcuse will den Menschen mit Hilfe des Ästhetizismus des deutschen Idealismus zur materialen Geschichte zurückführen und ihn so mit der Natur versöhnen. Der Weg dorthin führt über die Phantasie und das ästhetische Empfinden des Menschen.
Welche Rolle spielt das Lustprinzip in Marcuses Utopie?
Marcuse etabliert eine libidinöse Moral, die auf dem Lustprinzip als Realitätsprinzip gründet. Er glaubt, dass Vernunft und Sinnlichkeit sich in einem erfüllten menschlichen Dasein vereinen können, wenn der Mensch um seiner selbst willen existiert.
Was versteht Marcuse unter einer ganzheitlich polymorph-perversen Sinnlichkeit?
Marcuse sieht die Überwindung des Kapitalismus durch eine herrschaftsfreie Sexualisierung des Alltags in Form des Lustprinzips als Basis der neuen Kultur. Das bedeutet, dass sich ein rigide genitalisiertes Geschlechtsleben ganzheitlich polymorph-pervers innerhalb einer ästhetischen Sinnlichkeit entwickeln kann.
Welche Rolle spielte Marcuse in der 68er Studentenbewegung?
Marcuse avancierte mit den Studentenbewegungen Europas und Amerikas zum Starintellektuellen, weil er positiv-utopistische, aber auch realistische Möglichkeiten gesellschaftlichen Wandels aufzeigte, die hauptsächlich auf der Politisierung gesellschaftlicher Randgruppen basieren sollten.
Was kritisiert Marcuse an der Konsumgesellschaft?
Marcuse kritisiert die Konsumgesellschaft, weil sie die fortgesetzte Unterdrückung des Lustprinzips durch das Leistungsprinzip nur als künstlich verlängerten Kampf ums Dasein aus Herrschaftsgründen betrachtet. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen und die Natur wird zum Selbstzweck und ist dem Kapitalismus geschuldet.
- Quote paper
- Dominik Sommer (Author), 2004, Eros and Civilisation (Triebstruktur und Gesellschaft) - Die Freudrezeption Herbert Marcuses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108707