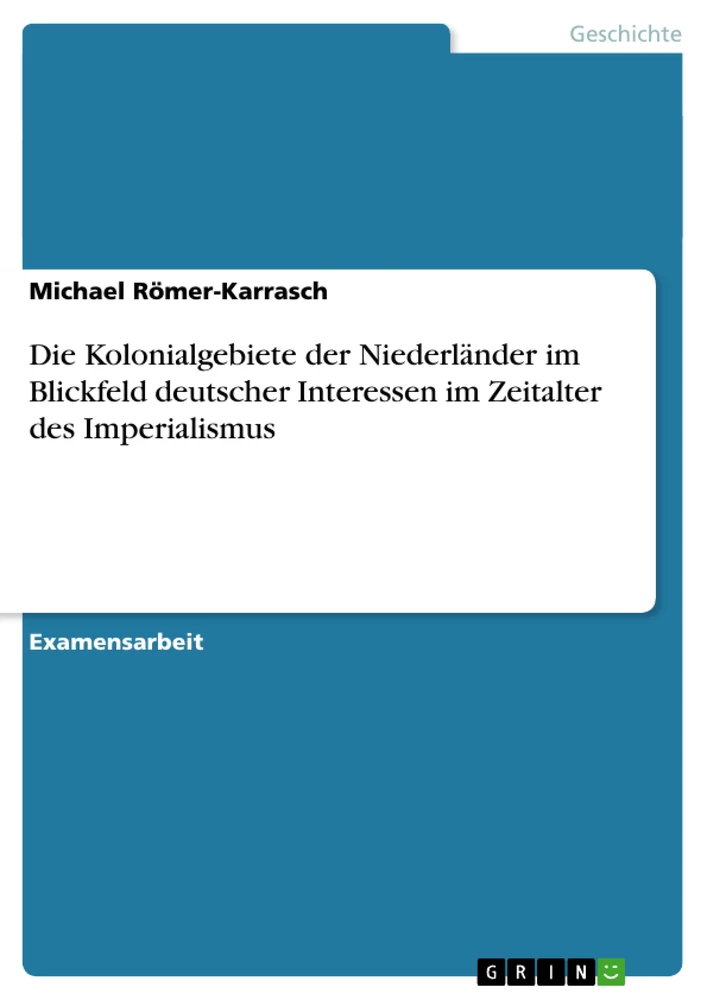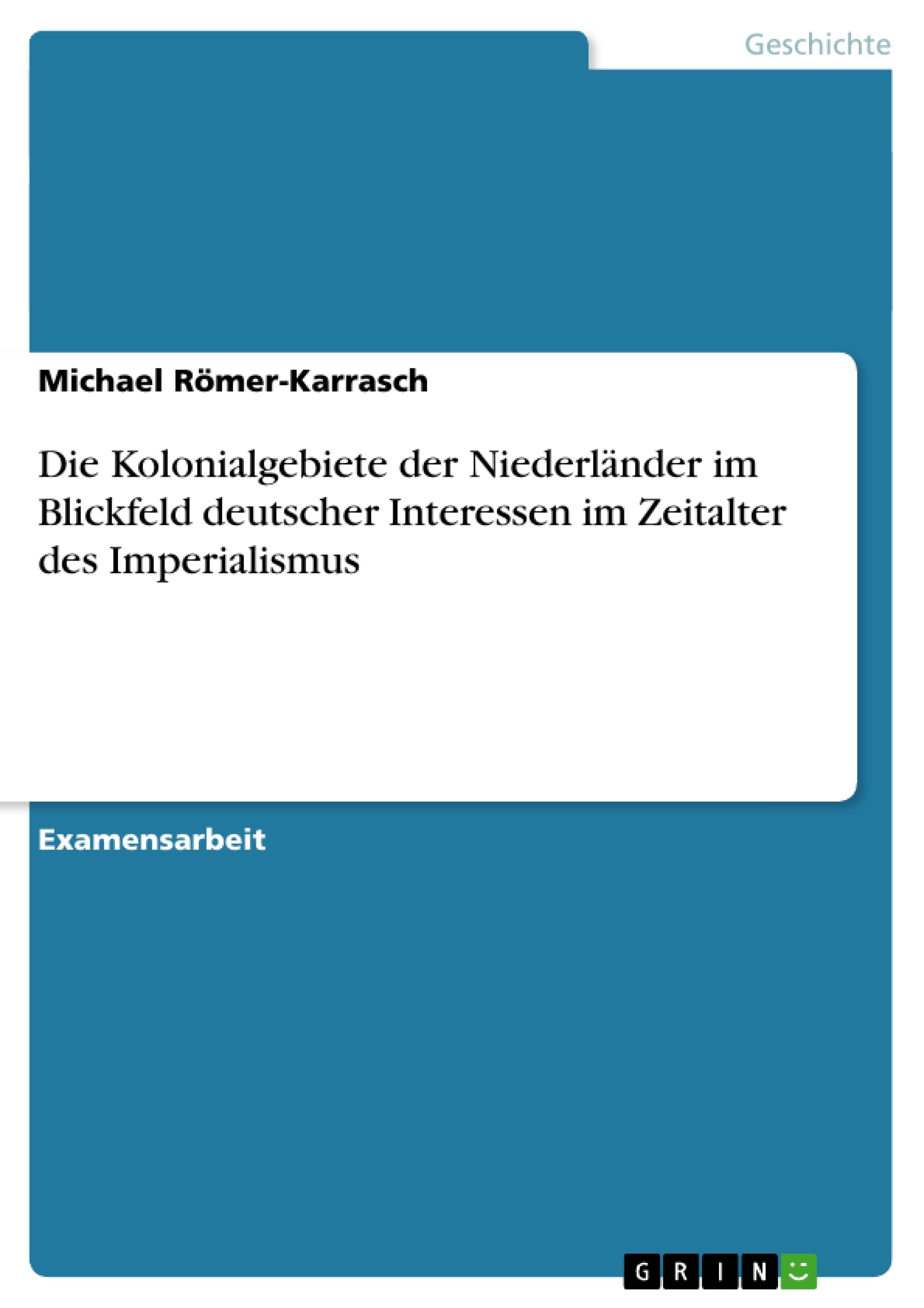Cognatio movet invidiam. 1
Erasmus (nach Aristoteles)
Ein Großteil der kolonialen Beziehungen der Deutschen zu den Niederländern kann plausibel mit oben zitierter Redewendung beschrieben werden. Während mit ,,Niederländern" heute gemeinhin die Staatsbürger der Niederlande gemeint sind, bezeichnete der Begriff in Deutschland zur Zeit des Imperialismus gleichzeitig ein deutsch-niederländisches Verwandtschaftsverhältnis. Auch der aktuelle Brockhaus von 2001 definiert Niederländer als ein germanisches Volk, das in den Niederlanden lebe und seine eigene Sprache aus dem Altniederdeutschen entwickelt hätte. Diese - nicht abzustreitende - Verwandtschaftsbeziehung konnte jenen in Deutschland willkommen sein, die Interesse daran hatten, aus einer ,,natürlichen" Verbundenheit Kapital zu schlagen. Dieses Interesse entstand, weil die Verwandten etwas besaßen, was Deutschland nicht hatte oder Deutsche glaubten, nicht in ausreichender Menge zu haben: Kolonien, bzw. Besitzungen außerhalb Europas.
Als "niederdeutsche Stammesbrüder" wurden außer den europäischen niederländischen Nachbarn2 vor allem auch die Buren in Südafrika bezeichnet, die im Zuge des Südafrikanischen Krieges3 große Sympathien in Europa weckten. Versuche, diese lang zurückliegende Verwandtschaft zu instrumentalisieren, trafen auf ein Selbstverständnis der Niederländer, das historisch vom Kampf um Unabhängigkeit und Neutralität gekennzeichnet war. Schon seit dem Westfälischen Frieden 1648 waren die Niederlande eine international anerkannte Republik, und auch die Buren waren ständig um Unabhängigkeit - zunächst sogar von den Niederländern, später von den Briten - bemüht.
Der Stammverwandtschaftsgedanke, der von den Alldeutschen zur politischen Ideologie entwickelt wurde, soll daraufhin untersucht werden, inwiefern er für die Politik, für die Propaganda und die politisch-psychologischen Beziehungen zwischen Niederländern und Deutschen bestimmend war. [...]
1 lat. ,,Verwandtschaft erregt Neid". Erasmus von Rotterdam, Adagia. Sammlung antiker Sprichwörter und Redensarten 1500-1536, Nr. 3759.
2 Dabei wurden auch die Belgier mit einbegriffen, deren Besitztümer in Mittelafrika Gegenstand deutschen Interesses wurden, vgl. Horst Gründer, Geschichte der deutschen Kolonien, Paderborn - München - Wien - Zürich 42000, 102-105. Zugunsten einer breiteren Darstellung der Einflüsse deutschen Interesses an den niederländischen Kolonialgebieten auf das deutsch-niederländische Verhältnis wird auf diesen Aspekt verzichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das deutsch-niederländische Verhältnis
- Empfindlichkeit und Verletzbarkeit - Charakteristika deutsch-niederländischer Interdependenz
- Deutsche Weltpolitik - „Hans Dampf auf allen Gassen“
- Das verschobene Machtverhältnis
- Die „Stammverwandtschaft“ als Vereinnahmungsinstrument
- Die Entwicklung der kolonialen Strukturen
- Die Herrschaftsausbreitung in Niederländisch-Ostindien
- Vom niederländischen Kaufmannskapitalismus zur kolonialen Herrschaft
- Die ethische roeping - Moralische Legitimation kolonialer Herrschaft
- Die Festigung direkter Herrschaft
- Südafrika seit der Besiedlung durch Europäer
- Portugiesen und Briten am Kap
- Die Gründung der niederländischen Kapkolonie
- Siedlung außerhalb der Kapkolonie
- Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Lage der einheimischen Bevölkerung
- Der „Große Treck“
- Gründung der Burenrepubliken
- Die Entdeckung von Bodenschätzen
- Der Südafrikanische Krieg
- Westindien - Umschlagplatz für den Sklavenhandel
- Die Herrschaftsausbreitung in Niederländisch-Ostindien
- Die deutschen Interessen an niederländischen Kolonialgebieten
- Die deutsche Kolonialpropaganda
- Deutsche in der niederländischen Kolonialarmee
- Bankiers, Geschäftsleute und Pflanzer - Die Attraktivität der niederländischen Kolonien
- Die transnationale Kooperation von Banken
- Plantagen und Handel am Beispiel Tabak
- Entstehung und Bedeutung des Tabakanbaus auf Sumatra
- Pflanzer auf Sumatra - Deutsche Karrieren
- Menschenhandel mit indonesischen und chinesischen Arbeitsmigranten
- Koloniale Nachbarschaft auf Neuguinea
- Wirtschaftliche und politische Einflussnahme in Niederländisch-Indien
- Das Beispiel des Geschäftsmannes Emil Helfferich
- Deutsche Kohlenstationen - Viel Lärm um nichts?
- Über eine Zollunion zu kolonialem Besitz?
- Der zwiespältige Blick auf Südafrika
- Versuche der rhetorisch-emotionalen Vereinnahmung über die „Stammverwandtschaft“ in Südafrika
- Das Auseinanderdriften wirtschaftlich-politischer und alldeutscher Interessen
- Niederländisch-Westindien
- Missionarische Aktivitäten
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die deutsch-niederländischen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus, insbesondere im Kontext der niederländischen Kolonialgebiete. Das Hauptziel ist es, die komplexen Interaktionen zwischen deutschen Interessen und niederländischen Kolonialbestrebungen zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese das Verhältnis beider Nationen beeinflussten.
- Deutsch-niederländische Interdependenz und das Konzept der „Stammverwandtschaft“
- Deutsche wirtschaftliche und politische Aktivitäten in den niederländischen Kolonien
- Die Rolle der Kolonialpropaganda und die Wahrnehmung der Kolonien in Deutschland
- Die Auswirkungen deutscher Ambitionen auf die niederländische Kolonialpolitik
- Vergleichende Analyse der deutsch-niederländischen Beziehungen in verschiedenen Kolonialgebieten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung legt den Fokus auf die deutsch-niederländischen Beziehungen im Kontext des Kolonialismus und der Idee einer „Stammverwandtschaft“, die von Deutschland zur Durchsetzung eigener Interessen genutzt werden sollte. Das Zitat von Erasmus von Rotterdam, „Cognatio movet invidiam“, wird als Leitmotiv eingeführt, um die ambivalente Beziehung zwischen Neid und Verwandtschaft zu beleuchten. Die Arbeit kündigt eine breite Untersuchung der deutschen Interessen an, einschließlich konkreter Aktivitäten, Äußerungen von Interessengruppen und Gerüchte, an.
Das deutsch-niederländische Verhältnis: Dieses Kapitel analysiert die komplexen deutsch-niederländischen Beziehungen, geprägt von sowohl Empfindlichkeit und Verletzbarkeit als auch dem Bestreben Deutschlands, seine globale Rolle zu erweitern. Es untersucht das sich verändernde Machtverhältnis zwischen beiden Nationen und die Instrumentalisierung der „Stammverwandtschaft“ als Mittel zur Durchsetzung deutscher Interessen.
Die Entwicklung der kolonialen Strukturen: Dieses Kapitel beschreibt die Ausbreitung niederländischer Herrschaft in Ostindien, die Entwicklung der Kapkolonie in Südafrika und die Rolle der Niederlande im Sklavenhandel in Westindien. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen der Kolonisierung, von frühkapitalistischen Handelsbeziehungen bis hin zur direkten Herrschaft, sowie die moralische Rechtfertigung dieser Herrschaft. Die Geschichte Südafrikas wird detailliert dargestellt, von den ersten europäischen Siedlern über den „Großen Treck“ bis zum Südafrikanischen Krieg.
Die deutschen Interessen an niederländischen Kolonialgebieten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die vielfältigen deutschen Interessen in den niederländischen Kolonien. Es beleuchtet die Rolle der deutschen Kolonialpropaganda, die Präsenz deutscher Soldaten in der niederländischen Kolonialarmee und die Aktivitäten deutscher Bankiers, Geschäftsleute und Pflanzer. Der Fokus liegt auf der wirtschaftlichen Einflussnahme, beispielsweise durch den Tabakanbau auf Sumatra und den Menschenhandel. Der Einfluss deutscher Akteure in Neuguinea und die Diskussion um eine mögliche Zollunion werden ebenfalls behandelt. Schließlich beleuchtet das Kapitel die ambivalente deutsche Haltung gegenüber Südafrika, geprägt von der Instrumentalisierung der „Stammverwandtschaft“ und dem Konflikt zwischen wirtschaftlichen und alldeutschen Interessen. Der Einfluss deutscher Missionare wird auch berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Deutsch-niederländische Beziehungen, Imperialismus, Kolonialismus, Niederländisch-Ostindien, Kapkolonie, Südafrika, „Stammverwandtschaft“, wirtschaftliche Interessen, politische Einflussnahme, Kolonialpropaganda, deutsche Kolonialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsch-Niederländische Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die komplexen deutsch-niederländischen Beziehungen während des Imperialismus, mit besonderem Fokus auf die Interaktionen zwischen deutschen Interessen und den niederländischen Kolonialbestrebungen in deren Gebieten. Sie untersucht, wie diese Interaktionen das Verhältnis beider Nationen beeinflussten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die deutsch-niederländische Interdependenz und das Konzept der „Stammverwandtschaft“, deutsche wirtschaftliche und politische Aktivitäten in den niederländischen Kolonien (Niederländisch-Ostindien, Kapkolonie, Südafrika, Westindien), die Rolle der Kolonialpropaganda und die Wahrnehmung der Kolonien in Deutschland, die Auswirkungen deutscher Ambitionen auf die niederländische Kolonialpolitik und einen Vergleich der deutsch-niederländischen Beziehungen in verschiedenen Kolonialgebieten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das deutsch-niederländische Verhältnis, ein Kapitel über die Entwicklung der kolonialen Strukturen in den niederländischen Kolonien, ein Kapitel über die deutschen Interessen in diesen Kolonien und ein Resümee. Jedes Kapitel beleuchtet spezifische Aspekte der deutsch-niederländischen Beziehungen im Kontext des Kolonialismus.
Wie wird die „Stammverwandtschaft“ in der Arbeit behandelt?
Die „Stammverwandtschaft“ wird als ein zentrales Konzept betrachtet, das von Deutschland instrumentalisiert wurde, um eigene Interessen in den niederländischen Kolonien durchzusetzen. Die Arbeit untersucht, wie dieses Konzept sowohl rhetorisch als auch politisch eingesetzt wurde und welche Auswirkungen dies auf die deutsch-niederländischen Beziehungen hatte.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit nennt zahlreiche konkrete Beispiele, darunter die Aktivitäten deutscher Bankiers, Geschäftsleute und Pflanzer in den niederländischen Kolonien, den Tabakanbau auf Sumatra, den Menschenhandel, die Rolle deutscher Soldaten in der niederländischen Kolonialarmee, die deutsche Kolonialpropaganda, den Einfluss deutscher Akteure in Neuguinea und die Diskussion um eine mögliche Zollunion. Die Geschichte Südafrikas und der Südafrikanische Krieg werden ebenfalls detailliert behandelt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die deutsch-niederländischen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus komplex und ambivalent waren. Sie zeigt auf, wie deutsche Interessen die niederländische Kolonialpolitik beeinflussten und wie das Konzept der „Stammverwandtschaft“ strategisch genutzt wurde. Die Arbeit betont die vielfältigen Facetten der Interaktion zwischen beiden Nationen im Kontext des Kolonialismus.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Deutsch-niederländische Beziehungen, Imperialismus, Kolonialismus, Niederländisch-Ostindien, Kapkolonie, Südafrika, „Stammverwandtschaft“, wirtschaftliche Interessen, politische Einflussnahme, Kolonialpropaganda, deutsche Kolonialpolitik.
- Quote paper
- Michael Römer-Karrasch (Author), 2003, Die Kolonialgebiete der Niederländer im Blickfeld deutscher Interessen im Zeitalter des Imperialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108680